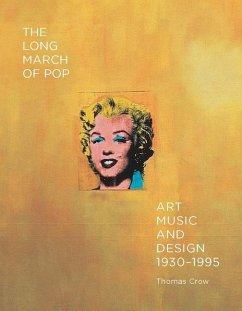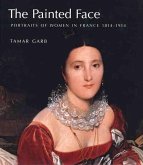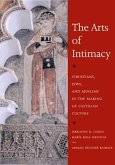Was ist Pop? Die Antwort, mein Freund, hat der Wind verweht. Ein Buch hat sie gefunden
Was für ein Jahr für Bob Dylan, dieses 1965. Im März veröffentlicht er "Bringing It All Back Home", seine erste Platte mit Rock-Instrumentierung. Im Radio läuft sein ursprünglich akustisches Stück "Mr. Tambourine Man" in der lauten Variante der Byrds rauf und runter - aus der Ballade war ein schmissiger Popsong geworden. Die Byrds, so was wie die Beatles der amerikanischen Westküste, arrangieren auch andere Dylan-Songs erfolgreich um - plötzlich konnte man zu seinen Folksongs richtig tanzen.
Und als Dylan dann im Mai seine erste England-Tournee antrat, war ihm die ewige Coffeeshop-Nummer mit Klampfe und jaulender Mundharmonika nicht mehr interessant genug. Er trug Polka Dots und Satin zu superengen Hosen, seine Band rockte London, kam in die Charts - und wurde dafür ausgebuht. Verrat an der heiligen Einfalt des Folk, Ausverkauf, hieß es. Dylan machte weiter. Er war plötzlich überzeugt, dass man im Radio laufen und zugleich ein großer Künstler sein konnte.
Warum? Der amerikanische Kunsthistoriker Thomas Crow meint in seinem neuen Buch, dass Dylan die Antwort bei Andy Warhol gefunden hat - und dass die Pop-Art sich ihre Relevanz wiederum da abholte, wo sie auch der junger Dylan gesucht und gefunden hatte: in der überlieferten Tradition der Volkskunst. Das sind steile Thesen, aber Crow ist ein brillanter Kunsthistoriker, der bis 2007 das Getty Research Institute leitete und nun an der New York University lehrt. Auf vierhundert Seiten analysiert Thomas Crow Kunst, Musik und Grafikdesign zwischen 1930 und 1995. Und siehe da: Die amerikanischen Flaggen von Jasper Johns aus den 1950ern, seine Zielscheiben und Ziffern, das alles hat es schon im 19. Jahrhundert gegeben, als Folk-Art, naive Volkskunst. Johns versteckte diese Herkunft nicht, weil es dafür auch keinen Grund gab. Es ist heute wenig bekannt, dass die Kunst des amerikanischen Hinterlands vor dem Zweiten Weltkrieg große Wertschätzung von Museen erfuhr, von denen man eigentlich ein elitäres Programm erwartet hätte. Selbst im MoMA waren sie zu sehen - bis man sie in den Vierzigern auslagerte und der Folk unter Kommunismusverdacht geriet; in den Fifties kam die Renaissance.
Zentral für Crows Buch ist dabei das Traditionals-Archiv eines jungen Mannes, der von der Hand in den Mund lebte, um seine psychedelischen abstrakten Kurzfilme zu realisieren: Harry Everett Smith (1927-1991) muss eine erstaunliche Figur gewesen sein. Ohne eine formelle Ausbildung absolviert zu haben, begann er zu malen, zu filmen und Musik und Tanz aufzuzeichnen, wofür er sich ein eigenes Notationssystem ausdachte. 1950 erhielt er ein Guggenheim-Stipendium und kam nach New York, 1952 brachte er seine "Anthology of American Folk Music" heraus. Darauf waren vierundachtzig Songs, die alle ursprünglich in den zwanziger Jahren aufgenommen worden waren. Dylan entdeckte diesen Schatz bei einem Freund, pickte sich das Beste heraus und - bis dahin undenkbar - schrieb Songs, die so weird und so enigmatisch waren wie die Traditionals, aber mit einer modernen Sensibilität.
So arbeitet Pop eben: Erst mal wird alles gesammelt und gesichert, man weiß ja nie, wozu man es noch braucht und was es einem einmal sagen kann. Alles muss mit dem gleichen Grad von Aufmerksamkeit betrachtet werden, auch die Nischen der Gesellschaft. Damit erschlossen sich Pop-Art und Popmusik verschüttete Quellen des alten Amerika. Wie Dylan damit die Grundlage für seine besten Platten gelegt hat, ist schon oft erzählt worden. Crow erweitert die Erzählung nun um Pop-Art und Andy Warhol. Die Parallelen sind frappierend: Warhol und Dylan pilgern in den späten Fünfzigern, ohne voneinander zu wissen, zum selben Gebäude, während sie die Grundlagen ihrer kommenden Werke legen: in die New York Public Library.
Mit großer Heimlichtuerei paust Warhol Fotos ab, die er in den riesigen Archiven der Bibliothek findet. Da er als Zeichner eine spezielle Technik entwickelt hat, bei der eine händische Linie noch feucht auf ein zweites Blatt kopiert wird und dabei vielfach unterbrochen wird, fällt das mechanische Prinzip seiner Illustrationen nicht unangenehm auf - er war in den Fünfzigern einer der erfolgreichsten Werbegrafiker der Stadt. Crow weist darauf hin, dass dieser Stil langsam von einer kühlen Serialität verdrängt wurde; und die Zeichnung von der Fotografie.
Dylan gräbt derweil im Bergwerk des alten, kruden Amerika Mitte des 19. Jahrhunderts: "Die irrsinnig komplizierte, moderne Welt interessierte mich wenig", schreibt er in seiner Autobiographie "Chronicles": "Für mich waren andere Themen fesselnd, aktuell und angesagt: der Untergang der ,Titanic', die Flut von Galveston, John Henry, der Schienenleger, der es mit bloßer Muskelkraft mit einem Dampfhammer aufnahm, oder John Hardy, der an der West Virginia Line einen Mann erschossen hatte." Dylan schreibt dann eigene Songs "über heruntergekommene Schmuggler, Mütter, die ihre eigenen Kinder ersäufen, Cadillacs, die auf hundert Kilometern fünfzig Liter schlucken, Überschwemmungen, Feuersbrünste im Gewerkschaftssaal, Dunkelheit und Kadaver am Grunde von Flüssen . . .".
Poptexte sind das nicht - noch nicht. Dylans Musik von 1965 an verändert die Vorstellung davon, was Popmusik sein kann. Es ist eine Innovation aus der Vergangenheit: Musik von den Farmarbeitern, Eisenbahnern und Seeleuten, Hillbillies, Hobos und anderen Mitgliedern der "Invisible Republic", wie Greil Marcus sie nannte. Kein Mensch weiß nun mit Sicherheit, was einzelne Zeilen auf "Blonde on Blonde" genau bedeuten. Auch die Frage, warum Warhol nun genau dieses oder jenes Motiv gewählt hat, ist immer nur unbefriedigend zu beantworten. In "The Long March of Pop" legt Crow dar, warum die disparaten Motive Warhols und die dylaneske Montage von disparaten Sprachbildern aus dem Geist des Archivs geboren wurden - und dass der Geist des Archivs ein allegorischer ist. Das muss man schon ein paarmal lesen, um es zu kapieren, auch weil Crow eine eigenwillige Vorstellung von Allegorie hat: "Der Protagonist und die Emanationen seiner Phantasie konfigurieren eine distanzierte, transformierte Projektion des Selbst."
Eben weil es in den Archiven der Bilder und der Geschichten so viele Motive gibt, tendiert der Popkünstler dazu, jede einzelne nur als eine mögliche Allegorie zu sehen, nicht als die Sache selbst. Es ist nicht mein Tod, sondern der "Death in America", es ist nicht mein Schicksal, sondern das eines Hobos irgendwo im historischen Niemandsland.
Wiederholung als Prinzip, Wiederholung aus Prinzip. Wer an den Selbstausdruck glaubt und an die Authentizität von Gefühlen, kann sie nicht einfach wiederholen - der Pop-Archäologe schon. Dylan hat "Like a Rolling Stone" genau 2011 Mal gespielt, zuletzt im November 2013. Nachzulesen ist das auf seiner Homepage, die zugleich ein Archiv ist - das Archiv eines einfach immer weitermachenden Künstlers.
Dylans Werk ist so dauerhaft, weil es nicht ichbezogen ist. So erinnert sich der heute 73-Jährige an die Aufnahmen eines Albums, bei dem der Produzent Songs von ihm wollte, "die mich als Menschen zeigten, aber in meine Studioarbeit fließt nur selten etwas Persönliches ein". Warhol meinte später, die Menschen hätten in den Sechzigern vergessen, was Emotionen sind - und sich nie mehr daran erinnert. Pop bedeutet das Ende der moralisierenden Eigentlichkeit der 1950er Jahre, die heute wieder zur Leitkultur geworden ist. Als Dylan zum ersten Mal "Like a Rolling Stone" auf dem Newport Folk Festival spielt, rastet das empfindsam-befindliche Publikum aus, aber Dylan geht nicht mehr zurück. Er ist jetzt cool.
Im selben Monat trifft er auf Warhol, die bleiche Maske. Sie sind sich zuvor in London begegnet, über Allen Ginsberg, aber als Dylan Warhol in seiner Factory besucht, wird es ein titanisches Kräftemessen. Jeder ist mit seinem Hofstaat zugegen und trägt Sonnenbrille. Warhol macht einen screen test von dem Musiker und schenkt ihm einen "Double Elvis" (den Dylan bald gegen ein Sofa tauscht). Dylan hatte sich im Juni bereits Warhol gewidmet - allerdings chiffriert, wie nun alles chiffriert ist. "Like a Rolling Stone" handelt von Warhols Muse Edie Sedgwick und zeichnet ein düsteres Bild des Künstlers als "mystery tramp" und "Napoleon in rags", der Sedgwick alles nimmt, "was er stehlen kann". Er macht elektrisch-enigmatische Musik und wird dafür attackiert. "Folkmusik ist die einzige Musik, die nicht simpel ist", entgegnet Dylan. "Sie war nie simpel. Sie ist schräg, Mann, voll von Legenden, Mythen, Biblischem und Geistern."
Die oft kritisierte Ambivalenz von Pop ist so alt wie die mittelalterlichen Quellen des Folk. Warhols schaurig-schöne Todesbilder und Dylans archaisch-moderne Musik basieren auf der menschlichen Erfahrung von der Ambivalenz des Lebens - und die ist kein Fluch der Moderne, sondern uralt.
"Wenn man die Wahrheit sagte", so Dylan, "war das schön und gut, und wenn man die Unwahrheit sagte, war das immer noch schön und gut. Das hatte ich aus Folksongs gelernt . . . Alles, woran man glaubte, konnte ebenso gut grundfalsch sein." Und das ist, fünfzig Jahre später, immer noch eine genaue Beschreibung der Gegenwart.
BORIS POFALLA
Thomas Crow, "The Long March of Pop". Yale University Press, 412 Seiten, 35 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main