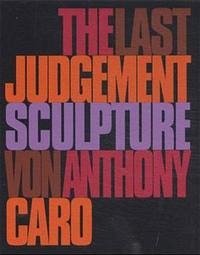Produktdetails
- Verlag: Swiridoff
- Seitenzahl: 208
- Erscheinungstermin: März 2001
- Deutsch
- Abmessung: 305mm
- Gewicht: 1418g
- ISBN-13: 9783934350366
- ISBN-10: 3934350364
- Artikelnr.: 25079095

Der britische Biologe und Essayist John Burdon Sanderson Haldane: Stammvater aller Molekularingenieure und Gesellschaftsplaner / Von Thomas Weber
Am Beginn des Jahres 1923 erhielt der junge Biochemiker John Burdon Sanderson Haldane eine Einladung, vor einem Cambridger Studentenklub einen Vortrag über die Zukunft der Naturwissenschaft zu halten. Charles Kay Ogden, ein exzentrischer Philosoph und Linguist, überzeugte Haldane im Anschluß, seinen mit "Daedalus, or Science and the Future" betitelten Vortrag in Buchform zu veröffentlichen. Und trotz eines unverschämt hohen Preises wurde das schmale Bändchen zu einem sofortigen Verkaufsschlager. Denn J. B. S. Haldane wagte, auch über die Zukunft der menschlichen Fortpflanzung zu räsonieren. Im letzten Teil seines Vortrages leiht er einem mäßig begabten Studenten seine Stimme, der in einhundertfünfzig Jahren in Form einer Hausarbeit einen Rückblick auf die Entwicklung der Biologie gibt. Der Verfasser berichtet unter anderem, daß 1951 das erste ektogenetische Kind produziert wurde und daß in Frankreich 1968 mehr als 60 000 Kinder außerhalb des Mutterleibes aufgezogen wurden. In der Gegenwart des Verfassers würden gewiß überhaupt nur noch dreißig Prozent aller Kinder auf natürliche Weise geboren.
Diese wissenschaftliche Phantasie verhalf Haldane zu einer schnellen Bekanntheit. Bertrand Russell zeigte sich schockiert - nicht von der Sexualität der Zukunft, sondern von Haldanes Vertrauen in die Weisheit und Fähigkeit der Wissenschaftler, solche Entwicklungen weise zu kontrollieren - und schrieb als Entgegnung eine Besprechung mit dem nur wenig überraschenden Titel "Icarus, or the Future of Science". Aldous Huxley, Haldanes Freund aus den gemeinsamen Studienjahren in Oxford, machte die Ektogenese, die industrielle und gesteuerte Produktion von Nachwuchs, zum zentralen Element seiner "Brave New World". Bis zu diesem Zeitpunkt in den frühen zwanziger Jahren hatte Haldane sich damit zufriedengegeben, in den verhältnismäßig engen Grenzen der akademischen Welt zu agieren. Die Erfahrungen mit seinem "Daedalus" ließen ihn offensichtlich seine Einstellung ändern. Bis zu seinem Tode, Haldane lebte von 1892 bis 1964, war er fortan ein unermüdlicher Verfasser von streitbaren und unterhaltsamen Essays über Wissenschaft, Politik und Religion.
J. B. S. Haldane ist ohne Zweifel einer der einflußreichsten, außerhalb von Fachkreisen jedoch nur noch wenig bekannten Biologen des zwanzigsten Jahrhunderts. Er verfaßte grundlegende und bleibende Beiträge in der Enzym-Biochemie, der biochemischen Genetik, der mathematischen Evolutionsgenetik und stellte eine der wichtigsten Hypothesen zum Ursprung des Lebens auf. Zusammen mit Ronald A. Fisher und Sewall Wright gilt Haldane als einer der Architekten der sogenannten evolutionären Synthese, welche endgültig die Mendelsche Genetik mit Darwins Evolutionslehre vereinbaren konnte. Mit seinem Namen ist zwar keine umfassende Theorie oder eine bahnbrechende Entdeckung verbunden, eine Tatsache, die mit Sicherheit seiner langfristigen Bekanntheit geschadet hat, aber seine Breitenwirkung in der Biologie war dennoch einzigartig. So war John Maynard Smith, der große alte Mann der britischen Evolutionsbiologie, zehn Jahre lang ein Student und Mitarbeiter Haldanes am University College in London. Und über seine Schüler der ersten und zweiten Generation übt Haldane noch immer Einfluß auf die britische Evolutionsbiologie aus.
Doch in dieser Rolle als kreativer, professioneller akademischer Wissenschaftler und Lehrer erschöpft sich seine Bedeutung nicht. Wie sein "Daedalus" bezeugt, hatte Haldane kühne Visionen über die zukünftige Bedeutung der Biologie. Diese Visionen gingen weit über das hinaus, was die meisten seiner Kollegen sich in ihren mutigsten Momenten vorzustellen wagten. Der Eton-Schüler und Oxford-Absolvent blieb aber nicht nur ein Papiertiger. Er entwickelte sich nach dem Ersten Weltkrieg zunächst zu einem aktiven Sozialisten, dann zu einem lupenreinen Kommunisten, der seine visionäre Wissenschaft und eine revolutionäre Politik in der Praxis zu vereinigen suchte.
Selbst auf die Gefahr hin, anachronistisch zu sein, lohnt es sich, im Lichte moderner Entwicklungen in der Biomedizin auf Haldanes Wirken und Ideen zurückzublicken. Denn nicht zum erstenmal verbindet sich heute mit der Biologie ein unbändiger, großartige Umwälzungen versprechender Optimismus, der nicht jeden zu überzeugen vermag. Es ist fast schon zu einem Allgemeinplatz geworden, daß erst im vergangenen Jahrzehnt die Biologie mit ihrer molekularen Revolution die Physik als Leitwissenschaft abgelöst habe. Die Physik konnte aber nie unangefochten herrschen. Schon in den ersten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts, als die Grundlagen der Relativitätstheorie und der Quantenphysik gelegt wurden, galt vielen die Biologie als diejenige Wissenschaft, welche die Zukunft des Menschen entscheidend gestalten würde. Eine neue Generation von Biologen hatte sich endlich von einer pessimistischen Sicht des biologischen Schicksals des Menschen gelöst, die einige Jahrzehnte zuvor für den Aufstieg der Eugenik mitverantwortlich war. Wer sich um die Zukunft des Menschen sorgte, war damals nämlich vom Darwinismus vor ein Dilemma gestellt worden: Die Errungenschaften des Menschen sollten eine Folge des universellen Kampfes ums Dasein darstellen. Aber ebendiese zivilisatorischen Leistungen unterminierten, jener Theorie zufolge, zugleich die Gestaltungskraft der natürlichen Auslese. Denn den biologisch "ungeeigneten" Mitgliedern der Gesellschaft wurde ermöglicht, sich grenzenlos fortzupflanzen, und die Eliten begnügten sich meist mit wenigen Kindern.
Die eherne Gesetzlichkeit der Evolution schien auf diese Weise die Menschheit zur fortschreitenden Degeneration verdammt zu haben. Diese mißlichen Folgen ließen sich anscheinend nur verhindern, indem die Menschheit als Ressource für ein großes eugenisches Züchtungsexperiment betrachtet wurde. Das späte neunzehnte Jahrhundert erlebte aber den Aufstieg der experimentellen Biologie. Naturgeschichte, Anatomie, Embryologie, die Evolutionslehre und auch die frühe Eugenik waren aus dem Blickwinkel der wissenschaftlichen Erneuerer im Grunde nur historische und beschreibende Disziplinen, die keine Kausalerklärungen von Lebenserscheinungen bieten konnten.
Die Physiologie und die aufstrebende Genetik revoltierten gegen diese Betrachtungsweise und boten eine Alternative: präzise Messungen organischer Erscheinungen, experimentelle Kontrolle und der Versuch der Vorhersage und Manipulation. Haldane gab in seinem "Daedalus" einem von diesen neuen Idealen getragenen neuen Optimismus Ausdruck, welcher die alte Schicksalsergebenheit hinter sich gelassen hatte. Die Menschheit hatte endlich die Mittel, ihr evolutionäres Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Die Gesetze der Evolution waren nicht ehern, sondern vom Menschen manipulierbar und für seine Zwecke nutzbar. Haldanes stürmisches politisches Leben und auch sein unterschätzter, aber dauerhafter Einfluß auf die Science-fiction-Literatur sind in dieser Hinsicht besonders aufschlußreich.
Haldane war bis zu seinem erstklassigen Studienabschluß in Mathematik und den klassischen Sprachen im Jahr 1914 oberflächlich gesehen ein typisches Kind der britischen Oberklasse; konservativ bis gemäßigt liberal, finanziell unabhängig und eine sorgenfreie Zukunft vor sich. Aber dieser Schein trügt. Denn sein Vater John Scott, einer der bedeutendsten Physiologen Großbritanniens, und sein Onkel Richard Burdon Haldane, ein einflußreicher Labour-Politiker, vermochten schon den jungen Haldane auf eine recht liberale Linie zu bringen. Im Ersten Weltkrieg, an dem Haldane als Mitglied eines schottischen Elite-Regimentes teilnahm, lernte er viele Mitglieder der Arbeiterklasse kennen und respektieren. In der Nachkriegszeit triftete Haldane immer weiter nach links, da er den traditionellen britischen Liberalismus für korrumpiert und inkompetent hielt. Haldane beschrieb sich als einen "wissenschaftlichen" Sozialisten, ohne aber zunächst zu bestimmen, was dieses Etikett nun genau bedeutet.
In den zwanziger Jahren ging Haldane vor allem in seiner wissenschaftlichen Arbeit auf, doch in den dreißiger Jahren wurde er wie seine Kollegen Joseph Needham und J. Desmond Bernal politisch sehr aktiv. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland und der spanische Bürgerkrieg überzeugten Haldane, nur der Kommunismus könne Rettung bringen, aber erst 1942, nachdem er Marx, Lenin und den dialektischen Materialismus gründlich studiert hatte, wurde er Mitglied der Kommunistischen Partei. In einem schmerzhaften Jahrzehnt hatte er sich endgültig von seinen aristokratischen Wurzeln gelöst. Doch der endgültige Triumph des Antievolutionisten Lysenko als offiziellem Lieferanten erbbiologischer Doktrinen für den Kreml im Jahr 1948 setzte Haldane unter Druck, sich vom sowjetischen Gesellschafts- und Wissenschaftsmodell zu distanzieren. 1956 hatte sich Haldane dann sowohl von der britischen Gesellschaft als auch vom Kommunismus so weit entfremdet, daß ihm nur noch eine Übersiedlung nach Indien einen würdevollen Abgang versprach.
Wie der Wissenschaftshistoriker Mark B. Adams bemerkt, läßt sich in Haldanes Wirken keine strenge Trennung vornehmen zwischen seiner wissenschaftlichen und politischen Tätigkeit und seiner Rolle als Autor. In seinen Essays entwickelte er neue Vermutungen - seine bahnbrechenden Ideen zur Entstehung des Lebens erschienen im "Rationalist Annual", nicht in einer wissenschaftlichen Zeitschrift - und spekulierte, wie sie zur rationalen Kontrolle der menschlichen Evolution eingesetzt werden könnten. Haldanes Essays waren Versuche, wissenschaftliches und politisches Denken fruchtbar zu verbinden.
In seinem "Daedalus" blickt Haldane nur bescheidene einhundertfünfzig Jahre in die Zukunft der Menschheit, in dem Essay "The Last Judgement" sind es vierzig Millionen Jahre. Dort wird seine wissenschaftliche und politische Vision noch deutlicher. Im Zentrum des Essays steht ein Bericht von den Bewohnern der Venus, der über den Untergang der Erde aufklärt und schildert, wie es gelang, einen neuen Planeten zu besiedeln. Haldane zeichnet das Bild einer Menschheit, die zunächst die biologische und technische Entwicklung zu kontrollieren vermochte: Die Lebensspanne beträgt dreitausend Jahre, Schmerzen und Krankheiten existieren nicht mehr, das Klima und die Landschaft werden menschlichen Bedürfnissen angepaßt. Der enorme Energiehunger der Menschheit läßt aber eine Katastrophe heraufziehen. Um diesen Hunger zu stillen, nutzen die Menschen die Kraft der Gezeiten. Dadurch aber wird nach und nach die Erdrotation verlangsamt, und der Mond wird zu einer Bedrohung, da er sich langsam nähert. Im Gegensatz zur Mehrheit, die im irdischen Paradies die Fähigkeit verloren hat, diese Bedrohung ernst zu nehmen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen, entscheidet sich eine kleine Minderheit, den irdischen Vergnügungen und ihrer Selbstbestimmung zu entsagen und die Art zu retten.
Diese Gruppe nun unterwirft sich einer kontrollierten Evolution, die sie nach Zehntausenden von Jahren zur Besiedelung der Venus befähigt. Nach dem Untergang der Erde tragen diese mutigen Pioniere das Erbe der Menschheit weiter. In der Science-fiction-Literatur der vierziger und fünfziger Jahre lassen sich viele Themen finden, die Haldane in diesem futuristischen Essay ansprach. Robert Heinlein nahm von Aldous Huxley die Idee der Ektogenese auf, Haldanes Vision einer enorm langen zukünftigen Geschichte der Menschheit schlug sich bei Isaac Asimov nieder und ist aus diesem Genre nicht mehr wegzudenken. Haldanes Idee, andere Planeten für Menschen bewohnbar zu machen, ist 1942 bei Jack Williamson unter dem Etikett "terraforming" wiederzufinden.
Nicht nur H. G. Wells, sondern vor allem Haldane ist somit einer der bedeutenden Gründungsväter der modernen Science-fiction-Literatur. Wells war durch und durch "unmodern", ganz der pessimistischen Sicht der frühen Darwinianer verpflichtet. Die Gesetze der Biologie und der Physik schienen ihm dem menschlichen Einfluß entzogen und konnten das Schicksal der Menschheit nur besiegeln. Im "Krieg der Welten" wird die Erde nur durch einen Zufall, ein sich gegen die Eindringlinge vom Mars wendendes Bakterium, vor der Eroberung bewahrt. In Haldanes Visionen waren Naturkräfte hingegen beherrschbar und versprachen der Menschheit in solchen Notlagen Rettung. Aber um diese säkulare Erlösung durch die Naturwissenschaft zu ermöglichen, mußten Individuen Opfer bringen und ihre Wünsche dem größeren Ziel unterordnen. Und dies war nur im Sozialismus möglich.
Die Aufbruchstimmung, welche die Biomedizin in den vergangenen Monaten erfaßt hat, ist, so gesehen, nichts Neues. Nicht erst mit der molekularen Revolution der sechziger und siebziger Jahre und mit der Sequenzierung des menschlichen Genoms wurde das Leben als tiefgreifend manipulierbar und formbar erfahren. Schon im frühen zwanzigsten Jahrhundert hatten sich die Lebenswissenschaften endgültig von den Praktiken der beschreibenden Naturgeschichte verabschiedet. Die Biologie wurde erstmals zur Anregerin ernst zu nehmender technokratischer Phantasien.
Für Haldane war es dabei die politische Vernunft, die langfristig meist religiös motivierte Widerstände gegen wissenschaftliche Neuerungen überwinden würde, für die zeitgenössischen Vertreter der Biomedizin ist es hingegen der Markt. Haldane und seine sozialistischen Mitstreiter versuchten die normative Struktur der gesamten Gesellschaft festzulegen. Diese Normen sollten den Werten einer idealisierten "scientific community" entsprechen, in der für "irrationale" Interessenkonflikte und Kompromisse kein Platz zu finden ist. Politik sollte nichts anderes sein als Wissenschaft mit anderen Mitteln, durchgeführt von Experten. Heute bevölkert ein idealisierter, freier Konsument von Dienstleistungen und Waren die Vorstellungswelt biomedizinischer Wissenschaftler und Unternehmer. Inhalte der Forschung sind eine wissenschaftsinterne Angelegenheit, und welche Anwendungen sich ergeben, ist eine Folge individueller und gesellschaftlicher Bedürfnisse. Beide Idealisierungen bezwecken, der Wissenschaft unter verschiedenen politischen Bedingungen eine maximale Handlungsfreiheit zu garantieren.
Der Gestalt und Geschichte des Dädalus der griechischen Mythologie entnahm Haldane keine Warnungen vor dem Hochmut der Wissenschaftler und der Gefahr eines Mißbrauchs dieser Handlungsfreiheit. Ganz im Gegenteil, Haldane bewunderte Dädalus für seinen Mangel an Respekt vor den Göttern. Dieser erste Bioingenieur besetzte eine eigenartige Rolle in der griechischen Mythologie. Seine Taten wurden von den Göttern geduldet, auch wenn sie zum Tode von Minos, einem Sohn des Zeus führten. Dädalus bewegte sich aber auch außerhalb jeglicher menschlicher Moralvorstellungen, indem er bei seiner Arbeit sich nur um die Raffinierung der Mittel und nicht um die Zwecke scherte. Für Haldanes entschiedenen Willen, die Gesellschaft wissenschaftlich zu beglücken, war Dädalus ein Beweis dafür, "daß der wissenschaftliche Arbeiter sich nicht um die Götter sorgt". Haldanes politische Ziele waren möglicherweise nicht völlig vereinbar mit den Motiven und Handlungen dieses antiken Vorbildes. Denn Haldane hatte eine hehres Ziel: Er wollte eine gerechtere Gesellschaft schaffen, vertraute dabei aber zu sehr einer engen wissenschaftlichen Rationalität und einem autoritären Expertentum. Ein moderner Dädalus würde sich wohl in einer individualisierten, marktwirtschaftlichen Gesellschaft wohler fühlen als in Haldanes sozialistischem Paradies.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main