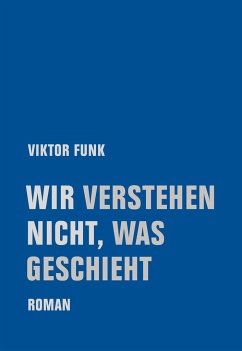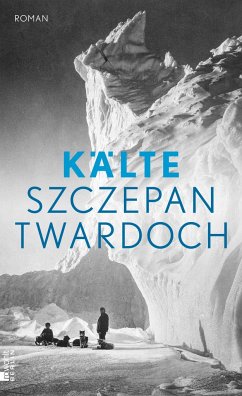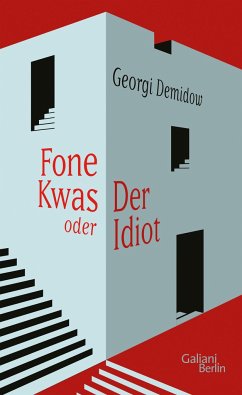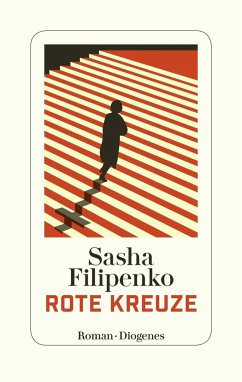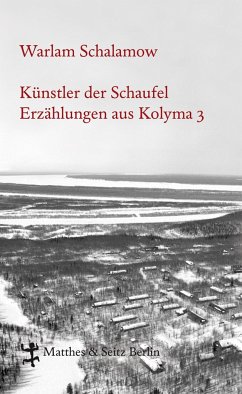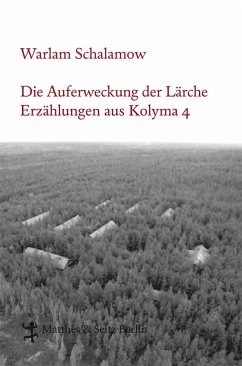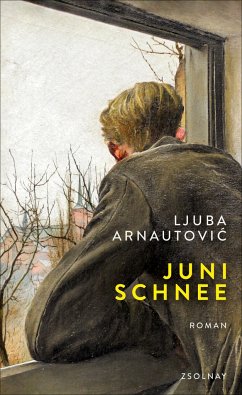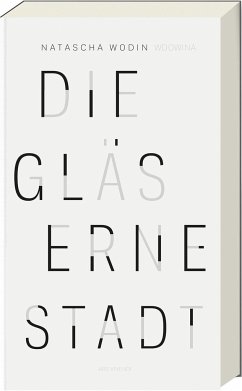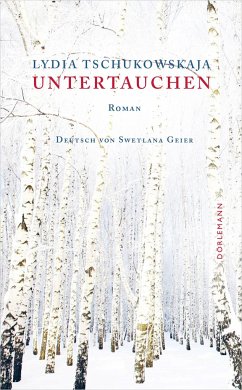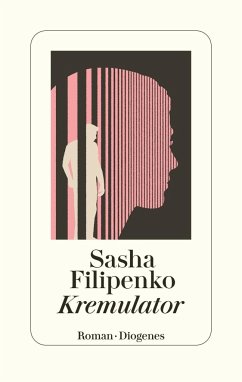noch im Krieg nach Deutschland und später nach Amerika. Seine weitgehend autobiographischen Texte über das Lagerleben in der Republik Komi im Nordural schrieb er im Ausland für ein Emigrantenpublikum. Er hatte Propagandaspruchbänder gemalt, zu fliehen versucht, war fast verhungert - und sich gleichwohl einen lyrischen Sinn für menschliche und Naturschönheiten bewahrt, der vorrevolutionär anmutet und in seiner Verklammerung von Zartheit mit Tragik an Iwan Bunin denken lässt.
An den großen Emigranten und ersten russischen Literaturnobelpreisträger erinnern zumal Maximows Frauengestalten, die ein kurzes Liebesglück mit dem Leben bezahlen. Emphatisch vergegenwärtigt er ihren Reiz, vergleicht etwa den schöngeschnittenen Mund der schwarzäugigen Diebin Galja mit Aphrodite. Galja wurde im Lager, dessen Insassen die Bahnlinie nach Workuta bauten, die Freundin eines strafgefangenen Ingenieurs, begann, rührend für ihn zu sorgen, aber auch zu lesen und sich zu bilden. Doch damit verstieß sie gegen den Kriminellenkodex, der ausschließlich utilitäre Beziehungen zu politischen Häftlingen erlaubte, und wurde einem Prügelritual unterzogen, das sie nicht überstand. Wie sehr der Drang nach Freiheit und der nach Liebe zusammengehören, veranschaulicht eingangs die Geschichte von der jungen Frau, die von Geologen zufällig im Schneetreiben gefunden und gerettet wird. Warum sie mit einem von ihnen die Nacht verbringt, zeigt sich am andern Morgen, als Gefängniswärter mit Hunden anrücken, denen sich die aus einem Lager Geflüchtete durch Selbstmord entzieht.
Maximow war wegen eines unvorsichtigen Witzes 1936 denunziert und verhaftet worden. In der Erzählung "Odyssee eines Arrestanten" schildert er die Verhöre und Folter im Moskauer Lubjanka-Keller, dem Hauptquartier des Inlandsgeheimdienstes NKWD, die penible Leibesvisitation durch einen sadistischen Subalternen vom verbreiteten Typ "Popka" (zu Deutsch: "kleiner Arsch"), der ihm Gürtel und Schnürsenkel abnahm, weil der Häftling nicht durch Freitod der Justiz entkommen durfte, aber auch von dem Kommilitonen, der folgsam als Belastungszeuge auftrat, um nicht selbst in der Lubjanka zu landen.
Maximows eigener Fluchtversuch aus dem Lager, bei dem einer aus seiner Fünfergruppe gleich beim Ausbruch erschossen wird, liest sich wie ein Filmdrehbuch. Auf den euphorischen Moment, in dem er sich frei fühlt wie ein Waldvogel und der kriminelle Kamerad schon von neuen Raubzügen träumt, folgt die Panik vor den Häschern des Lagers, mit denen die syrjänischen Ureinwohner kollaborieren und die die Flüchtigen bald einfangen, wobei sie noch einen von ihnen töten. Dem Straflager entkommt allein ein charmanter Hochstapler. Die Figur des gewinnenden Afrikan Adolfowitsch Zetkin, der schon als Neffe von Clara Zetkin, als Sohn von Maxim Gorki, Stiefbruder von Ernst Thälmann und Ururenkel von Michail Lermontow Geld "verdiente", könnte einem Roman der sowjetischen Satiriker Ilja Ilf und Jewgeni Petrow entsprungen sein. Piekfein kostümiert und einen freien Vortragsexperten mimend, lässt er sich bis zum nächsten Fährhafen chauffieren.
Trotz seines tragischen Stoffes und der enggetakteten Sterbeszenen besticht das Buch auch durch Maximows Blick für die schaurig-komischen Seiten der menschlichen Natur. So wird das sich stetig füllende Leichenhaus von lebenslustigen Kriminellen als Schutzraum fürs nächtliche Stelldichein genutzt. Der Autor schildert die Gewalttätigkeit dieser Häftlingskategorie, die bei der Essensausgabe folglich besser wegkommt als die Politischen, aber auch ihre kindlichen Gemüter. Der Chronist erringt besondere Ehren und Essensrationen von den Gaunern als "Märchenerzähler", der sie mit Abenteuergeschichten in eine phantastische Gegenwelt zu entführen vermag. Die Aufseher mögen die amüsanten Ganoven entschieden lieber als die für politische Vergehen verurteilten "Langweiler". Als aber ein Sträflingstheater gegründet wird, verstößt der luxusaffine NKWD-Hauptmann gegen den Moskauer Erlass, dafür nur Kriminelle zu engagieren, weil er, wie er sagt, Gesichter auf der Bühne sehen wolle, keine Visagen.
Weil er der Lagerleitung vorlügt, er sei Schauspieler, kommt Maximow in die Truppe verurteilter Bühnenkünstler unter der Leitung des Regisseurs Alexander Gawronski (1888 bis 1958), die sich für kurze Zeit einmal ihrer Profession widmen und in Ermangelung anderer Texte das beziehungsreiche Stück "Die Sintflut" des Schweden Henning Berger aufführen konnte, dessen Helden im Angesicht des Todes menschliche Größe gewinnen, sie nach überstandener Gefahr aber sogleich wieder verlieren. Als bildender Künstler verdingt er sich in einem Frauenlager, deren dicke Kommandantin ihn fürs eigene Porträt üppig verpflegt, die hungrigen Insassinnen aber nur mit Propagandatafeln zur Arbeit motivieren lässt. Zugleich verzeichnet er immer wieder unerwartete Anwandlungen von Barmherzigkeit und Humanität, so ausgerechnet bei dem jungen NKWD-Ermittler, der seinen Fluchtversuch milde ahndet und anordnet, die Wiedereingefangenen besser zu füttern.
Die Schicksale finden Echo und Widerschein in der ebenso rauhen wie beseelten sibirischen Waldlandschaft, wo bleiche Birken wie Trauerkerzen aufragen, Sturmgeheul die Toten aussegnet und Schilfhalme miteinander flüstern. Eine biographische Skizze und ein instruktives Glossar vervollständigen die Publikation, deren Verdienste einige Flüchtigkeitsfehler nicht mindern.
KERSTIN HOLM.
Sergej Maximow: "Taiga". Erzählungen aus dem Gulag.
Mitteldeutscher Verlag, Halle 2020. 302 S., br., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
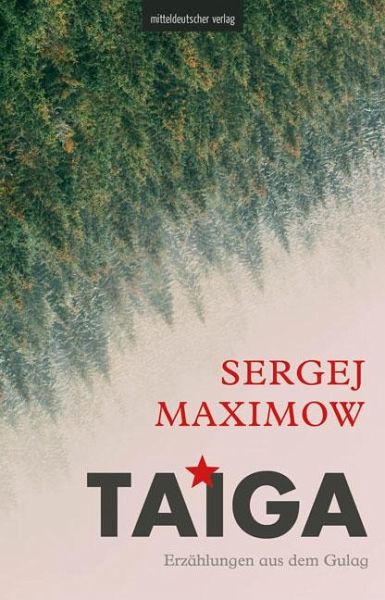





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.10.2020
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.10.2020