Schriftsteller mit Wohnsitz in Australien. Vieles bekümmert J. C. angesichts der globalisierten Gegenwartsgesellschaft: die australische Asylpolitik, der Irak-Krieg, die Grausamkeit heutiger Massentierhaltung, die westliche Hysterie angesichts des islamistischen Terrorismus. Und vor allem: die "Schande" des amerikanischen Folterlagers Guantánamo Bay. Da kommt es dem alten Schriftsteller gerade recht, dass ausgerechnet ein deutscher Verlag einen Sammelband mit seinen Essays veröffentlichen möchte - zur Frage, "woran die Welt krankt". Also schreibt sich Coetzees sechs Jahre älteres FastAlter-Ego die Wut über die "antihumane Wendung" zu einem neuen Hobbes'schen Naturzustand von der Seele.
Den düsteren Diagnosen von J. C., die unter dem Titel "Feste Ansichten" auf den Zeitraum zwischen dem 12. September 2005 und dem 31. Mai 2006 datiert sind, stellt Coetzee zwei weitere, das Lamento brechende Erzählperspektiven entgegen. Zufällig nämlich begegnet J. C. gleich zu Anfang des Romans einer jungen, auffallend hübschen Nachbarin in der hauseigenen Waschküche. Vor allem der "himmlische Hintern" der knapp dreißigjährigen Anya hat es ihm angetan. Der alte Mann ist auf einen Schlag erotisiert und engagiert die Filipina, die mit ihrem Freund ein paar Stockwerke höher wohnt, zum Dreifachen des üblichen Honorars als Schreibkraft. Das erfährt der Leser nicht auf der offiziellen Erzählebene der Essays, sondern - darunter abgedruckt - in einem inneren Monolog des Schriftstellers.
Hinzu kommt, am unteren Ende der Seite, eine dritte Erzählebene: Anyas private Sicht auf "Señor C", wie die Sekretärin ihren neuen Chef bald heimlich nennt. Eine Geschichte, drei Stimmen, der Text als "Split Screen": Das ist eine simple Idee mit allerdings großem Effekt, denn so treffen die politischen Thesen von J. C. sofort auf Gegenargumente durch Anya und ihren Freund Alan, einen Investmentbanker. Darüber hinaus geben die zwei zusätzlichen Perspektiven Coetzee Gelegenheit, wie schon in seinen Vorgängerromanen "Elisabeth Costello" und "Zeitlupe" ("Slow Man") den Produktionsprozess des Schreibens selbst zum Thema zu machen und den Mythos, wonach ein Autor angeblich allein am Text schreibt, einmal mehr genussvoll zu demontieren.
Anya nämlich missbilligt, angestachelt von Alan, den besserwisserischen Klageton der Aufsätze, die sie abtippen muss. Freimütig rät sie ihrem Chef: "Schreiben Sie doch über Kricket. Schreiben Sie Ihre Memoiren. Über was Sie wollen, nur nicht über Politik. Ihre Art zu schreiben und Politik - das passt nicht zusammen." Und auch wenn J. C. keine Miene bei diesen Vorschlägen verzieht, zeigt er sich doch höchst beeinflussbar durch seine Sekretärin. Zumindest folgen auf seine "Festen Ansichten" prompt mildere, melancholischere und persönlichere Aufzeichnungen in einem zweiten Tagebuch, die assoziativ von Kricket, Liebe im Alter, Träumen, Musik, Literatur und schließlich vom Sterben handeln.
Was als harmlose Altherrenphantasie beginnt, avanciert zum Wettstreit der Lebensphilosophien. Dass die Zuneigung zu einer jüngeren Frau zum Auslöser einer Identitätskrise wird, kennt man auch schon aus Coetzees berühmtestem Roman "Schande" ("Disgrace"). Im "Tagebuch eines schlimmen Jahres" steigert sich die persönliche Krise nun zum geradezu faustischen Zweikampf um Anyas Seele, weil hier mit Alan ein Gegenspieler auftritt, der als rein ökonomisch denkender Geschäftsmann die Unmoral in Reinkultur vertritt.
Alan, aufgewachsen in einem Waisenhaus, glaubt weder an eine Verantwortung noch an eine Autonomie des Subjekts, sondern begreift das Weltgeschehen lediglich als Markt von Angebot und Nachfrage. "Was Señor C nicht sehen kann oder will", erklärt er Anya einmal, "ist, dass Individuen Spieler in einer Struktur sind, die über individuelle Motive hinausgeht, die über Gut und Böse hinausgeht." Der soziale Gerechtigkeit fordernde J.C. ist für den zweiundvierzigjährigen Anlageberater folglich nur ein "Fossil aus den Sechzigern", auf das er umso hasserfüllter reagiert, je bereitwilliger sich seine Freundin um den immer gebrechlicher werdenden Autor kümmert. Alan verhöhnt J. C. als "Guru" und zapft seinen Computer an. Bei einem Abendessen zu dritt kommt es schließlich zum Eklat.
In der Holzschnittartigkeit der Figur Alans, das skrupellose Wettbewerbsprinzip verkörpernd, liegt allerdings das Problem des ansonsten sehr kunstvoll gebauten Romans. Die wahren Barbaren, daran lässt Coetzee in seinem neuen Buch keinen Zweifel, lauern weniger außerhalb als innerhalb des Systems. Es sind Aufsteiger wie Alan, für die "Geld das Maß aller Dinge" ist. Zugegeben, keine ganz neue Botschaft, aber eine, die in ihrer zornigen Trauer über die gern totgeschwiegenen politischen Sündenfälle der westlichen Zivilgesellschaft manchem Leser aus dem Herzen sprechen dürfte.
GISA FUNCK.
J.M. Coetzee: "Tagebuch eines schlimmen Jahres". Aus dem Englischen übersetzt von Reinhild Böhnke. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2008. 235 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
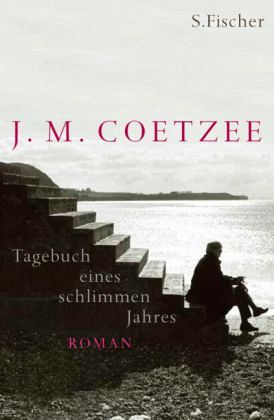



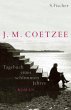


 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.07.2008
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.07.2008