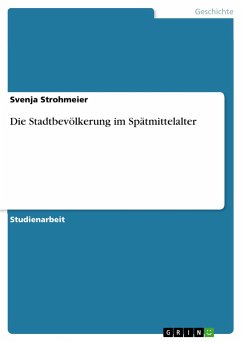Produktdetails
- Forschungen zur Regionalgeschichte 25
- Verlag: Brill Schöningh / Verlag Ferdinand Schöningh
- Artikelnr. des Verlages: 1918684
- 1998.
- Seitenzahl: 400
- Erscheinungstermin: Januar 1998
- Deutsch
- Abmessung: 239mm x 169mm x 33mm
- Gewicht: 750g
- ISBN-13: 9783506795977
- ISBN-10: 350679597X
- Artikelnr.: 25953186

Und die sicherheitspolitische Bedeutung der Garnison in der Stadt: Ein Sammelband zur kommunalen Geschichte
Bernhard Sicken (Herausgeber): Stadt und Militär 1815-1914. Wirtschaftliche Impulse, infrastrukturelle Beziehungen, sicherheitspolitische Aspekte. Forschungen zur Regionalgeschichte, Band 25. Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 1998. 403 Seiten, 75,- Mark.
"Sind Sie der Bürgermeister von Köpenick? . . . Auf Allerhöchsten Befehl Seiner Majestät des Kaisers und Königs erkläre ich Sie für verhaftet: Ich habe Auftrag, Sie sofort auf die Neue Wache nach Berlin zu bringen". - Dieser Satz des Hochstaplers Voigt aus Carl Zuckmayers berühmter Komödie "Der Hauptmann von Köpenick" soll nicht nur die Dominanz der militärischen Macht im Bereich der zivilen Verwaltung demonstrieren, sondern auch darauf hinweisen, daß ein Offizier im Kaiserreich über Polizeigewalt verfügte, die ihn ermächtigte, jederzeit in die Innenpolitik des Staates einzugreifen. Der Historiker Gernot Wittling hat am Beispiel der Berliner Garnison die nach innen gerichtete Funktion der Armee in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts detailliert untersucht und damit einen wesentlichen Aspekt der Sicherheitspolitik in Preußen zwischen der Revolution von 1848 und der Reichsgründung dargestellt.
Sein Beitrag findet sich in dem materialreichen und informativen Sammelband "Stadt und Militär", in dem der Münsteraner Professor Bernhard Sicken als Herausgeber zusammen mit zahlreichen Autoren die komplexen Beziehungen zwischen ziviler Bevölkerung und militärischer Macht im städtischen Umfeld vom Wiener Kongreß 1815 bis zum Ersten Weltkrieg eingehend untersucht. In diesem Zeitraum, in dem sich in Deutschland - vor allem in der zweiten Jahrhunderthälfte - durch beschleunigte Industrialisierung und Modernisierung der Gesellschaft ein Strukturwandel vollzog, veränderten sich auch die Beziehungen zwischen einer sich ausdifferenzierenden städtischen Gesellschaft und den an traditionellen Leitbildern orientierten Militärs. Im Gegensatz zu den vielen militärgeschichtlichen Studien, die Probleme der Streitkräfte in der Ausnahmesituation des Krieges erörtern, ist es die erklärte Absicht der Autoren, die "Normalität von Kooperation, Koexistenz und Distanz zweier komplexer Sozialsysteme im Frieden" zu beschreiben und zu analysieren. Ihre Aufsätze sind daher als Beiträge zur Sozialgeschichte zu verstehen, die das Militär im Kontext von Stadtentwicklung, Infrastrukturmaßnahmen, kommunaler Fiskalpolitik und als Garant von Ruhe und Ordnung betrachten.
Um den Gesamtzusammenhang zu wahren, war es nötig, im ersten Teil des Bandes wesentliche Etappen des Urbanisierungsprozesses im 19. Jahrhundert zu skizzieren. Damit wird verdeutlicht, welche Probleme sich für die Verwaltung aus dem rapiden Wachstum der Städte und den entstandenen Industrieanlagen, in bezug auf das Verkehrs- und Transportwesen, den Energiebereich und die Versorgung ergaben, von denen auch alle Garnisonen betroffen waren. Im Bau repräsentativer Rathäuser drückte sich das gewachsene Selbstbewußtsein der städtischen Eliten aus, die soziale Veränderungen anders wahrnahmen als die an einer ständischen Gesellschaft orientierten Militärs. Die Mehrheit der Stadtbürger war allerdings von den politischen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen. Friedrich Lenger hat in einem großangelegten Vergleich die Rolle des städtischen Bürgertums in den preußischen Westprovinzen mit der in Bayern verglichen und darauf hingewiesen, daß meist nur knapp sechs Prozent der Einwohner wahlberechtigt waren; auf kommunaler Ebene existierte eine strikte Klassengesellschaft. Anhand einer sehr detaillierten Analyse der Kommunalfinanzen ausgewählter Städte des Kaiserreichs bis zum Weltkrieg gelingt Richard Tilly der Nachweis, daß eine Garnison die Investitionsbereitschaft der Städte nicht wesentlich stimuliert hat.
Nach vier grundlegenden Aufsätzen, die sich mit dem Urbanisierungsprozeß im Zeitalter der Industrialisierung und den damit verbundenen Problemen befassen, folgen acht Beiträge, die anhand kommunaler Fallbeispiele wichtige Aspekte der vielschichtigen Beziehungen zwischen Stadt und Militär untersuchen und dadurch zu differenzierten Aussagen gelangen, wie man sie zum Beispiel in Wehlers großer sozialgeschichtlicher Gesamtdarstellung der Epoche zuweilen vermißt. Dessen pauschale Aussage, daß die Garnison "eine Quelle materiellen Wohlstands für die Stadt" sei, läßt sich anhand der Aktenlage nicht aufrechterhalten. Für viele Kommunen erwies sich das Militär - wie der Herausgeber nachdrücklich betont - als eine "drückende Bürde".
Sicken beschreibt in einem historischen Längsschnitt die militärisch-zivilen Beziehungen während des gesamten Jahrhunderts und hebt dabei hervor, daß bei der Neuordnung Deutschlands 1814/15 die Herrscher auf der militärischen Kommandogewalt beharrten und diese bis zum Ende der Kaiserreichs ohne Einschränkungen ausübten. Die Bemühungen der Parlamente, Einfluß auf die Streitkräfte zu erlangen, erwiesen sich als erfolglos, zumal es dem Selbstverständnis des "Kriegsherrn" nicht entsprach, Zwischeninstanzen im Kommandobereich zu akzeptieren. Die Privilegierung des Offizierstandes, wie sie die preußische Hofrangordnung kannte und wie sie die Gesellschaft des Kaiserreichs prägte, hing mit dieser direkten Beziehung zwischen Monarch und Militär zusammen (siehe "Hauptmann von Köpenick").
Der zivilen Gesellschaft mit sozialer Mobilität stand - so betont Rüdiger Schmidt - die auf Exklusivität bedachte, statische militärische Gemeinschaft gegenüber. Er untersucht am Beispiel der Städte Trier, Bonn und Elberfeld das Verhältnis von Stadt und Militär, von städtebaulichen bis zu sicherheitspolitischen Aspekten. Die Kasernierung der Streitkräfte - häufig in säkularisierten Klöstern - beendete die Einquartierung in Bürgerhäuser und führte durch den Neubau von Garnisonsunterkünften zu öffentlichen Investitionen, die, wie Tilly betont hatte, nur zum Teil durch die Städte aufgebracht werden mußten.
Viele Kommunen betrachteten die Präsenz von Militär mit gemischten Gefühlen: Für die Trierer wirkten die Truppen "bedrohlich, aber auch beschützend". Diese Ambivalenz der Bürger in ihrem Verhältnis zur bewaffneten Macht ließ sich in vielen Städten des 19. Jahrhunderts feststellen und hing - wie die Abhandlung von Gernot Wittling über Berlin zeigt - damit zusammen, daß bis zum Aufbau einer Polizeitruppe im Revolutionsjahr 1848 durch Carl Ludwig von Hinckeldey die Armee nicht nur bei inneren Unruhen eingesetzt wurde, sondern daß es zur Aufgabe ihres Wachpersonals gehörte, Gesetzesübertretungen der Bürger, wie das Rauchen auf der Straße, zu ahnden. Nachdem die Polizei die Schutz- und Überwachungsfunktionen übernommen hatte, nahm die Akzeptanz des Militärs durch die Bevölkerung spürbar zu. Der einst gehaßte General Wrangel wurde zu "Papa Wrangel", und auch der "Kartätschenprinz" des Jahres 1848 wurde nun liebevoll "Vater Wilhelm" genannt.
Bei den Bewerbungen vieler Städte um Garnisonen spielten - wie eine Studie über das rheinisch-westfälische Industriegebiet zeigt - sicherheitspolitische und wirtschaftliche Motive gleichermaßen eine wichtige Rolle. Petitionen Bochumer Bürger führten die schlechte wirtschaftliche Lage ihrer Stadt an, während die bergischen Industriestädte Barmen/Elberfeld mit dem rapiden Anstieg der Sozialdemokratie um die Jahrhundertwende ihren Wunsch nach Militär begründeten. Die Wirtschaftsinteressen der Kommunen, darüber sind sich aber alle Autoren einig, standen bei den meisten Initiativen im Vordergrund; denn Kasernenbauten beflügelten die Konjunktur nachhaltig, und Soldaten wurden besonders als Konsumenten geschätzt - wie die aktuelle Diskussion um den Garnisonsabbau in Deutschland beweist. Eine systematische Untersuchung über die Bemühungen bayerischer Städte um militärische Einrichtungen, die der am Münchner Staatsarchiv tätige Rainer Braun vornimmt, bestätigt die Priorität wirtschaftlicher Überlegungen: das Militär als Konjunkturspritze.
Zweifellos prägte die Militärpräsenz auch das alltägliche Leben einer Stadt; solche mentalitätsgeschichtlichen Fallstudien vermißt man leider in diesem ansonsten sehr informativen Sammelband. Auch die Einrichtung des "Einjährig-Freiwilligen", der das Reserveoffizierspatent erwerben konnte und damit gleichsam eine Symbiose zwischen Bürger und Militär darstellte, hätte im Rahmen dieses ausführlichen Sammelbandes mehr Beachtung finden können. Die vielen, häufig am Einzelfall orientierten Aufsätze verdeutlichen darüber hinaus, daß künftig viel stärker interdisziplinär gearbeitet werden muß, wenn man das große Thema des 19. Jahrhunderts "Stadt und Militär" noch intensiver erschließen möchte.
DIETHARD HENNIG
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main