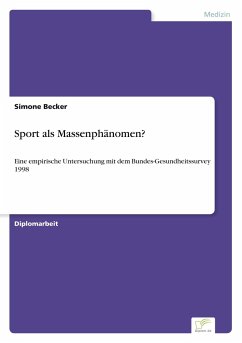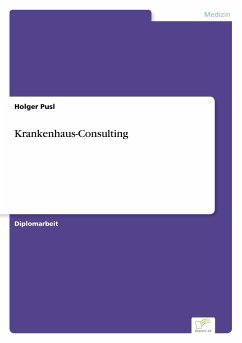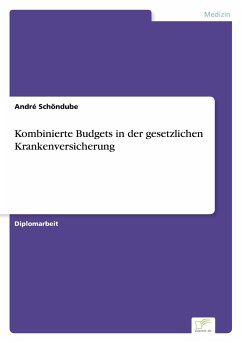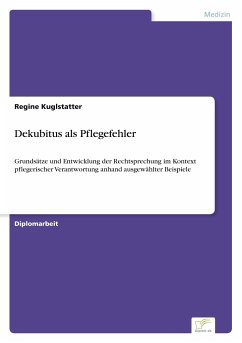Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Gesundheitswissenschaften, Note: 1,0, Universität Mannheim (Sozialwissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung:
In der Arbeit geht es zum einen um die Frage, in welchem sozialstrukturellen Determinationszusammenhang der Sport steht und zum anderen soll aufgezeigt werden inwiefern Lebenssituation und Handlungsmuster in einem Zusammenhang zur Sportbetätigung stehen. Um diese Frage angemessen zu beantworten, wurden mögliche Einflussfaktoren sportlicher Betätigung untersucht. Der Bundes-Gesundheitssurvey stellt hierfür eine geeignete Datengrundlage dar, da die auf einer Zufallsstichprobe der deutschen Wohnbevölkerung beruhenden Daten Aussagen zur Sportbetätigung der Gesamtbevölkerung sowie eine Untersuchung verschiedenster Korrelate sportlicher Aktivität ermöglichen.
Die Diplomarbeit entstand in engem Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt Zur Rolle des Sports bei der Prävention des Rückenschmerzes - Repräsentative Analysen des Bundes-Gesundheitssurvey für die Bundesrepublik Deutschland der Stiftung Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg. Der Bundes-Gesundheitssurvey 1998 ist eine bundesweite, vom Robert-Koch-Institut Berlin im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit durchgeführte Studie. Die Stiftung Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg hat in diesem Zusammenhang vom Robert-Koch-Institut Berlin den Auftrag erhalten, die Daten dieser Querschnittstudie bezüglich der eingangs genannten Fragestellung zu analysieren und zu publizieren.
Aufgrund des gesundheitlichen Nutzens der sportlichen Betätigung ist es von besonderer Bedeutung, systematische Ausgrenzungen von bestimmten Bevölkerungsgruppen im Sport zu vermeiden. Um gezielte Maßnahmen gegen den Ausschluss von bestimmten Bevölkerungsgruppen ergreifen zu können, ist es von besonderer Bedeutung zu wissen, welche Bevölkerungsgruppen im Sport unterrepräsentiert sind.
Die positiven Effekte sportlicher Betätigung beschränken sich allerdings nicht nur auf gesundheitliche Vorteile. Die positiven ökonomischen Auswirkungen des Sports schlagen sich nach Darlison (2000) in drei Bereichen nieder. Eine körperlich und geistig leistungsfähige Arbeitskraft trägt erstens zur Steigerung der Produktivität bei und nimmt zweitens die Leistungen des Gesundheitssystem seltener in Anspruch. Drittens leistet die sogenannte Sport- und Freizeitindustrie einen erhebliche wirtschaftlichen Beitrag (Darlison 2000: 965). Für den Bereich der sportlichen Aktivität existieren im Vergleich zu anderen die Gesundheit beeinflussenden Bereichen wie Alkoholkonsum oder Rauchverhalten wenig Untersuchungen (Semmer 1991: 115). Die existierenden Untersuchungen zu Korrelaten sportlicher Betätigung beschränken sich oft auf sehr spezielle Populationen (z.B. Personen ab 50 Jahre, Bewohner einer Stadt) und sind somit nicht ohne Probleme auf die Gesamtbevölkerung übertragbar. Gemäß der Analyse des Forschungsstandes existiert noch keine, mit der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchung vergleichbare Studie zu Korrelaten sportlicher Betätigung, die auf einer Zufallsstichprobe der gesamtdeutschen Bevölkerung beruht (vgl. Kap. 4).
Im Anschluss an die Einleitung erfolgt in Kapitel 2 die Darstellung der auf die Erklärung der Sportbetätigung anwendbaren theoretischen Ansätze. Als Konzepte der sozialen Ungleichheit werden das auf Geißler zurückgehende Schichtungsmodell, der Lebensstilansatz von Bourdieu und ein allgemeines Modell zur Erklärung des Freizeitverhaltens von Lamprecht und Stamm auf die Sportbetätigung angewendet. Gemäß diesen Ansätzen der sozialen Ungleichheit und auch den anschließend behandelten Sozialisationsansätzen ist die Sportbetätigung als gesellschaftlich geprägt anzusehen und erfolgt somit nicht unabhängig von sozioökonomischen und soziodemografischen Faktoren. Diese Ansätze gehen davon aus, dass sich ...
In der Arbeit geht es zum einen um die Frage, in welchem sozialstrukturellen Determinationszusammenhang der Sport steht und zum anderen soll aufgezeigt werden inwiefern Lebenssituation und Handlungsmuster in einem Zusammenhang zur Sportbetätigung stehen. Um diese Frage angemessen zu beantworten, wurden mögliche Einflussfaktoren sportlicher Betätigung untersucht. Der Bundes-Gesundheitssurvey stellt hierfür eine geeignete Datengrundlage dar, da die auf einer Zufallsstichprobe der deutschen Wohnbevölkerung beruhenden Daten Aussagen zur Sportbetätigung der Gesamtbevölkerung sowie eine Untersuchung verschiedenster Korrelate sportlicher Aktivität ermöglichen.
Die Diplomarbeit entstand in engem Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt Zur Rolle des Sports bei der Prävention des Rückenschmerzes - Repräsentative Analysen des Bundes-Gesundheitssurvey für die Bundesrepublik Deutschland der Stiftung Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg. Der Bundes-Gesundheitssurvey 1998 ist eine bundesweite, vom Robert-Koch-Institut Berlin im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit durchgeführte Studie. Die Stiftung Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg hat in diesem Zusammenhang vom Robert-Koch-Institut Berlin den Auftrag erhalten, die Daten dieser Querschnittstudie bezüglich der eingangs genannten Fragestellung zu analysieren und zu publizieren.
Aufgrund des gesundheitlichen Nutzens der sportlichen Betätigung ist es von besonderer Bedeutung, systematische Ausgrenzungen von bestimmten Bevölkerungsgruppen im Sport zu vermeiden. Um gezielte Maßnahmen gegen den Ausschluss von bestimmten Bevölkerungsgruppen ergreifen zu können, ist es von besonderer Bedeutung zu wissen, welche Bevölkerungsgruppen im Sport unterrepräsentiert sind.
Die positiven Effekte sportlicher Betätigung beschränken sich allerdings nicht nur auf gesundheitliche Vorteile. Die positiven ökonomischen Auswirkungen des Sports schlagen sich nach Darlison (2000) in drei Bereichen nieder. Eine körperlich und geistig leistungsfähige Arbeitskraft trägt erstens zur Steigerung der Produktivität bei und nimmt zweitens die Leistungen des Gesundheitssystem seltener in Anspruch. Drittens leistet die sogenannte Sport- und Freizeitindustrie einen erhebliche wirtschaftlichen Beitrag (Darlison 2000: 965). Für den Bereich der sportlichen Aktivität existieren im Vergleich zu anderen die Gesundheit beeinflussenden Bereichen wie Alkoholkonsum oder Rauchverhalten wenig Untersuchungen (Semmer 1991: 115). Die existierenden Untersuchungen zu Korrelaten sportlicher Betätigung beschränken sich oft auf sehr spezielle Populationen (z.B. Personen ab 50 Jahre, Bewohner einer Stadt) und sind somit nicht ohne Probleme auf die Gesamtbevölkerung übertragbar. Gemäß der Analyse des Forschungsstandes existiert noch keine, mit der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchung vergleichbare Studie zu Korrelaten sportlicher Betätigung, die auf einer Zufallsstichprobe der gesamtdeutschen Bevölkerung beruht (vgl. Kap. 4).
Im Anschluss an die Einleitung erfolgt in Kapitel 2 die Darstellung der auf die Erklärung der Sportbetätigung anwendbaren theoretischen Ansätze. Als Konzepte der sozialen Ungleichheit werden das auf Geißler zurückgehende Schichtungsmodell, der Lebensstilansatz von Bourdieu und ein allgemeines Modell zur Erklärung des Freizeitverhaltens von Lamprecht und Stamm auf die Sportbetätigung angewendet. Gemäß diesen Ansätzen der sozialen Ungleichheit und auch den anschließend behandelten Sozialisationsansätzen ist die Sportbetätigung als gesellschaftlich geprägt anzusehen und erfolgt somit nicht unabhängig von sozioökonomischen und soziodemografischen Faktoren. Diese Ansätze gehen davon aus, dass sich ...