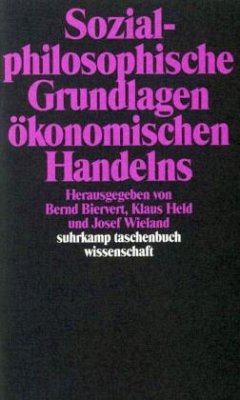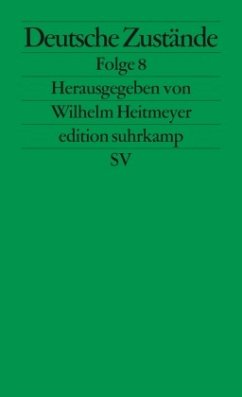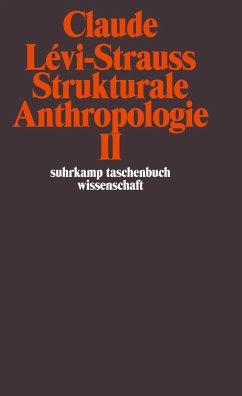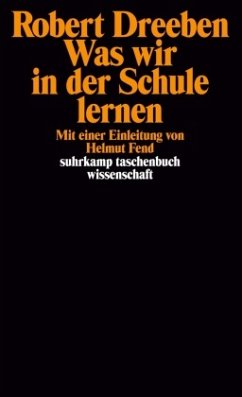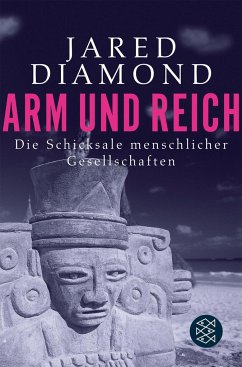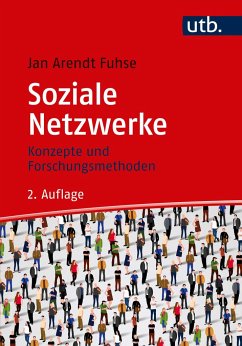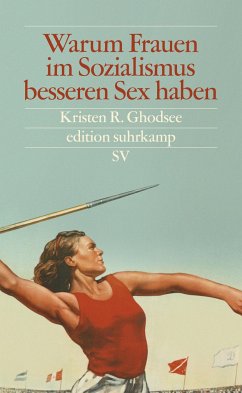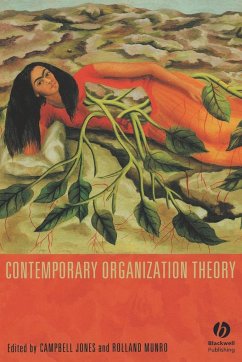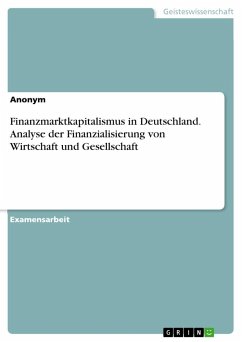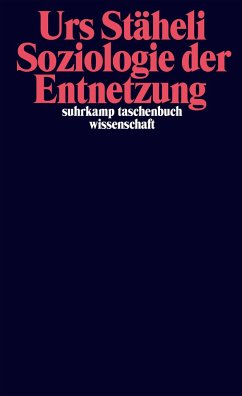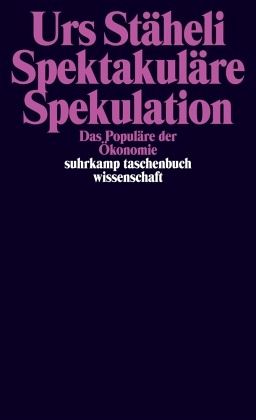
Spektakuläre Spekulation
Das Populäre der Ökonomie
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
14,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Spektakuläre Spekulation untersucht, wie in Selbst- und Fremdbeschreibungen der Börsenspekulation über ihren Status im Feld der Wissenschaften debattiert wird. Die Spekulation scheint dabei immer auch auf Momente des Nichtökonomischen zu verweisen - sei es im 'thrill' des Spekulierens und dessen Nähe zum verschwenderischen Geldspiel, sei es in der Beschreibung von Finanzmärkten als verführerische und hysterische Frau oder als unkontrollierbare Masse. Diese Studie, die eine enorme Materialfülle brillant erschließt, interessiert sich dafür, wie in vornehmlich amerikanischen Spekulation...
Spektakuläre Spekulation untersucht, wie in Selbst- und Fremdbeschreibungen der Börsenspekulation über ihren Status im Feld der Wissenschaften debattiert wird. Die Spekulation scheint dabei immer auch auf Momente des Nichtökonomischen zu verweisen - sei es im 'thrill' des Spekulierens und dessen Nähe zum verschwenderischen Geldspiel, sei es in der Beschreibung von Finanzmärkten als verführerische und hysterische Frau oder als unkontrollierbare Masse. Diese Studie, die eine enorme Materialfülle brillant erschließt, interessiert sich dafür, wie in vornehmlich amerikanischen Spekulationsdiskursen des 19. und 20. Jahrhunderts um die Grenze zwischen Ökonomie und ihrem Außen gerungen wird - und wie auf diese Weise der Börsenspekulant zur ambivalenten Verkörperung des Homo oeconomicus wird.Der Ruf der Finanzökonomie, unpopulär zu sein, dürfte nach diesem Buch definitiv der Vergangenheit angehören. Urs Stäheli zeigt in brillanter Weise, daß die Spekulation immer auch ihre spektakulären Seiten hat und die Ökonomie mit Unterhaltung durchsetzt ist.