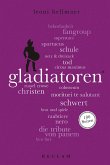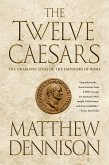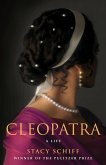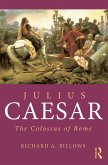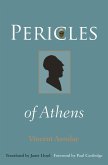Hat er zuletzt vielleicht sogar davon geträumt, die Zentralmacht Rom aus den Angeln zu heben? Aldo Schiavone legt eine Biographie des Kämpfers und brillanten Strategen Spartakus vor.
Jeder hat schon mal von ihm gehört, was nicht für viele antike Personen gilt. Karl Marx nannte ihn "den famosesten Kerl, den die ganze antike Geschichte aufzuweisen hat", und unter dem Namen "Spartakisten" kämpften deutsche Kommunisten zur Zeit der Weimarer Republik für eine klassenlose Gesellschaft. Das breite Publikum kennt ihn als Filmhelden, der heroisch und selbstlos für Freiheit und Gerechtigkeit kämpft: Kirk Douglas hat ihn in Stanley Kubricks Film "Spartacus" kongenial verkörpert. Medienkonsumenten mit Spezialinteressen konnten ihn in den letzten drei Jahren in der nicht jugendfreien und eher auf Gewalt- und Sexdarstellungen spezialisierten 33-teiligen Fernsehserie "Spartacus" des amerikanischen Kabelsenders Starz bewundern.
Die moderne Präsenz des Spartakus steht freilich in merkwürdigem Gegensatz zu den äußerst dürftigen und oft widersprüchlichen Informationen, die aus der Antike über ihn berichtet werden. Spätestens seit Antonio Guarinos Analyse des "Mythos" Spartakus (1979) kann es daher als Gemeinplatz gelten, dass nicht so sehr der historische Akteur, sondern seine schon in der Antike selbst einsetzende und bis in die jüngste Zeit reichende immer wieder neue Vereinnahmung das eigentlich Interessante des Phänomens Spartakus darstellt. Der bekannte italienische Althistoriker Aldo Schiavone unterläuft nun diesen Stand der Forschung in einer neuen Biographie: Transformationsgeschichte und Projektionen späterer Zeiten sollen ausdrücklich nicht behandelt werden, es geht nur um den historischen Spartakus - "wie er eigentlich gewesen ist", ist man versucht hinzuzufügen.
Die relativ sicheren Fakten sind schnell erzählt: Aus Thrakien stammend, hatte Spartakus im römischen Heer gedient und war aus unbekannten Gründen in die Sklaverei verkauft worden. Aufgrund seiner körperlichen Statur wurde er Kämpfer in einer Gladiatorenschule in Capua, aus der er im Jahre 73 vor Christus mit etwa siebzig anderen Gladiatoren ausbrach. Dem Zug schlossen sich schnell weitere geflohene Sklaven, aber auch arme Freie an. Ein römisches Heer von 3000 Mann wurde am Vesuv in einen Hinterhalt gelockt und in die Flucht geschlagen. Weitere, immer größere römische Truppenkontingente versuchten vergeblich, die Ordnung wiederherzustellen. Spartakus erwies sich nicht nur als charismatischer Anführer, sondern auch als brillanter Organisator und genialer Feldherr. Die Römer wurden durch Listen getäuscht und in mehreren Schlachten vernichtend geschlagen, so dass Desertionen die Folge waren. Die Truppen des Spartakus eroberten eine Reihe von Städten in Kampanien, wo sie raubten, mordeten und brandschatzten. Der Senat in Rom schickte Anfang des Jahres 72 die beiden Konsuln mit mehreren Legionen gegen Spartakus und seine mittlerweile 40 000 Kämpfer.
Über die längerfristigen Ziele scheint es unter den Aufständischen unterschiedliche Vorstellungen gegeben zu haben: Spartakus, von dem berichtet wird, dass er den Besitz von Gold und Silber verbot, wollte sie durch Italien und über die Alpen in ihre freien Herkunftsländer führen, konnte sich aber nicht durchsetzen. Unter der Führung seines Gefährten Krixos spaltete sich ein Heer ab, das sogleich von römischem Militär geschlagen wurde. 20 000 Sklaven sollen dabei ums Leben gekommen sein. Spartakus selbst dagegen brachte den Römern weiterhin Niederlagen bei. Ein Prokonsul und die beiden Konsuln wurden in offenen Feldschlachten geschlagen. Die Truppen der Aufständischen wuchsen auf 60 000 (nach anderen Angaben sogar auf 120 000) an. Sie zogen plündernd und mordend durch Italien. Es entstand sogar das Gerücht, Spartakus plane, Rom zu erobern. Dort wurde im Herbst 72 das Oberkommando an Licinius Crassus, den späteren Triumvirn, übergeben, der nach ersten Niederlagen die Aufständischen im äußersten Süden Italiens mit einer Art Befestigungswall einkesselte. Spartakus selbst stellte sich Anfang des Jahres 71 der Entscheidungsschlacht. Mit großem Einsatz soll er im dichtesten Kampfgetümmel, am Schluss verletzt und auf den Knien kämpfend, gefallen sein. Sein Tod beendete den Aufstand.
Schiavones Darstellung folgt weitgehend den unumstrittenen Berichten und schlägt verschiedentlich neue Deutungen der Widersprüche der antiken Quellen vor. Aufschlussreich ist seine Biographie jedoch vor allem in methodischer Hinsicht: Er macht gewissermaßen die Not zur Tugend und überbrückt die Informationsarmut im Detail durch Analysen übergreifender struktureller Rahmenbedingungen. Die römische Sklaverei, die Struktur landwirtschaftlicher Großbetriebe, städtische Organisationsformen und militärische Gegebenheiten werden systematisch erörtert. So werden die Bedingungen, Spielräume und Beschränkungen der Akteure erklärt, was die Einschätzung ihres Handelns überhaupt erst ermöglicht. Eine Art strukturgeschichtlich gesättigte, neue Ereignisgeschichte wird auf diese Weise angestrebt, die zweifellos - auch für quellenreichere historische Zeiten - als vorbildlich anzusehen ist.
Hervorzuheben ist auch die Dekonstruktion der (im heutigen Italien noch durchaus verbreiteten) spätmarxistischen Klassentheorie, bezogen auf die römische Gesellschaft. Sklaven, dies zeigt Schiavone in aller Deutlichkeit, bildeten keine soziale Klasse: Zwischen dem Sekretär eines reichen Senators und einem kasernierten Plantagensklaven gab es jenseits des Rechtsstatus keine Gemeinsamkeiten. Es gab Personen, die sich freiwillig in die Sklaverei begaben, weil sie sich davon Vorteile versprachen, und die Lebensbedingungen der freien Landbevölkerung in Sizilien und Süditalien unterschieden sich von denen der unfreien Arbeiter vielfach nur unwesentlich.
Mit der Klassengesellschaft entfällt auch der Klassen-, ja sogar der Befreiungskampf. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass die Aufständischen um Spartakus in irgendeiner Weise die Sklaverei als solche in Frage gestellt hätten. Ihr Umgang mit gefangenen römischen Soldaten deutet eher auf eine Verkehrung der Rollen: Man ließ die zuvor freien Römer als Gladiatoren gegeneinander kämpfen. Demnach ging es den ehemaligen Sklaven um die Versklavung ihrer Sklavenhalter, das heißt um den Versuch, sich an ihre Stelle zu setzen - was die Alternativlosigkeit und Akzeptanz der römischen Sklaverei auch seitens der Unterlegenen beleuchtet. Freiheit und Gleichheit als Handlungsmotive sind nirgendwo sichtbar.
Was aber bleibt dann noch von Spartakus, wenn er weder "famoser Kerl" noch Kirk Douglas war? Tatsächlich nur ein brutaler Gewalttäter à la Trash-TV? Schiavone gibt eine andere Antwort. Ausgehend von dem scheinbar ziellosen Umherziehen der Aufständischen im südlichen Italien, stellt er die These auf, dass Spartakus auf der Basis der immer wieder neuen Erfolge gegen römische Heere ab einem bestimmten Zeitpunkt den Entschluss fasste, die römische Herrschaft als solche herauszufordern. Hannibal, der berühmte karthagische Feldherr, der anderthalb Jahrhunderte zuvor in ähnlicher Weise in Italien agierte und - obwohl abgeschnitten von seinen Ressourcen in Nordafrika und Spanien - die römische Herrschaft bedrohte, wäre demnach das Vorbild gewesen. Aus dem Sozialrevolutionär Spartakus wird so ein politischer Großakteur, eine Art antiker Warlord.
Schiavone ist selbstkritisch genug und weiß um die mangelnde Quellenbasis für eine so weit gehende Deutung der Motive des Spartakus. Er versucht jedoch, die reale Möglichkeit seiner Deutung plausibel zu machen. Wenn er recht hat - und manches spricht dafür -, müssen allerdings an Weitsicht und militärischer Genialität des Spartakus gewisse Abstriche gemacht werden. Italien, so kann man einwenden, war in der Machtpolitik des römischen Senats jener Zeit nur ein Nebenkriegsschauplatz. In Spanien kämpfte Pompeius mit wechselndem Erfolg gegen Sertorius, im Osten des Reiches führte Licinius Lucullus einen dritten Krieg gegen den König Mithridates. Als man das italische Problem ernst nahm und Crassus das Kommando übergab, war der Sklavenaufstand schnell vorbei. Die römischen Verluste in der Entscheidungsschlacht sollen sich auf 1000 Tote belaufen haben, auf Seiten der Aufständischen fielen angeblich 60 000. Die übrig gebliebenen 6000 ehemaligen Sklaven wurden zwischen Capua und Rom entlang der Via Appia ans Kreuz geschlagen.
ALOYS WINTERLING
Aldo Schiavone: "Spartacus". Revealing Antiquity.
Translated by Jeremy Carden. Harvard University Press, Cambridge/Mass., London 2013. 208 S., geb., 14,70 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main