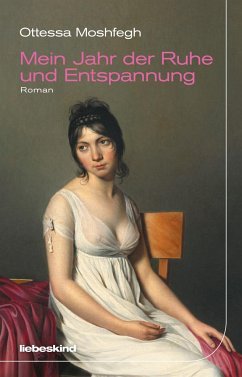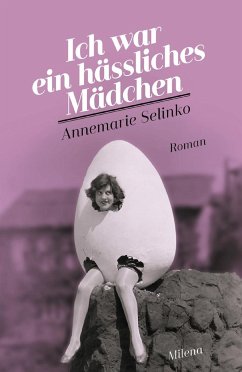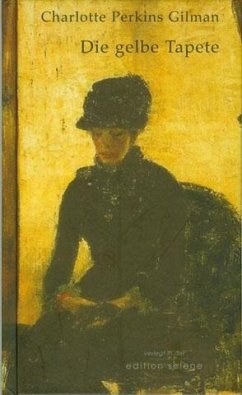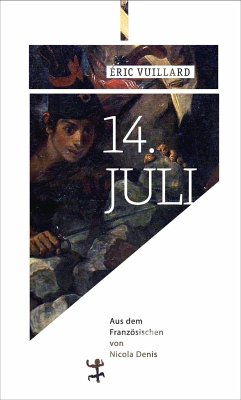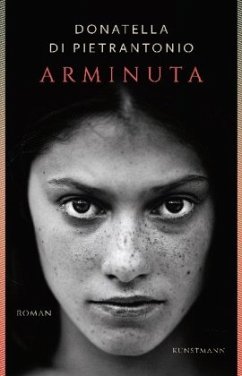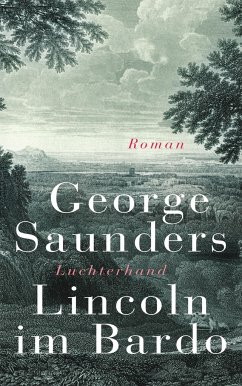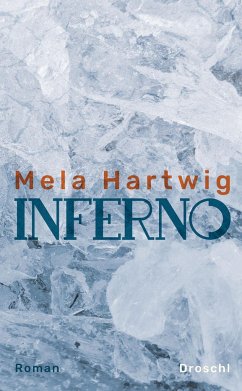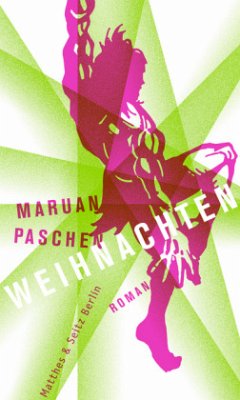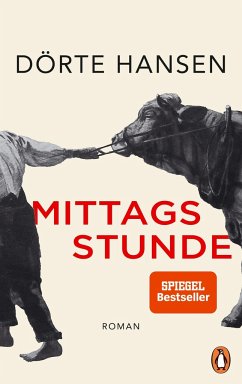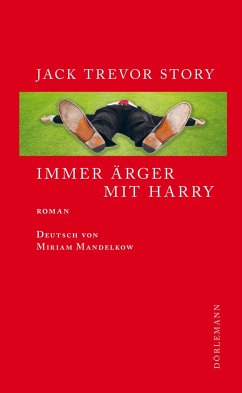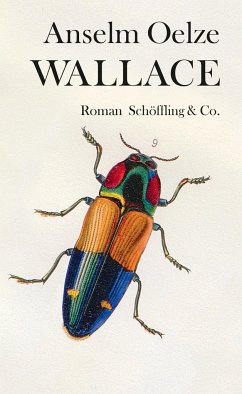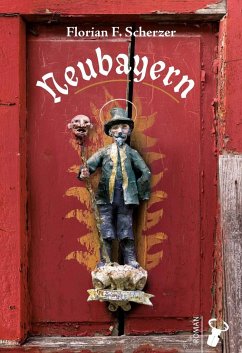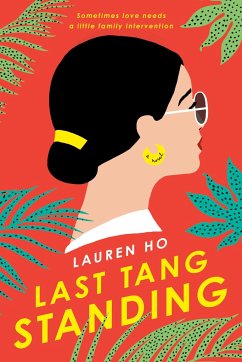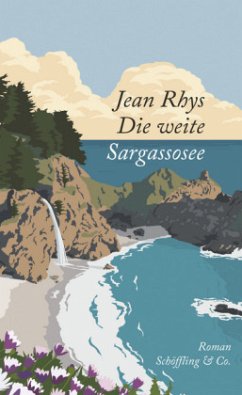gewichtiges und zugleich fabelhaft leichthändig geschriebenes Werk, das in der Übersetzung von Manfred Allié zum Lesegenuss wird.
Schauplatz ist die britische Kronkolonie Singapur um 1940, mit ihrer klebrig-schwülen Dauerhitze und schlaflosen Emsigkeit, mit ihren prächtigen und verrufenen Ecken, ihren Kolonialpalästen und Wellblechhütten, ihrem Karneval der Kulturen - eine schon damals boomende Metropole, bevölkert von "Heimatlosen" aus aller Herren Ländern, Kulis und Hilfsarbeitern, die zu fünfzigst in einem Zimmer leben. Walter Blackett und die Seinen residieren allerdings auf größerem Fuß. Walter ist Miteigentümer der Firma "Blackett & Webb", die mit dem Handel von Tee, Gewürzen, Reis und Ananas begann und dann im Gummigeschäft groß und marktbeherrschend wurde. Dass ein erfolgreicher Geschäftsmann animalische Instinkte braucht, bestätigt sich beim Anblick von Walters Rücken. Dort hat er borstige Haare, die sich aufrichten im Zustand (nicht nur) geschäftlicher Erregung.
Seine koloniale Herrlichkeit ist jedoch von allen Seiten bedroht. Die Kautschuk-Zapfer auf den Plantagen streiken, der chinesische Kommunismus streckt verschwörerische Fangarme aus, die Japaner erobern Ostasien, in Europa beginnt der Weltkrieg - Walter aber will vom Untergang seiner Welt nichts wissen. Das fünfzigjährige Firmenjubiläum von Blackett & Webb soll groß gefeiert werden, mit stampfenden Blaskapellen und einer allegorischen Wagenparade unter dem Motto "Beständigkeit im Wohlstand" - man fühlt sich an die groteske Parallelaktion in Musils "Mann ohne Eigenschaften" erinnert. Walter lässt sich im Probeneifer auch nicht beirren, als die ersten Mitsubishi-Bomber über Singapur erscheinen.
Zugleich hat dieser Roman einer Unternehmerfamilie auch seine Buddenbrook-Momente. In Walters wenig geschäftstüchtigem, aber genussfreudigem Sohn Monty verkörpert sich der "Niedergang" der Familie - bei der großen Parade hat Walter ihm nicht zufällig die Allegorie der "unproduktiven Fixkosten" zugedacht. Auch andere Nebenfiguren erinnern an die humoristischen Typisierungen Thomas Manns, etwa der Arzt Brownley, der auf jeder von Walters Partys der erste und letzte Gast ist und dem umso mehr die Gewissensqual zu schaffen macht, dass er sich nie zu einer Gegeneinladung aufraffen kann.
Walter drapiert seinen skrupellosen Pragmatismus gern mit der Ideologie der "Bürde des weißen Mannes". Geschäftsmänner sind für ihn die Missionare des Fortschritts und der Zivilisation, immer bedroht von den "Krokodilen des Bankrotts und der Schande". Sein designierter Nachfolger, Matthew Webb, hält antikapitalistisch dagegen. Auch wenn der Autor selbst mehr zur Position Matthews tendierte und am Beispiel der Reis- und Kautschukmärkte die Tricks und Preismanipulationen einer Ökonomie der Ausbeutung aufzeigt, so hat er Walter doch so überzeugend dargestellt, dass auch seine Reden Strahlkraft haben - und den Charme eines Mannes, dessen Welt dem Untergang geweiht ist.
Denn in der zweiten Hälfte beginnt das Inferno. Historisch akkurat schildert der Roman die Schlacht um Singapur zu Beginn des Jahres 1942, für Churchill "die größte Katastrophe" des Britischen Empires. Aber so abenteuerlich die Vorgänge auch sind - Kämpfe in den Gummibaumplantagen, knapp vereitelte Brückensprengungen, Panzerattacken -, Farrell legt den Schwerpunkt auf die Psychologie der Figuren. Am Ende steht die halbe Stadt in Flammen und dazu der Singapore River, in den die Flut das brennende Öl aus den bombardierten Großtanks am Hafen drückt: ein ungeheures Panorama der Vernichtung. Als die wahren Heroen erweisen sich die Männer der freiwilligen Feuerwehr in ihrem aussichtslosen Kampf gegen die Monsterbrände, Matthew darunter. So plastisch geschildert hat man dergleichen noch nicht gelesen. Walter kann unterdessen zusehen, wie die Kautschuklager abbrennen. "Die alte Ordnung war tot, mausetot."
Farrell erzählt mit Witz und Esprit, unbekümmert um moderne oder postmoderne Erzähltechniken, wie sie in den siebziger Jahren hoch im Kurs standen. Mal ist er ganz nah dran an den Figuren, mal schwebt er reflektierend hoch über ihnen. Sein überlegenes auktoriales Wissen lässt ihn in die innersten Gedankengänge der Protagonisten dringen - und seien es historische Gestalten wie der Befehlshaber der britischen Verteidigung Singapurs, General Percival. Zu den vielen reizvollen Nebenfiguren - Verwaltungsbeamte, Botschafter, Militärs und Agentinnen - gehört der liebenswürdige Major Archer, der Held des vorhergehenden Farrell-Romans "Trouble". Mit seinem zerzausten Spaniel, der auf den schönen Namen "La Condition humaine" hört, sorgt er für skurrile Szenen, etwa wenn er angesichts der Kriegsgefahr einen Vortrag über "Zivilschutzmaßnahmen für Haustiere" hält. Wie gewöhnt man seinen Liebling beizeiten an den Anblick des Herrchens mit Gasmaske?
WOLFGANG SCHNEIDER
James Gordon Farrell:
"Singapur im Würgegriff". Roman.
Aus dem Englischen von Manfred Allié. Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2017. 832 S., geb., 30,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
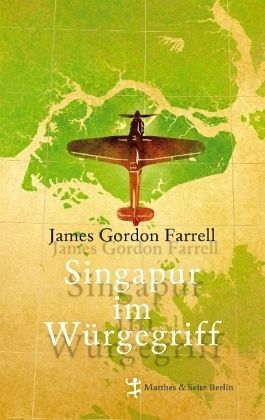





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.01.2018
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.01.2018