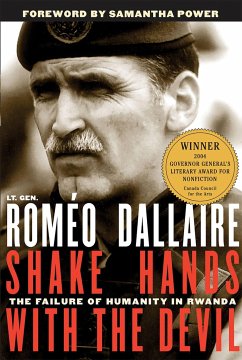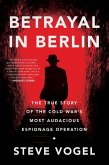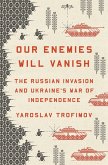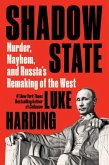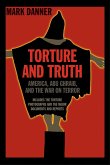Canadian Gen. Romaeo Dallaire, force commander of the UN Assistance Mission for Rwanda, recreates the history of the most barbarous and chaotic civil war and genocide--which transformed him from confident Cold Warrior to devastated UN commander, and finally to retired general struggling painfully, and publicly, to overcome posttraumatic stress disorder.

Zweimal Ruanda, zweimal Völkermord: Aus dem Blick eines UN-Generals und dem eines Katastrophenkomparatisten
Zweimal Ruanda, einmal von oben, einmal von unten, einmal aus literaturwissenschaftlicher Warte, einmal als quälendes Erinnerungslogbuch, einmal von dem Literaturwissenschaftler Robert Stockhammer, der noch nie in Ruanda war, einmal von dem Kanadier Romeo Dallaire, der 1993, als er den Auftrag zur Führung einer kleinen Blauhelmtruppe bekam, sagte: „Runda? Das ist doch in Afrika, oder?” Im August landete er in Kigali und glaubte, mithelfen zu können, das von den Bürgerkriegsparteien vereinbarte Abkommen von Arusha umzusetzen. Acht Monate später musste Dallaire über das Telefon miterleben, wie befreundete Tutsis, die ihn um Hilfe rufen wollten, zusammen mit ihren Familien mit Macheten abgeschlachtet wurden. Die Mörder hackten zuerst den Kindern Arme und Beine ab, dann trennten sie ihnen die Genitalien ab und schmissen sie den Eltern ins Gesicht. Die Kinder ließ man einfach verbluten. Die Eltern wurden dann schneller hingerichtet.
Müllwagen mit Leichen
Ja, die Afrikaner. Immer dieses tribalistische Chaos im Herzen der Dunkelheit. Noch am 19. April 1994, also 14 Tage nachdem der staatlich geplante, minutiös choreographierte Völkermord begonnen hatte, schrieb die New York Times von „jahrhundertealten Stammeskriegen”. Hierzulande erklärte Peter Scholl-Latour, es handle sich um einen „Rückfall in uralte Stammesfehden.” Da hatten die Hutu bereits mehrere hunderttausend Menschen umgebracht.
Romeo Dallaire hat ein grausam trauriges Buch geschrieben, eine Chronik des Versagens der UN und ein privates Exerzitienbuch über, wie er selbst es beurteilt, sein eigenes Scheitern während des Genozids. Er hatte im Dezember erfahren, dass die Interahamwe, die extremistischen Hutu, ein Massaker an den Tutsi planten. Am 10. Januar erzählte ihm ein Ausbilder der Interahamwe sogar, wie er den Hutu in Trainingslagern beibringe, innerhalb von 20 Minuten 1000 Menschen umzubringen. Dallaire telegrafierte nach New York und bat um eine Erhöhung seines Kontingents. Die zuständige Abteilung für Friedensmissionen, damals geleitet von Kofi Annan, heute UN-Generalsekretär, verweigerte die notwendige Intervention. Annan empfahl stattdessen den Abzug der Truppen bis auf 270 Mann. Ja, Annan verbot ihm sogar, illegale Waffenlager auszuheben. Vier Monate später fuhren durch die Hauptstadt Kigali Tag und Nacht Müllwagen, an deren Außenwänden das dunkle, stockende Blut der Toten hinunterfloss.
„Im Vergleich zu den Todeslagern in Deutschland während des Holocaust lag die daily killing rate in Ruanda fünfmal höher.” - „At that rate Hitler would have completed the Holocaust in nine months, not six years.” - „Fast eine Million Tote in so kurzer Zeit, das war wirklich einmalig in der Menschheitsgeschichte.” Die drei Sätze stammen aus seriösen historischen Publikationen zum Thema Völkermord. In Robert Stockhammers Reihung bekommen sie fast etwas Komisches, so absurd wirkt der superlativische Eifer.
Das zentrale Paradox an solchen Sätzen, so Stockhammer, „ist, dass hier etwas mit demjenigen verglichen wird, das als Synonym für das Unvergleichliche schlechthin gilt.” 800 000 Menschen wurden ermordet. Oder waren es 1 200 000? Nur 500 000? Stockhammer prägt den so griffigen wie polemischen Begriff von der Katastrophenkomparatistik, wenn er das so unsägliche wie unvermeidliche Vergleichen und Gegeneinanderaufrechnen der Völkermorde untersucht. Er zeigt, wie die Genozidforschung selbst von Ranglisten geprägt wird, in denen sich Sachkriterien mit Rivalitäten der jeweils betroffenen Gruppen ungut verschränken. „Die vergleichende Analyse ( . . .) versucht, die unvermeidbare ,Katastrophenkomparatistik demokratisierend zu zähmen. Dieses humanitäre Interesse drückt sich etwa in der rhetorischen Frage ,Which Genocide matters more? aus, die mit ,keiner zu beantworten sein soll. Doch gibt es unter den Genoziden gleichwohl einen, der gleicher ist als alle anderen, der besonders ,authentisch, ,archetypisch ist.”
Dallaire beschreibt in seinen Erinnerungen ausführlich, wie er vergeblich darum kämpfte, dass die Vereinten Nationen die Geschehnisse in Ruanda als Völkermord einstufen. Die UN lehnten den Begriff „Völkermord” ab, weil sie sonst gemäß Völkermordskonvention von 1948 hätten militärisch intervenieren müssen. Dallaire zögerte selbst zunächst. „Genozid. Das ist ein solch enormes Wort”, sagte er kürzlich in einem Interview. „So enorm wie Holocaust. Es ist doch unvorstellbar, dass man 60 Jahre nach Auschwitz diesen Begriff wieder benutzen muss. Ich habe zuerst von ethnischer Säuberung gesprochen, als dann offensichtlich wurde, wie methodisch vorgegangen wurde, nur noch von Völkermord.”
60 Jahre nach Auschwitz - George Bush und Jacques Chirac haben am Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers pflichtschuldigst davon gesprochen, dass sich sowas nie wiederholen dürfe. Dabei hat es sich doch längst wiederholt. Mit dem Zutun ihrer beider Vorgänger: Bill Clinton wollte, nachdem kurz zuvor die Intervention in Somalia kläglich gescheitert war, nie wieder in ein afrikanisches Schlamassel verwickelt werden. Mitterrand soll gesagt haben: „In den Ländern da unten ist ein Genozid nicht so wichtig.” Als Dallaire die USA bat, eines ihrer Spezialflugzeuge zu entsenden, damit der staatliche Propagandasender zum Schweigen gebracht werden könnte, der zum Abschlachten der Tutsi hetzte, wurde die Bitte von Washington wegen zu hoher Kosten abgewiesen. (Ihm selbst wurde unter Hinweis auf die Pressefreiheit verboten, den Sender zu stören.) Mitte April 1994, so Dallaire, „traf eine Gruppe von Bürokraten ein, um die Situation vor Ort einzuschätzen: ,Wir werden unserer Regierung empfehlen, nicht zu intervenieren, da die Risiken hoch sind und es hier nichts weiter gibt als Menschen.” Noch ehrlicher wäre es gewesen, sie hätten gesagt, dass es hier nichts weiter gibt als Afrikaner.
Imaginäre Ethnographie
Hat je jemand nach Auschwitz die Frage gestellt, wie es habe geschehen können, dass da Europäer Europäer umgebracht hätten? Stockhammer weist in seiner glänzenden Studie über die Aporien der Genozidbeschreibung darauf hin, dass im Schreiben über den Völkermord von Ruanda oft die Tatsache hervorgehoben wird, dass hier Afrikaner Afrikaner umgebracht hätten. Ob es nun die latent rassistischen Kommentare zu Beginn des Schlachtens waren, die eben von Stammesfehden unter Hottentotten sprachen oder das afrophile Gerede, das sich über den „Bruderkrieg” entsetzte: „Die Empörung drückte sich seltener in dem Satz aus, dass hier Ruander Ruander ermordet haben als in demjenigen, dass hier Aikaner Afrikaner ermordet haben.”
Stockhammer zeigt, dass auch die ruandischen Autoren, wenn sie über den Völkermord schreiben, in dem Moment, da sie von sich als Afrikanern sprechen, die europäische Außenperspektive übernehmen: Afrika heißt auf Kinyarwanda, der Amtssprache Ruandas, „umunjafurika”. Es ist ein adaptiertes lateinisches Fremdwort. Die Gemeinschaft der Afrikaner ist eine europäische Erfindung. Etwas wie eine Binnenperspektive auf Afrika, die von der europäischen Außenperspektive unterscheidbar wäre, scheint es nicht zu geben. Der Hinweis ist deshalb so prekär, weil, wie sowohl Dallaire als auch Stockhammer betonen, es die europäischen Kolonisatoren waren, die im 19. Jahrhundert die Rassen der Tutsi und Hutu erfanden. Bis dahin waren die Tutsi die Viehzüchter, die Hutu dagegen die Ackerbauern. Deutsche Forscher machten aus der sozialen eine rassische Zuschreibung. Belgische Priester verbreiteten dann die Theorie, wonach die „nordischen”, angeblich aus Äthiopien eingewanderten Tutsi die „edlere Rasse” seien, während die dunkleren, stämmigeren Hutus einzig zur Landarbeit taugten. Der Völkerkundler Claude Meillassoux spricht in dem Zusammenhang von „imaginärer Ethnographie”.
Romeo Dallaire muss täglich neun Tabletten nehmen, um überhaupt weiterleben zu können. Die Nächte müssen unerträglich sein. Der Tod, so sagte er kürzlich erst wieder, bleibt „immer eine Option für mich”. Zur Zeit ist er viel unterwegs und spricht auf Kongressen und Podien davon, dass sich in Darfur das wiederhole, was in Ruanda geschehen sei. Er tut das jetzt seit einem Jahr und es sieht nicht so aus, als ob das irgendetwas ändern würde.
ALEX RÜHLE
ROMEO DALLAIRE: Handschlag mit dem Teufel. Zweitausendeins, Frankfurt am Main 2005. 651 Seiten, 27,90 Euro.
ROBERT STOCKHAMMER: Ruanda. Über einen anderen Genozid schreiben. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2005. 188 Seiten,9 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
Shake Hands With The Devil is one of the saddest books I have ever read and one of the most heart-breaking eye-witness accounts.A kind of naive and painfully honest confession of the failure of an organisation, a meticulous description of one of the worst betrayals in the history of humanity. Guardian