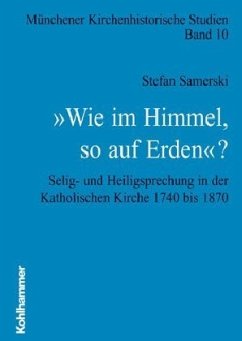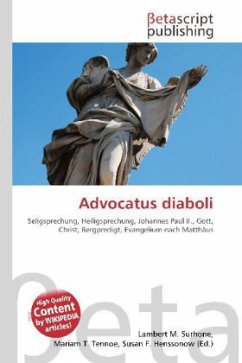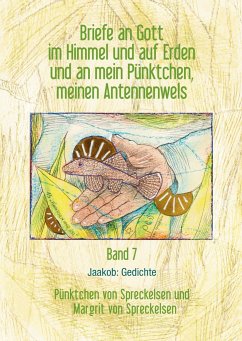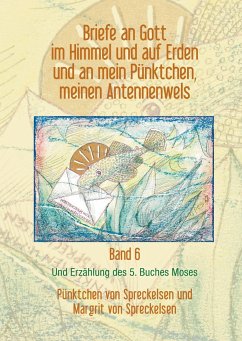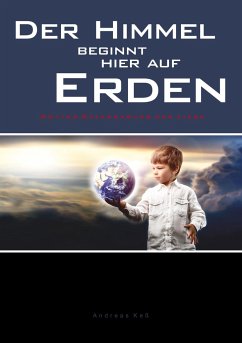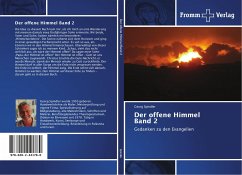Die vorliegende Untersuchung zeichnet anhand der Amtsakten der zuständigen kirchlichen Behörden die Glanzzeit der Beatifikation und Kanonisation (1740 - 1870) in ihrer historischen Entwicklung, ihrer kirchenpolitischen Bedeutung und ihrer politisch-sozialen Relevanz nach. Anhand der erarbeiteten Heiligentypologie sowie der epoche- und regional abhängigen Spezifika lassen sich exemplarisch an immer neuen Selig- und Heiligengestalten das sich wandelnde Selbstverständnis der Kirche in ihrem Reaktionsverhalten auf Umwelt und Zeitgeist aufzeigen. Der wirtschaftliche Aspekt - Kosten und Finanzierung von Prozess und Feierlichkeit - lässt die inneren Mechanismen von Selig- und Heiligensprechung am wohl deutlichsten zu Tage treten.
Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1869/70) wurde die Verehrung der Heiligen skeptisch angesehen; christliches Kerygma sollte eher durch theologische Sprache und konkret gelebte Praxis vermittelt werden. Im Zuge der Biographieforschung freilich ist das Interesse an Lebensläufen generell gewachsen und damit auch die Frage der Heiligengestalten in der Kirche wieder in den Blick gekommen. In diesem Interessenshorizont steht die vorliegende Arbeit, die mit Hilfe der Prozessakten, die für den Zeitabschnitt 1740 bis 1870 lückenlos vorhanden sind, die seinerzeit erfolgten Selig- und Heiligsprechungen untersucht.
Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1869/70) wurde die Verehrung der Heiligen skeptisch angesehen; christliches Kerygma sollte eher durch theologische Sprache und konkret gelebte Praxis vermittelt werden. Im Zuge der Biographieforschung freilich ist das Interesse an Lebensläufen generell gewachsen und damit auch die Frage der Heiligengestalten in der Kirche wieder in den Blick gekommen. In diesem Interessenshorizont steht die vorliegende Arbeit, die mit Hilfe der Prozessakten, die für den Zeitabschnitt 1740 bis 1870 lückenlos vorhanden sind, die seinerzeit erfolgten Selig- und Heiligsprechungen untersucht.

Stefan Samerski schildert die Politik der Heiligsprechungen
Mit dieser Arbeit erhalten wir einen Einblick in die Selig- und Heiligsprechungspraxis der römischen Kirche, wie er in vergleichbarer Breite und Belegdichte bislang nicht zu haben war. Dies vor allem deshalb, weil Stefan Samerski Wert auf größte Quellennähe legt, sein Buch basiert auf exzessiven Archivstudien in Rom, Paris (aus napoleonischen Gründen), Venedig, Olmütz und anderswo. Es sind zumal die vatikanischen Akten der in Sachen Kanonisation zuständigen früheren Ritenkongregation, an die Samerski sich hält; aber er stützt sich teilweise auch auf Recherchen an den Diözesanorten der die Heiligsprechung betreibenden Petenten; Max Weber hätte die letzteren, auf das römische Verfahren hin, als "Interessenten" bezeichnet.
Der Zeitraum, den Samerski untersucht, umfaßt die Jahre 1740 bis 1870. Er setzt aus guten Gründen ein mit dem Pontifikat Benedikts XIV. (1740 bis 1758), dem aus Bologna stammenden "Juristenpapst". Prospero Lambertini hatte schon 1734 sein vierbändiges juristisches wie theologisches Hauptwerk "De servorum Dei beatificatione et beatorum canonisatione" veröffentlicht, und er war es dann, der als Benedikt XIV. die bleibende und bis heute nachwirkende Verfahrensnormierung von Beatifikation und Kanonisation durchsetzte. Samerski untersucht die päpstlich präferierten Causen seines Pontifikats und zeigt den Papst als skrupulösen Kontrolleur der seinerzeit verhandelten Prozesse. Auch die Pontifikate des Venezianers Clemens XIII. (1758 bis 1769), der eine Heiligsprechungspolitik im unverhohlen venezianischen Interesse betrieb, und Pius VI. (1775 bis 1799) nimmt er gesondert in den Blick.
Was den letzteren und seinen Nachfolger angeht, so wird bei Samerski eine erstaunliche Kontinuität ins neunzehnte Jahrhundert hinein deutlich; trotz des napoleonischen Zugriffs auf den Kirchenstaat, trotz zweimaliger Gefangennahme des Papstes und Aktenverschleppung geht das Verfahrensgedächtnis nicht verloren, beharren die Interessenkonstellationen, die die Selig- und Heiligsprechungsverfahren ideell und materiell in Gang halten. Die Kongregation verhandelte ihre Causen weiter - in dem ihr eigenen (in aller Regel) schleppenden Tempo. Beschleunigung und Abschlußfähigkeit kommen vor allem durch päpstliche Interventionen, nicht zuletzt durch Dispense zustande, und solche Interventionen waren dann vor allem die Sache von Pius IX.
Dieser hatte eben nicht nur seine "Lieblingscausen", die er zum Abschluß brachte; seine auf Expansion setzende Heiligsprechungspolitik hatte Programm und Methode. Gezielt vergrößerte er den kanonisationsbefaßten Beamtenapparat der Kongregation, und auch die anhängigen Causen vermehrte er beträchtlich. Ihren Höhepunkt erreicht diese Politik in zwei spektakulären römischen Kanonisationsfeiern von 1862 und 1867, in denen insgesamt zweiundfünfzig neue Heilige zur Ehre der Altäre gelangten. Es sind vor allem Märtyrer, die dabei zum Zuge kommen.
Der Zusammenhang von Mission und Martyrium ist, wie Samerski zeigt, der allerengste; er führte dazu, daß die Selbstwahrnehmung und Selbstdarstellung der katholischen Kirche als Weltkirche in einem neuen, globalen Sinne sich seinerzeit kaum stärker artikulierte als bei den beiden großen Kanonisationsfeierlichkeiten von 1862 und 1867; deren erste gilt sechsundzwanzig japanischen Märtyrern, allesamt Ordensleute, die 1597 in Nagasaki hingerichtet worden waren und deren Causa seit dem siebzehnten Jahrhundert geruht hatte.
Vox populi, vox Dei
Der Heiligenkult der römischen Kirche ist "cultus sanctorum"; er ist nicht der Kult einer abstrakt-anonymen Heiligkeit, sondern der einer offenen Vielzahl von namentlich heilig- oder seliggesprochenen Einzelmenschen, bisweilen auch von Kollektiven wie jenen zweihundertfünf japanischen Märtyrern, die zwischen 1617 und 1632 den Tod fanden und die 1867 von Pius IX. in der Oktav der erwähnten Zentenarfeier seliggesprochen wurden. Verbunden ist mit solcher Sanktifikation herkömmlich die kultische Auszeichnung besonderer Tage und Orte, nämlich der Eintrag an einer bestimmten Zeitstelle im Heiligen- und Festkalender sowie die besondere Verehrung des Heiligen dort, wo sich seine Reliquien befinden. Herr des Verfahrens der Kanonisation, das eines der Prüfung und dann der Sanktionierung ist, ist seit dem Hochmittelalter monopolistisch der Papst. Infolge der Zugangserschwerung und Verteuerung der Kanonisationen machte sich im Spätmittelalter unterhalb der kirchenoffiziellen Heiligkeit die vielerorts publikumsträchtige Verehrung von "beati", von Seligen breit; bezogen darauf kam es dann aber nicht nur zur Einführung der Rangunterscheidung von "sanctus" und "beatus"; darüber hinaus führte der Weg seit dem sechzehnten Jahrhundert auch hier zur Ausbildung eines besonderen, römisch kontrollierten Verfahrens, dem der Beatifikation.
Auch der sakrale und kultische Rang des Seligen wird damit zu einem knappen Gut, dessen Erlangung auf dem römischen Verfahrenswege einen langen Atem und viel Geld voraussetzt. Zu dem römischen "Sanktionsmonopol" gehörte seit dem dreizehnten Jahrhundert im übrigen ein Unfehlbarkeitsanspruch. Dieser artikulierte sich in der Frühzeit aber noch so, daß der Papst bei den Feierlichkeiten der Heiligsprechung die Gläubigen aufrief, dafür zu beten, "daß Gott ihn nicht irren lasse".
Man kann nun sagen: dies ist eine Beschreibung der Dinge von oben her. Und man muß dann hinzufügen: es gibt auch einen Zugang zur Sache von unten her, denn nach katholischer Tradition versteht sich die Heiligsprechung - der römischen Kontrolle zum Trotz - nur als ein reaktives Verfahren, nämlich als eines der Approbation und Sanktionierung. Es kommt, wie es konzipiert ist, eben nicht von der Spitze her in Gang, sondern volksreligiös, durch die zunächst sich artikulierende (und als "vox Dei" verstandene) "vox populi". Daß die Volksreligiosität schon tätig geworden ist, daß die Verehrung und der Ruf der Heiligkeit im Kirchenvolk (mit seinen typischen finanziellen Weiterungen) schon Verbreitung hat, soll der Ausgangspunkt sein. Und also ist das römische Verfahren zunächst gehalten, einen Kommunikationsstand zu prüfen, die "fama sanctitatis", die mehr sein soll als ein lokales oder regionales Gerücht und deren kommunikative Verfestigung. Sie benötigt eine stützende, soziale Praxis der Verehrung vor Ort.
Dem Wunder aufhelfen
Hier wüßte man nun allerdings gern: Wie und nach welchen Kriterien prüft man dergleichen? Oder im Sinne Max Webers gefragt: Mit welcher spezifischen Brille beobachtet das rational geordnete Verfahren die irrationale volksreligiöse Praxis, wenn es deren "Bestehen" feststellen will? Leider bleibt Samerskis Buch, das so viele römische Causen erzählt, an dieser Stelle merkwürdig stumm. Ähnliches gilt für den "heroischen Tugendgrad", der dem Kandidaten (überwiegend männlich), soweit er nicht Märtyrer ist, attestiert werden muß, und vor allem hinsichtlich der Frage der die Fama nährenden "miracula". Das Kanonisationsverfahren ist in erheblichem Maße auf Wunder in bestimmter Anzahl gebaut. Das Vorkommen von Wundern ist dabei als etwas geradezu Berechenbares vorausgesetzt; allerdings müssen die Wunder als solche nachgewiesen werden. Manchmal helfen frisch berichtete Wunder dem Verfahren entscheidend weiter, manchmal auch helfen Dispense und quantitative Nachlässe von ganz oben. Und dementsprechend ist bei Samerski von den Mirakeln allenthalben die Rede. Aber über das Zustandekommen der Wunderberichte, über das Wie ihrer Prüfung erfährt man bei ihm fast nichts; eher nebenbei berichtet er von der Zuziehung von Ärzten und Chirurgen als Fachleuten "für die Stichhaltigkeit der Wunder" (seit dem späten siebzehnten Jahrhundert).
Nach der kulturgeschichtlichen Seite hin hat sich Samerski strikte Askese verordnet. Nur bei der Schilderung des Mezzogiorno als der religiösen Landschaft, die fast ein Drittel der Causen des Untersuchungszeitraums stellt, ist die Askese gelockert und gewinnt das Zusammenspiel von volksfrommem Heiligenkult und römischer Heilig- und Seligsprechungspraxis einiges an Anschaulichkeit. Der wunder- und reliquienfreudige Mezzogiorno wies eben den allergrößten Appetit auf immer neue, lokal oder regional zu verehrende Heiligengestalten auf, und er konnte auch die finanziellen Mittel mobilisieren, die es in Rom für die Befriedigung dieses Appetits brauchte.
Allerdings, auch dabei ging es nicht um schiere Volksreligiosität, denn eine organisatorische Komponente war nachhaltig mit im Spiel. Zum frommen Mezzogiorno gehört eben auch seine außerordentliche Klosterdichte, die Durchdringung der ganzen Region durch die Orden als "Protagonisten des kirchlichen Lebens", und auch als Wirtschaftsfaktor: "Allein in Lecce waren 1754 insgesamt 20 Klöster angesiedelt." Überdeutlich wird bei Samerski, wer die dominanten und zugleich die primär erfolgreichen Interessenten im Vor- und Umfeld der Kanonisationsverfahren waren, und gerade das Schlußkapitel über die finanzielle Seite der Sache ("Non olet") zeigt es: die gleichermaßen finanzkräftigen wie für die Mobilisierung der Spendenfreudigkeit organisatorisch gerüsteten Orden, zumal die "zentral organisierten Großorden" wie die (bei Samerski gesondert gewürdigten) Jesuiten.
Die Kanonisationsverfahren - im römischen Zentrum und unter den Augen des Papstes - offerieren den Orden ein geradezu ideales Feld für den Wettbewerb um kirchenoffizielle Anerkennung. Bei Samerski ist solcher Wettbewerb nicht übersehen, er ist aber als zentrale Interessenkonstellation, die, wie man als Soziologe doch vermuten möchte, die Verfahren antreibt und mit dem nötigen langen Atem ausstattet, kaum gewürdigt. Wie funktioniert etwa der spezifische, bürokratisch hochgerüstete Lobbyismus, welcher im frommen Volk die Berichte anregt und eintreibt, die dokumentieren, daß die Fürsprache des heiligzusprechenden Kandidaten "erfolgreich" gewesen sei? Aufschlußreiche Fragen wie diese bleiben bedauerlicherweise unterbelichtet. Dabei ist der Legitimitätszugewinn, wie ihn jede päpstliche Approbation eines (weiteren) Heiligen aus den eigenen Reihen der betreffenden Institution beschert, unübersehbar.
Schließlich: Sieht man von den erwähnten Zeiten einer von höchster Stelle aus betriebenen Inflation ab, so dürfte die Ordenskonkurrenz gerade an der Verknappung des Zugangs zur Ehre der Altäre maßgeblich beteiligt gewesen sein; in der Ritenkongregation selbst waren die Orden ja über die theologischen Konsultoren, die sie stellten, vertreten. Und ein nicht geringer Teil der hartnäckigen Lebensdauer so vieler Causen dürfte, wenn ich Samerski und das von ihm ausgebreitete Material recht verstehe, auf das Konto der wechselseitigen Ordensobstruktionen gehen.
HARTMANN TYRELL
Stefan Samerski: "Wie im Himmel, so auf Erden?" Selig- und Heiligsprechung in der katholischen Kirche 1740 bis 1870. Münchener Kirchenhistorische Studien, Band 10. W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2002. 512 S., geb., 50, - [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Selig- und Heiligsprechungen sind nicht nur Himmelsangelegenheiten, soviel ist dem mit "V.C" zeichnenden Rezensenten nach der Lektüre von Stefan Samerskis Studie klar. Zu seiner Beleuchtung der "neuzeitlichen Kanonisationspolitik in ihrer Programmatik und ihren zeitbedingten Voraussetzungen" stütze sich Samerski auf bisher unausgewertetes, auch außerrömisches Quellenmaterial, und mache deutlich, dass die vom Kanonisten Prospero Lambertini 1740 erschaffene "Rechtstheorie und Praxis der Selig- und Heiligsprechungsverfahren" auch heute noch gelte, dass sie jedoch immer geschichtlich bedingte, unterschiedliche Anwendungen gefunden habe. Besonders hat dem Rezensenten die Auseinandersetzung mit der Kanonisationspolitik von Papst Pius IX. gefallen. Es bleiben für den Rezensenten zwar einige Fragen offen, etwa die "Kriterien von Wundern", aber mit dieser Studie, die der Rezensent als "gelungene Verbindung von wissenschaftlicher Darstellung und Leserfreundlichkeit" lobt, habe Samerski die "Heiligenindustrie" aus dem Himmel auf den diesseitigen Boden der Tatsachen zurückgeholt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH