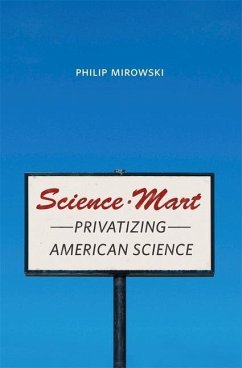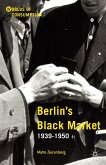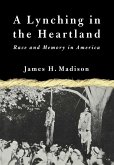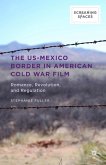This trenchant study analyzes the rise and decline in the quality and format of science in America since World War II. Science-Mart attributes this decline to a powerful neoliberal ideology in the 1980s which saw the fruits of scientific investigation as commodities that could be monetized, rather than as a public good.

Im neuen Reich der Patente und Lizenzen: Philip Mirowski unterzieht die Ökonomisierung wissenschaftlicher Forschung einer ebenso temperamentvollen wie fundierten Kritik
Die Frage nach dem Zusammenspiel von wissenschaftlicher Neugier und wirtschaftlichem Nutzen entzieht sich einfachen Antworten. Nachdem die staatliche Förderung von Wissenschaft lange selbstverständlich war und die Vorstellung herrschte, Investitionen in die Grundlagenforschung zahlten sich langfristig auch wirtschaftlich aus, ist das Pendel vor allem in den Vereinigten Staaten inzwischen in die andere Richtung ausgeschlagen. Der Markt gilt nun tendenziell als zuverlässiger Indikator für die Auswahl von Forschungsfragen und soll angemessene Anreize für Wissenschaftler bieten können. Diese Tendenz löst zwar immer noch Unbehagen aus, prägt aber bereits die globale Wissenschaftslandschaft. Philip Mirowski bringt als Wirtschaftswissenschaftler und Wissenschaftshistoriker eine exzellente Kombination von Kompetenzen mit, um diese Ausrichtung von Wissenschaft und Universität an ökonomischen Leitlinien kritisch zu beleuchten. Ihm ist mit seinem Buch eine provokante, temperamentvolle und gleichwohl fundierte Kritik kommerzialisierter Wissenschaft und ihrer neoliberalen Apologeten gelungen.
Mirowski sieht die Privatisierung wissenschaftlicher Forschung als Merkmal eines Syndroms, das den Westen, ausgehend von den Vereinigten Staaten, ungefähr 1980 zu erfassen begann: Unternehmen, Handel und öffentliche Institutionen, sogar das Militär, wurden neoliberalen Reformen unterworfen. Der Markt könne viele Aufgaben eben besser erledigen als zähe Bürokraten. Diese Privatisierungswelle machte vor den Universitäten nicht halt. In den Vereinigten Staaten spielte dabei der Bayh-Dole-Act eine entscheidende Rolle: Er erlaubte es Universitäten, mit öffentlichen Mitteln geförderte Forschung patentieren zu lassen und somit Wissen zu privatisieren. Diese Kommerzialisierung der Wissenschaft löste das Wissensregime des Kalten Krieges ab, das auf der massiven staatlichen Förderung der Grundlagenforschung beruhte - die dann vom privaten Sektor in innovative Produkte umgemünzt werden sollte. Ergänzt wurde die staatliche Förderung durch große Industrielabors wie die Bell Labs von AT&T, in denen nobelpreiswürdige Forschung betrieben wurde.
Im neuen Regime wird dagegen das Wissen zu Ware und auf dem Markt gehandelt. Die neoliberalen Theoretiker dieses Umbruches behaupten, der Markt sei ein optimaler Informationsverarbeiter und daher bestens geeignet, Signale für neue Bedürfnisse auszusenden und neu erlangtes Wissen effizient in innovative Produkte umzusetzen.
Die Umbrüche, die Universitäten oder angesehene Forschungslabors von Unternehmen seit den achtziger Jahren durchmachen, mag man bedauern. Aber sollten sie sich nicht auch als unumgängliche und letztlich innovationsfördernde Anpassungen an die Globalisierung begreifen lassen? Mirowski sieht diese Hoffnung enttäuscht: Durch das neue globalisierte und privatisierte Wissensregime würden Innovationen nicht gefördert.
Besondere Aufmerksamkeit widmet der Autor dabei der Pharmaindustrie, die eine der treibenden Kräfte hinter der sogenannten "Biotech-Revolution" ist, welche seit dreißig Jahren verspricht, mit neuen Geschäfts- und Forschungsmodellen die Entwicklung von Medikamenten umzuwälzen. Ein Versprechen, das bisher uneingelöst blieb: In diesen drei Jahrzehnten wurde nur eine Handvoll von neuartigen Präparaten auf den Markt gebracht.
Besonders folgenreich sind für Mirowski die Ausweitung intellektueller Eigentumsrechte und die Auslagerung wichtiger Funktionen an Drittunternehmen. Zum Ausdruck kommt darin eine Sicht, die das Ideal von Wissen als Gemeingut ersetzt durch Patente, Lizenzen oder die im Forschungsalltag inzwischen allgegenwärtigen "Material Transfer Agreements", die den Austausch von Forschungsmaterialien regulieren und ihren Gebrauch oft beträchtlich einschränken.
Die aus universitärer Forschung entstandenen Biotech-Unternehmen überleben zudem oft nur kurz. Ihre Existenzberechtigung erschöpft sich meist in der Lieferung von einigen wenigen Molekülen, deren Weiterentwicklung lohnenswert erscheint, und in der Entwicklung von Forschungswerkzeugen - standardisierten Zellen, Geweben, Organismen -, die sich patentieren und lizenzieren lassen. Nach einigen Jahren werden diese Start-ups meist von einem der global agierenden Pharmagiganten geschluckt.
Die großen Unternehmen haben auch einem weiteren neuen Spieler auf dem Feld der Medikamentenentwicklung die Teilnahme ermöglicht: Auftragsforschungsinstitute erledigen heute einen großen Anteil der mehrphasigen klinischen Versuche, die der Zulassung neuer Medikamente vorangehen müssen. Diese Unternehmen agieren billiger und schneller als universitäre Einrichtungen und bieten noch weitere Vorteile. Mit ihnen lässt sich beispielsweise regulatorische Arbitrage betreiben: Klinische Versuche werden in Länder Lateinamerikas oder Osteuropas verlegt, in denen sie einfacher und billiger durchzuführen sind als in den Vereinigten Staaten oder Westeuropa. Darüber hinaus zeichnet sich Auftragsforschung nicht durch übermäßige Wissbegier aus. Es genügt schließlich, die Daten termingerecht beim Auftraggeber abzuliefern.
Wie beeinflusst dieses System Inhalte und Qualität der Forschung? Die Fokussierung auf molekulare Mechanismen und die nur minimale Begleitung der klinischen Versuche begünstigen eine reduktionistische Sicht auf Erkrankungen und blenden andere wichtige ätiologische Faktoren aus. Aber auch grundlagenorientierte Großforschungsprojekte können unter der Privatisierung leiden: Der Wettstreit zwischen Craig Venters Unternehmen Celera und dem öffentlichen Humangenom-Konsortium führte nicht zu besserer, sondern nur zu schnellerer Wissenschaft. Das im Jahr 2000 der Öffentlichkeit mit großem Medienspektakel vorgestellte Genom war lückenhaft und voller Fehler. Die aufwendigere, aber viel zuverlässigere Methode des öffentlichen Konsortiums, die unter dem Druck von Celera aufgegeben wurde, hätte zu einem weitaus verlässlicheren Endergebnis geführt.
Mirowskis Buch führt die grundsätzliche Schwäche ökonomischer Modelle der Wissenschaft vor Augen: Die Theorien vom "Marktplatz der Ideen" oder vom Markt als optimaler Instanz der Informationsverarbeitung beruhen oft mehr auf ideologisch motivierten Grundannahmen als auf empirischer Analyse tatsächlicher Verhältnisse in ihrem historischen Kontext. Mirowski ist kein schlichter Nostalgiker, der sich in eine goldene Zeit der freien Wissenschaft zurücksehnt. Sein Buch zeigt überzeugend, dass die Innovationsfähigkeit moderner Gesellschaften vor allem von einer soliden und beständigen institutionellen Wissenschaftsinfrastruktur abhängt, die nur unter entschiedener Teilnahme der öffentlichen Sphäre gedeihen kann.
THOMAS WEBER
Philip Mirowski: "Science-Mart". Privatizing American Science.
Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2011. 454 S., geb., 29,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
An important and intensely provocative book that explores fundamental questions about the political economy of science. Science-Mart challenges us to think more critically, more synthetically and more deeply about the growing commercialization of academic science by exploring the historical and ideological roots of that trend... Mirowski debunks the popular view that there is a linear, lockstep path leading from science and technology to economic growth, a claim that served as the mantra of those urging passage of the Bayh-Dole Act of 1980... Mirowski has shown that a political economist can bring significant new insights to the discussion of academic marketphilia.
-- Sheldon Krimsky American Scientist
Historian and economist Mirowski presents a thoroughly researched and sure-to-be-controversial view of the economic and political influences on science policy in post-WW II America. The author traces the commoditization of science in the US-a shift from the Cold War funding by government and military entities to the present dominance of funding by for-profit corporations-making modern American science just another product in the mammoth economy.
-- T. Timmons Choice
Eminently thought-provoking, this book places the contemporary economics of science in a context that combines political economy and intellectual history. A deeply impressive work that contributes to crucial debates. Mirowski never shies away from controversy and presents his case clearly and persuasively in an effective, engaging, and humorous style.
-- Donald MacKenzie, author of An Engine, Not a Camera: How Financial Models Shape Markets
Science-Mart is timely and important in a sense that goes beyond a specialist contribution. Mirowski's wide-ranging research addresses a dazzling array of topics, which he situates historically and fuses into a compelling critique that will fascinate any reader concerned with the economic and social dimensions of modern science and technology.
-- Theodore M. Porter, author of Karl Pearson: The Scientific Life in a Statistical Age
-- Sheldon Krimsky American Scientist
Historian and economist Mirowski presents a thoroughly researched and sure-to-be-controversial view of the economic and political influences on science policy in post-WW II America. The author traces the commoditization of science in the US-a shift from the Cold War funding by government and military entities to the present dominance of funding by for-profit corporations-making modern American science just another product in the mammoth economy.
-- T. Timmons Choice
Eminently thought-provoking, this book places the contemporary economics of science in a context that combines political economy and intellectual history. A deeply impressive work that contributes to crucial debates. Mirowski never shies away from controversy and presents his case clearly and persuasively in an effective, engaging, and humorous style.
-- Donald MacKenzie, author of An Engine, Not a Camera: How Financial Models Shape Markets
Science-Mart is timely and important in a sense that goes beyond a specialist contribution. Mirowski's wide-ranging research addresses a dazzling array of topics, which he situates historically and fuses into a compelling critique that will fascinate any reader concerned with the economic and social dimensions of modern science and technology.
-- Theodore M. Porter, author of Karl Pearson: The Scientific Life in a Statistical Age