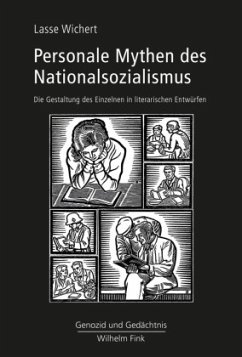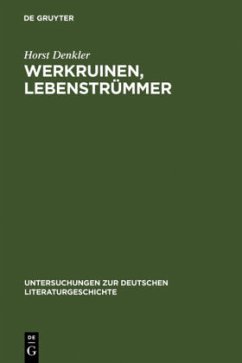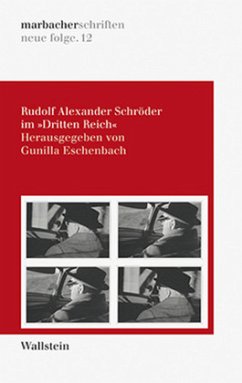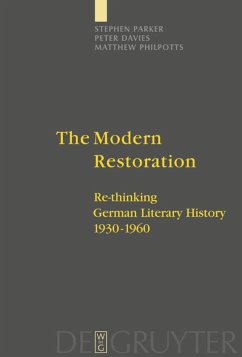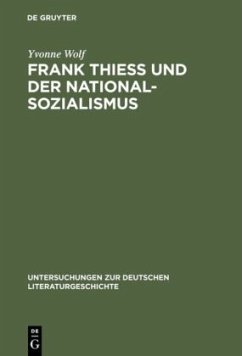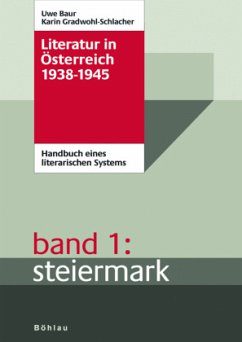überspitzt war Thomas Manns Wort aus dem Jahr 1945: "In meinen Augen sind Bücher, die von 1933 bis 1945 in Deutschland gedruckt werden konnten, weniger als wertlos . . . Ein Geruch von Blut und Schande haftet ihnen an. Sie sollten alle eingestampft werden" (überspitzt schon deshalb, weil die beiden ersten Bände seiner Tetralogie "Joseph und seine Brüder" noch 1933/34 bei S. Fischer erscheinen konnten). Andererseits überboten sich Schriftsteller nach 1933 in einem makabren Tanz von Anpassung, Akklamation, Anbiederung und Kollaboration.
Manche, wie Gottfried Benn, der die Sektion für Dichtung der Preußischen Akademie der Künste mit seiner Ergebenheitsadresse auf den neuen Kurs einzuschwören suchte, spürten rasch Gegenwind und wurden bald belehrt, wie wenig ihr dichterisches Werk der "neuen Zeit" noch genehm war. Aber immer ein Ruhmesblatt bleibt der Brief, mit dem die tapfere Ricarda Huch am 9. April 1933 ihren Austritt aus der gleichgeschalteten Sektion erklärte.
In dem schillernden Spektrum zwischen kritischer Haltung, politischer Indifferenz, Mitläufertum und dem Zelotentum der Parteibarden ist, unter den Bedingungen einer Unfreiheit der Literatur, fast ein jeder Schriftsteller ein Fall für sich, ein Bündel von Brüchen und Widersprüchen. Ihnen auf die Spur zu kommen, hilft das biographische Lexikon des Insel Verlags, das zuerst im Jahr 2000 erschien und nun - unter Verzicht auf einige Autoren - in einer stark erweiterten und auf den neuesten Stand der Forschung gebrachten Fassung vorliegt: "Schriftsteller im Nationalsozialismus".
Die Herausgeber, Hans Sarkowicz und Alf Mentzer, zeichnen in ihrer Einleitung die Stationen der Literaturpolitik im "Dritten Reich" nach: Dem Austritt aus dem internationalen PEN folgte im November 1933 die Eröffnung der "Reichskulturkammer" mit den verschiedenen Sektionen durch Goebbels, der 1938 auch reguläre "Weimarer Dichtertreffen" organisieren ließ; seine Gründung der "Europäischen Schriftstellervereinigung" (mit Hans Carossa an der Spitze) erlitt rasch Schiffbruch.
Wenig Zukunft beschieden war auch Weiheveranstaltungen nach dem Muster des germanischen Thingspiels, die dem Geist von Alfred Rosenbergs "Mythus des 20. Jahrhunderts" entsprachen. Wenig Rühmliches wissen die Herausgeber über den "Börsenverein der deutschen Buchhändler" zu berichten. Erstaunlich lange hielt sich zwar, wie Volker Dahm gezeigt hat, das jüdische Buch im "Dritten Reich", nämlich bis 1938. Peinlich aber waren die Anbiederungen des Börsenvereins. Zum "Raffke" unter den Verlagen entwickelte sich der Verlagskonzern der NSDAP mit seinen siebzig Unternehmen.
Den Herausgebern die Grenzen ihres biographischen Lexikons vorzuwerfen, wäre unfair - sie gestehen sie selbst ein. Bruchstückhaft noch sind unsere Kenntnisse über die Wirkungsgeschichte der Literatur im "Dritten Reich" (jenseits der Propaganda), ihre Rolle für die Gefühls- und Handlungsweisen der Leser. Wie entwickelte sich das kulturelle Bewusstsein der ersten Nachkriegsgeneration, deren "literarische Sozialisation von Lehrplänen und Lesestoffen bestimmt wurde, die eindeutig die bekannten Schriftsteller aus der NS-Zeit bevorzugten? Einen Leitfaden durch die literaturwissenschaftliche Forschung bieten Namen von Gewährsleuten der Herausgeber: so Jan-Pieter Barbian (Literaturpolitik im NS-Staat), Uwe-Karsten Ketelsen (Drama und Theater), Joseph Wulf (Künste), Ralf Schnell (Deutsche Literatur und Faschismus), Denkler und Prümm (Themen, Traditionen, Wirkungen), Hans Dieter Schäfer (Gespaltenes Bewusstsein).
Die einhundertfünfundfünfzig Biographien des Bandes vermitteln rasche Orientierung über die Lebensgeschichte der Schriftsteller, ihr Werk, die Taktik der Begeisterten, der Wendehälse und der grauen Mäuse. Zu den Regimekritikern zählen die Herausgeber den klug taktierenden, aber unerweichlichen Ernst Jünger, den im letzten Augenblick einem Prozess entgehenden Reinhold Schneider und den hingerichteten Albrecht Haushofer.
Fast unglaublich, in welchem Maße Parteidichter nach dem Krieg neu gedruckt werden konnten und Gerhard Schumann, einst Hauptabteilungsleiter des Kulturamts der SS, mit seinem Hohenstaufen-Verlag der völkischen Literatur neben dem alten ein neues Publikum verschaffte. Dieses biographische Lexikon kann kein Loblied auf die Demokratisierung des literarischen Lebens nach dem Kriege singen. Im Ganzen: Es ist - mehr noch als die erste Fassung - als Nachschlagewerk unentbehrlich.
Wer einmal ins Blättern kommt, erlebt die Verführung eines literaturgeschichtlichen Mosaiks. Den in die Preußische Akademie der Künste gewählten jüdischen Dichter Alfred Mombert, den Verkünder einer neuen Weltharmonie, deportierten die Nazis 1940 in ein südfranzösischen Internierungslager, von wo aus ihn 1941 der Schweizer Mäzen Hans Reinhardt freikaufen konnte. Sein Akademiekollege Ludwig Fulda (Anton Salomon), der meistgespielte deutsche Bühnenautor, wählte nach unaufhörlichen Demütigungen 1939 in Berlin den Freitod. Der österreichische Schriftsteller Franz Tumler, der den "Anschluss" Österreichs und dann den Einmarsch von Hitlers Truppen ins Sudetenland gleich mit drei Propagandaschriften begleitet hatte, suchte keine Ausflüchte und ging in "Jahrgang 1912" mit seiner "Blindheit" und seinem "Versagen" ins Gericht (1967).
Antwort findet, wer fragt, was der Hamburger Schriftsteller Hans Leip, der Dichter des sentimentalen Soldatenlieds "Lili Marleen", das abends über die Fronten hinweg an die Sehnsüchte aller Landser rührte und zum "Weltschlager" wurde, eigentlich sonst noch geschrieben hat. Dieses verbesserte Lexikon glänzt nicht mit essayistischen Autorenporträts, aber es schafft in hundertfünfundfünfzig Einzelansichten Klarheit über eine dunkle Epoche der deutschen Literatur.
WALTER HINCK
Hans Sarkowicz, Alf Mentzer: "Schriftsteller im Nationalsozialismus". Ein Lexikon.
Insel Verlag, Berlin 2011. 676 S., geb., 48,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
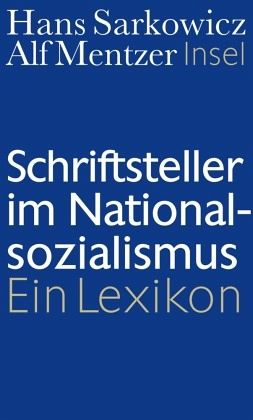





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.02.2012
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.02.2012