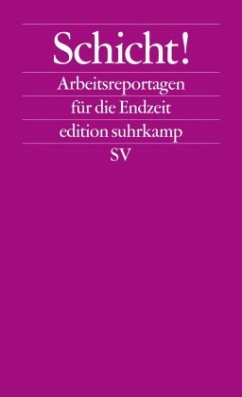Arbeit gab es nicht von Anfang an, sondern erst seit der Ausquartierung aus dem Paradies. Entsprechend muß man die Historie der Arbeit insgesamt als große ABM-Initiative sehen, der irgendwann die Evaluation ins Haus steht. Und wirklich treffen aus der ferneren Zukunft Botschaften ein, in denen eine Kommission behauptet, von höchster Warte mit einer finalen, alle Erdteile und Phasen einschließenden Begutachtung der Arbeitswelt betraut worden zu sein - als Grundlage für die Entscheidung, ob und wie es damit weitergehen soll. Sie bittet Schriftsteller, Expeditionen in die Arbeitswelt der Gegenwart zu unternehmen. Und diese geben Antwort: von Großkonzernen, Online-Sexportalen und Bestattungsinstituten, von Ziegenhirten, Superköchen und moderner Bettelei. Aus der Wirklichkeit des Jahres 2006 berichten Bernd Cailloux, Dietmar Dath, Felix Ensslin, Wilhelm Genazino, Peter Glaser, Gabriele Goettle, Thomas Kapielski, Georg Klein, Harriet Köhler, André Kubiczek, Thomas Raab, Kathrin Röggla, Oliver Maria Schmitt, Jörg Schröder und Barbara Kalender, Josef Winkler, Feridun Zaimoglu und Juli Zeh.

Glück und Absturz: Das Buch "Schicht!" erzählt von deutschen Verhältnissen
Von Ulrich Peltzer
Zackenkurven, Limits, Indizes. Auf ein paar ausgedruckten Blättern stellen Grafiken in Rot und Grün Umsätze, Kurse und Gefahrenzonen dar. Hier der Rohstoffhandel, hier die Derivate, hier die aktuelle Entwicklung der wichtigsten Wertpapierbörsen. "Wenn Sie so wollen", sagt Herr Doktor A., "entscheide ich, wann die Notbremse gezogen wird." Er leitet die Abteilung Risk Management einer großen Privatbank und hat uns in seinem hellen, unaufwendig möblierten Büro für ein Gespräch über seinen Arbeitsalltag empfangen. Es handelt sich um die Recherche zu einem Spielfilm, und neben Doktor A. haben sich eine Reihe anderer Vorstände und hochrangiger Bankmitarbeiter relativ rasch bereit erklärt, auf Fragen persönlich zu antworten.
Die Bank sei gut aufgestellt, sagt A., als die Rede auf die Krise am US-Hypothekenmarkt kommt, man habe sich in diesem Segment wegen der Undurchschaubarkeit der Produkte, sogenannter Collateralized Debt Obligations, praktisch nicht engagiert, und fügt dann lächelnd hinzu, dass Habgier noch nie ein guter Ratgeber gewesen sei. Infolgedessen sehe er die Krise, die im Kontext steigender Ölpreise und eines abstürzenden Dollars weiter eskalieren werde, als eine Art von reinigendem Gewitter, von dem diejenigen am härtesten betroffen sein würden, die in den letzten Jahren wider alle Vernunft gekauft hätten, was nicht niet- und nagelfest ist. Er macht den Eindruck eines Mannes, der seinen Job souverän beherrscht und nicht auf jeden fahrenden Zug nur deshalb schon aufspringt, weil es die meisten Kollegen tun. Herr Doktor A. verdient eine Million Euro per annum, zuzüglich eines am Ertrag orientierten Bonus.
Als wir einige Tage später auf der nächtlichen Rückfahrt irgendwo in Thüringen an einer Raststätte halten, sind wir die einzigen Gäste in diesem Systemgastronomienirwana, außer C. und mir ist allein noch eine Tresenkraft auf den Beinen. Eine etwa vierzigjährige Frau in einem weißen Kittel, müde und abgekämpft hinter den Zapfhähnen und Gläserbatterien. Als sie hört, woher wir kommen und was wir in Frankfurt gemacht haben, erzählt sie uns ein wenig von ihrer Arbeit und auf unsere Nachfrage hin, dass ihr Stundenlohn knapp fünf Euro betrage, das sind, rechnen wir im Auto nach, ungefähr 800 Euro brutto im Monat, also etwas mehr als der Hartz-IV-Satz für eine knochenaufreibende Tätigkeit, eingerechnet den Nachtzuschlag. Was kann man sich dafür kaufen, wohin fährt man davon in Urlaub? So banal solche Fragen sein mögen, so niederschmetternd sind die Antworten: In Urlaub fährt man nicht, und kaufen lässt sich mit dem Geld bloß das, was man unbedingt zum Leben braucht, die schieren Reproduktionskosten eines menschlichen Körpers in einem der reichsten Länder der Erde.
Diese Frau zu den working poor zu zählen ist das eine, das andere die Tatsache, dass sie weit mehr als hundert Jahre am Stück Nachtschicht schieben müsste, um in der Summe das Jahressalär von Doktor A. zu erreichen, konkret: Sie hätte zur Zeit der Reichsgründung anfangen müssen zu arbeiten, hätte ohne Pause durch zwei Weltkriege, die deutsche Teilung und Wiedervereinigung hindurch bis zum heutigen Tag in einer Thüringer Autobahnraststätte stehen müssen, um auf die Million plus Bonus zu kommen, die zur Grundausstattung eines sehr sympathischen Risk Managers gehören. Ob die Relationen früher anders waren (und mit früher meine ich die im Rückblick goldenen Jahre des sozialpartnerschaftlichen Konsens der alten BRD), braucht uns nicht zu interessieren, sondern allein das Factum brutum eines Bewertungsmaßstabes von Arbeit, der sich offenbar von jeder Form gesellschaftlicher Vernunft verabschiedet hat. Sofern man überhaupt noch die Tätigkeiten einer Tresenkraft und eines Bankvorstands unter der gleichen Kategorie subsumieren will.
Wie - die Frage stellte sich dem Herausgeber des Bandes "Schicht!", Johannes Ullmaier - würde man einem Besucher aus der Zukunft die Verhältnisse erklären? Wie könnte man ihm einen Begriff davon vermitteln, was heute Arbeit bedeutet und welchen Transformationen sie seit den achtziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts unterworfen ist? Im Besonderen, dass Erwerbsbiographien sich auflösen in eine Folge temporärer Beschäftigungen zu den unterschiedlichsten Bedingungen, sich halbe Stellen und 3/8- Jobs abwechseln mit erzwungener Selbständigkeit in prekären Projekten, Leasingagenturen und Schattenwirtschaft ein profitables Bündnis eingegangen sind. Wer einen Beruf hat, kann sich schon längst nicht mehr darauf verlassen, ihn bis zur Rente auszuüben, immer rasanter entwickelt sich die Suche nach ökonomischen Nischen und unkonventionellen Dienstleistungsangeboten zu einer Art von Breitensport; mittlerweile allerdings vor dem Hintergrund einer Einkommens- und Vermögensverteilung, die laut Jahresgutachten des Instituts der deutschen Wirtschaft einen Grad der Ungleichheit angenommen hat, den man bislang nur aus Lateinamerika kannte: die zehn Prozent an der Spitze der Statistik verfügen über mehr als sechzig Prozent des Reichtums in Deutschland, die unteren fünfzig teilen sich die Schulden.
Soweit der Rahmen, die Praxis hieß für Ullmaier Feldforschung. Hieß, sechzehn Schriftsteller zu beauftragen, Erkundigungen über Arbeitswirklichkeiten einzuziehen für einen Bericht in die Zukunft. Aufzuklären über den Stand der Dinge an den Rändern der Gesellschaft.
Es sind Reportagen aus Gegenden, in die man gewöhnlich nicht vorstößt, abgelegene Zonen des Geldverdienens, die von ebenso viel Einfallsreichtum wie Skurrilität zeugen. So begleitet Thomas Raab den Chef der Berliner Firma "Sarg-Rabatt" zu einer Fahrt mit potentiellen Kunden zum Krematorium im tschechischen Chomutov, Gabriele Goettle besucht einen Ziegenhirten im Havelland, Wilhelm Genazino denkt über Optimierungsstrategien beim Betteln in Fußgängerzonen nach, Feridun Zaimoglu lässt sich vom Betreiber einer Internet-Peepshow die Modalitäten des Cybersexgeschäfts erläutern, und Kathrin Röggla berichtet aus dem Alltag von Schuldnerberatungen in Berlin und Los Angeles. Man will es genau wissen, und man erfährt es genau. Den von Jörg Schröder und Barbara Kalender aufgezeichneten Weg des DDR-Zöllners Sascha vom Grenzregime in Zinnwald zum schlechtbezahlten Speditionsmitarbeiter in Dresden, die Schufterei in der Küche eines Sternerestaurants in Harriet Köhlers Porträt eines 17-jährigen Kochlehrlings oder das Phantasma einer verstrahlten Zukunft in einer ebenso verstrahlten Erzählung Dietmar Daths. Ihnen allen gemeinsam ist die Genauigkeit des Blicks auf Verhältnisse, die zum Tanzen zu bringen (wie man früher so metaphernselig sagte) ein völlig aussichtsloses Unternehmen zu sein scheint, auf individuelle Strategien des Überlebens und die ständig drohenden Gefahren des Untergangs in einem globalisierten postfordistischen Kosmos, dessen Zusammenhalt in der Hauptsache dadurch gewährleistet wird, dass niemand mehr auch nur die Zeit hat, über Alternativen nachzudenken. Zumindest niemand von denen, die noch irgendwo arbeiten oder mit ihren Kontotiefstständen so viel zu tun haben, dass kein Raum bleibt fürs Spekulieren auf solidarisches Handeln. Schon das Wort. Als ginge es nicht bereits seit langem ausschließlich um etwas anderes, Träume, die sich allein mit barer Münze realisieren lassen, ums Klimpergeld, das einem für ein oder zwei Wochen die Flucht aus einer kruden Gegenwart gestattet, all incentive.
So wurschtelt die Mehrheitsgesellschaft vor sich hin, mal mehr, mal weniger listenreich, hin und her schwankend zwischen kleinem Glück und finalem Absturz ins Getto der Überschuldung. Zwischen ein paar schwarz dazuverdienten Euro und den peinlichen Aufräumarbeiten im Kreis von Schicksalsgenossen. Kathrin Rögglas Inspektionsreise zu den Beratungsstellen für Kreditopfer erzählt uns davon in eindrücklicher Weise, von den alltäglichen Katastrophen eines Konsums, dessen Versprechungen man erliegt, ohne sie sich im Entferntesten leisten zu können. Viel mehr als der Rat zum Verzicht fällt einem nicht ein, wohl wissend, dass Verzicht keine Lösung ist, wenn er nicht alle in gleichem Maße betrifft. Und es funktioniert doch, kein Zeichen von Rebellion am Horizont. Als würde der persuit of happiness der erste Artikel des Grundgesetzes sein und jeder ihm glauben.
Der Untertitel des Buches lautet "Reportagen für die Endzeit", folglich sei die Frage erlaubt, was mit Endzeit gemeint sein soll. Oder für wen sie etwa angebrochen ist. Für Herrn Doktor A., für die Büfettkraft in einer Autobahnraststätte oder für uns alle? Und was dann? Dass es nicht so weitergehen kann wie bisher, ist eine Binsenweisheit seit der Erfindung der Dampfmaschine, dass es trotzdem immer weitergeht, der Regelfall nach jeder Krise. Obwohl es einem stets so vorkommt, jetzt wäre der Punkt erreicht, an dem das Ganze auseinanderfliegt. Der Moment, da sich die Peripherie so weit vom Zentrum entfernt hat, dass keine Integration mehr möglich ist. Schlappe hunderttausend Euro im Monat gegen achthundert, eine radikal zweigeteilte Welt, selbst hierzulande. Na und? Wahrscheinlich handelt es sich um eine Frage der politischen Moral, den Begriff Endzeit mit Zweckoptimismus oder Pessimismus aufzuladen. Weder das eine noch das andere stellt eine Option dar. Die Zukunft ist und bleibt eine Frage der Praxis.
"Schicht! Arbeitsreportagen für die Endzeit". Hrsg. von Johannes Ullmaier, Suhrkamp, 411 Seiten, 12 Euro
Ulrich Peltzer, 50, ist Schriftsteller und lebt in Berlin. Zuletzt erschien von ihm der Roman "Teil der Lösung" im Ammann-Verlag.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Haben sich etwa die Konflikte ins Innere, ins Ich verlegt? Gibt es überhaupt noch das normale Schuften in der Industrie oder im Einzelhandel? Siebzehn deutsche Schriftsteller besuchen die Werktätigen der Gegenwart und beschreiben ihr Tun, ihre Erwartungen, ihren Verzicht auf ErfüllungVon Jens Bisky
Das Ende des Industriezeitalters zieht sich. Die Nachrichten aus der Welt der Eisenbahnen und fossilen Brennstoffe werden nicht weniger, und noch immer prägt die Erwerbsarbeit, die im 19. Jahrhundert ihren Siegeszug antrat, das gesellschaftliche Zusammenleben. In der Formel „S.A.A.R.T. = Schule, Ausbildung, Arbeit, Rente, Tod” hat Bastian B. vor dem Amoklauf von Emsdetten den Schrecken zusammengefasst, dem er sich ausgeliefert fühlte. Das Dasein, das ihm zugedacht war, glich in seinen Augen einer endlosen Folge gleichförmiger, zäh verstreichender Tage. Die Norm schien so sinnlos wie allmächtig.
Hätte es den Achtzehnjährigen trösten können, dass die Avantgardisten unter den Gegenwartsbeobachtern seit Jahren die letzte Stunde des Modells „S.A.A.R.T.” verkünden? Oder hätten ihn die Gegensätze vollends verwirrt? Auf der einen Seite eine Sozialpolitik, die dem Motto „Jede Arbeit ist besser als keine” folgt, auf der anderen Seite viele Studien, die belegen, dass Vollbeschäftigung eine Ausnahmezustand ist, die Rückkehr zu ihr unmöglich. Auf der einen Seite jene, die um Arbeitsplatz, Rentenanspruch und Häuschen bangen, auf der anderen Seite digitale Bohemiens, denen Festanstellung so lästig ist wie eine Grippe und die im Mangel an Sicherheit und Festgelegtsein die Wonnen von Freiheit und Selbstbestimmung entdecken.
Leider kann man dem ohnmächtig wütenden Bastian B. den Suhrkamp-Band mit „Arbeitsreportagen für die Endzeit” nicht mehr in die Hand drücken. Er heißt „Schicht!” und strahlt etwas unglaublich Beruhigendes aus: jene Abgeklärtheit, die sich immer dann einstellt, wenn man die Diskursgewitter vorüberbrausen lässt, um dann hinzuschauen, wie es denn nun tatsächlich aussieht. Die Bundeskulturstiftung hat im Rahmen ihres Programms „Arbeit in Zukunft” siebzehn Schriftsteller, von Bernd Cailloux bis Juli Zeh, um Berichte aus der Arbeitswelt gebeten. Glücklicherweise sind die „Literaturdichter” nicht der leicht albernen Vorgabe gefolgt, für ein Forschungsinstitut aus dem Jahr 2440 zu schreiben, sondern ihrem Temperament.
Und so kann man sich in eine gute Küche, eine Peepshow, zu VW, Schuldnern, einer Reitlehrerin oder Ziegenhirten führen lassen. Bunt und vielgestaltig geht es zu, man erfährt viel und wird dennoch das Gefühl nicht los, dass die verständliche Ratlosigkeit hier mehr als nötig zur Bravheit geronnen ist. Es gibt keine Chefs mehr, glaubt man nach dem ersten Blättern. Wohl noch Leute, die bestimmen, anweisen, kontrollieren, aber keine Mächtigen, gegen die man rebelliert, deren Posten man haben will. Die Arbeitenden weichen lieber aus, versuchen etwas Neues oder ziehen sich ins Innere zurück, ehe sie den Aufstand proben.
In der deutschen Literatur gibt es eine stolze Tradition der Beschreibung von Kontor, Fabrik und Büro. Gustav Freytag etwa, der mit „Soll und Haben” aus dem Jahr 1855 das deutsche Volk dort aufsuchen wollte, wo es sich in seiner Tüchtigkeit zeigte: bei der Arbeit; Siegfried Kracauer, der in „Die Angestellten” (1930) den Alltag und die Illusionen einer neuen Schicht beschrieb; die Autoren des „Bitterfelder Weges” in der DDR seit 1959 und die des „Werkkreises Literatur der Arbeitswelt” in der Bundesrepublik seit 1961.
Verglichen damit fehlt in „Schicht!” etwas. Man vermisst in diesem Band eine Geschichte, wie sie einst Günter Wallraff aus dem Gerling-Konzern zu erzählen wusste, in dem er sich als Bürobote verdingt hatte: von Hierarchien und Aufgeblasenheit, Blendern und Schleimern, von Unterwürfigkeit, Herrschsucht und Demütigungen. Die Konflikte in der heutigen Arbeitswelt scheinen, wenn man den „Literaturdichtern” vertrauen will, nicht so direkt, in der direkten Konfrontation zwischen einzelnen darstellbar zu sein. Aber irgendwo muss es Reibereien, Streit, Unzufriedenheit doch geben. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat vor kurzem seinen „Index Gute Arbeit” veröffentlicht. Nur jeder achte Beschäftigte, heißt es da, bewerte seine Arbeitssituation positiv, jeder dritte arbeite „unter miserablen Bedingungen mit hohen Belastungen und wenig Sicherheit”. Die Hälfte der Arbeitnehmer schätze die Bedingungen als mittelmäßige ein. Trotz aller Skepsis gegenüber solchen Befragungen – wer sagt schon, er verdiene genug – müssen Frust, Enttäuschungen, Angst sich schließlich irgendwo äußern.
„Manchmal denke ich, meine Sammelleidenschaft ist der Grund, weshalb ich überhaupt arbeite”, erzählt der „brave Zöllner” Sascha, der in der DDR an der tschechischen Grenze kontrollierte, Hundeführer war und nun bei einer Spedition 1350 Euro netto verdient. Er sammelt bibliophile Erotica, besitzt auch 2200 Bücher bloß zum Lesen, und aus diesem Hobby bezieht er Energie und Leidenschaft. Seine Laufbahn erscheint in dem Bericht, den Barbara Kalender und Jörg Schröder aufgezeichnet haben, eine Folge von Zufällen, Illusionen, ergriffenen Gelegenheiten. Sinn stiftet und verspricht diese Arbeit nicht.
André Kubiczek hat seinen Vater, den Geschäftsführer der LASA – Landesagentur für Struktur und Arbeit – einen Tag lang begleitet. Von 1994 bis 2006 hat die Agentur immerhin 2 Milliarden Euro an Fördermitteln verteilt, 900 000 Brandenburger profitierten irgendwie davon. Bald geht der Vater, hochqualifiziert, unter de-Maizière Staatssekretär im letzten Außenministerium der DDR, in Rente. Er ist erleichtert. Spaß habe die Arbeit in den vergangenen Jahren „eigentlich nicht” gemacht.
Die verhaltene Resignation, der Verzicht auf Erfüllung durch Arbeit, die doch gewaltig viel Lebenszeit verschlingt, berührt. Diese Geschichten bestätigen jedes Vorurteil gegen Festanstellung, und das, obwohl ihre Helden aus der Welt des Sozialismus stammen, in der alles um den Arbeitsplatz herum organisiert war, dieser die Sonne der Existenz sein sollte.
Das scheint Arbeit in „X-ow” zu sein, wo Juli Zeh ein lesbisches Pärchen besuchte, das sich um Pferde kümmert und, fernab von allen staatlichen Einrichtungen, in die örtliche Tauschwirtschaft gut eingebunden ist. „Die Tauschgesellschaft hält jeden auf Achse, verlangt Erfindungsreichtum, Fleiß und vor allem hohe soziale Kommunikationsfähigkeit. . . Wer weiß, vielleicht hat ein Gelegenheitstraktorfahrer aus X-ow in Wahrheit weniger Sinnprobleme als ein Jungmanager an der Frankfurter Börse.” Sollte in dem, was Marx verächtlich die „Idiotie des Landlebens” nannte, Neues entstehen oder eine begrenzte, jeden Augenblick gefährdete Idylle? Wenn man älter wird, ist die körperliche Belastung beim Reiten und Pferdepflegen sehr groß. Und zumindest bei den Ziegenhirten, über die Gabriele Goettle berichtet, herrscht eine „vollkommene Zwangssituation”. Keiner darf ausfallen.
Die Konflikte der Arbeitswelt, so sieht es aus, haben sich ins Innere verlegt, werden im Ich ausgetragen, das Einsätze und Risiken kontrollieren, mit den Erwartungen der Umwelt – und nicht zuletzt mit den vielen Meinungen über Arbeit, prekäre Existenzen und Leistung – klar kommen muss. Selbst der Zukunftsforscher bei VW wirkt wie ein Unternehmer seines Lebens. Erwartungen hat man an staatliches Handeln, kaum an Arbeitgeber und Eigentümer.
Das ist es, was dann an dieser Sammlung von Arbeitsreportagen verstört: Auf der Suche nach dem Neuen, dem Außergewöhnlichen – große Thesen im Ohr, Einzelfälle fest im Blick – wird die „normale” Arbeitswelt nahezu vollständig ausgeblendet. Noch arbeiten in Deutschland Millionen in der Industrie, im öffentlichen Dienst, schuften im Einzelhandel. Soll man deren Welt vergessen, nur weil sie überholt scheint? Ist darüber in klassischen Arbeitsreportagen wirklich schon alles gesagt?
Der Soziologe Berthold Vogel hat in einem hellsichtigen, den Kopf befreienden Essay über „Die Staatsbedürftigkeit der Gesellschaft” (Hamburger Edition, 12 Euro) mit guten Gründen behauptet, der öffentliche Dienst spiele – weitgehend unbemerkt – eine „Vorreiterrolle im Wandel”, er sei zum „Protagonisten einer unsicheren und brüchigen Arbeitswelt” geworden: dank kontinuierlichem Personalabbau, der Verlängerung der Arbeitszeiten, verbunden mit Zeitnot und Arbeitsverdichtung, verdeckten Lohnsenkungen und der „Durchsetzung flexiblerer und ungeschützterer Arbeitsbedingungen”. Nichts gegen digitale Bohemiens und Internetpeepshowanbieter – aber aufregend Neues, kulturell Prägendes geschieht derzeit auch und gerade an den klassischen Arbeitsplätzen, nicht jenseits von ihnen. Darüber verrät der Suhrkamp-Band arg wenig.
Im seinem Prunk- und Glanzstück aber, einer Reportage, die ins Schulbuch gehört, wird der Leser entschädigt. Wilhelm Genazino beobachtet Bettler und die Reaktionen der Angebettelten, bei denen er oft „eine gewisse, in der Regel verheimlichte Sympathie für die Härte des staatlichen Durchgreifens” spürt. Zum erfolgreichen Betteln gehöre Demut, weshalb die meisten Tätowierten und Gepiercten leer ausgehen. Zu viel Demut aber stößt ab. Auch müsse die Kleidung zur Umgebung passen. Das Bewusstsein, nur vorübergehend zu betteln, ist von Vorteil. Erfolgreich ist, wer davon absehen kann, „dass er in Bedrängnis ist”, und dies auch ausstrahlt. Bettler, so Genazino, müssten lernen, etwas vorzuführen, „Anschluss an die herrschende Stimmung zu finden”. Der Spender gebe, weil er sich in die Lage des Bettlers versetze, seine Gabe sei Zeichen ausgelebter Dankbarkeit für die „glücklich abgewendete Katastrophe”. Da die meisten Bettler unfähig scheinen, schlägt Genazino die Einrichtung von Bettlerschulen vor, die freilich nicht ins Selbstbild der Republik passen: „Lieber gewöhnen wir uns an schlecht ausgebildete Bettler und quälen sie mit hilflosen Unterschichtdebatten.”
Auf diese Weise, genau beobachtend, mitfühlend, aber nicht sentimental ergriffen, wünschte man sich den Kern der veränderten Arbeitswelt einmal beschrieben: mit ausgelagerten Konflikten, prekären Arbeitsbedingungen, wachsendem Druck, verbunden mit hoher Selbstständigkeit und Eigenverantwortung, mit Neid und Konkurrenz, mit verwirrend verwischten Grenzen zwischen Privatleben und Beruf. Viel spricht dafür, dass das Modell „S.A.A.R.T.” noch einige Jahrzehnte verbindlich sein, die Erwerbsarbeit noch viele Enden überleben wird. Um ihre Veränderungen zu beschreiben, dürfte man sich freilich nicht scheuen, über die aktuellen Interessen der Arbeitenden zu reden, statt über mögliche Formen irgendeiner Zukunft.
Johannes Ullmaier (Hrsg.)
Schicht!
Arbeitsreportagen für die Endzeit.
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2007. 417 Seiten, 12 Euro.
Miserable Bedingungen, hohe Belastungen, wenig Sicherheit – so arbeitet jeder Dritte
Wilhelm Genazino schlägt die Einrichtung von Bettlerschulen vor
Fünfzig Jahre trennen beide Aufnahmen: Das VW-Werk von 1956 und die Funktionsprüfung in der Serienfertigung bei Siemens. Ein epochaler Abstand? Fotos: Keystone Features/Getty, Werner Bachmeier
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensent Jens Bisky findet diesen Band mit Reportagen aus der Arbeitswelt aufschlussreich, ganz überzeugt ist er gleichwohl nicht. Zwar macht er auf ihn einen unaufgeregten Eindruck. Auch findet er es interessant, sich von den Autoren - 17 Schriftstellern, von Bernd Cailloux bis Juli Zeh - in eine Peepshow, zu Ziegenhirten, zu einer Reitlehrerin oder zu VW führen zu lassen. Zugleich aber können die Beiträge in seinen Augen eine gewisse Ratlosigkeit nicht verbergen. Zudem vermisst Bisky eine Geschichte, wie sie einst Günther Wallraff über den Gerling-Konzern geschrieben hat. Die Reportagen erwecken bei ihm den Eindruck, die Konflikte der Arbeitswelt hätten sich ins Innere verlagert, die Menschen hätten sich abgefunden mit Arbeit, die keinen Sinn stiftet und keine Erfüllung bietet, sowie mit miserablen Arbeitsbedingungen. Kritisch betrachtet Bisky insbesondere den Umstand, dass der Band über der Suche nach Neuem und Außergewöhnlichem die normalen Arbeitsverhältnisse, die noch immer die Lebenswirklichkeit von Millionen Menschen bestimmen, aus dem Blick verliert. Völlig unterbelichtet bleibt zu seinem Bedauern etwa der Wandel, der sich derzeit im Bereich der klassischen Arbeitsplätze in der Industrie, im Einzelhandel und im öffentlichen Dienst vollzieht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Schicht! strahlt etwas Beruhigendes aus: jene Abgeklärtheit, die sich dann einstellt, wenn man die Diskursgewitter vorüberbrausen lässt, um dann hinzuschauen, wie es denn nun tatsächlich aussieht.« Jens Bisky Süddeutsche Zeitung