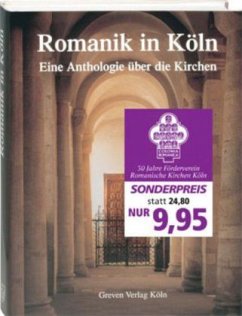Die romanischen Kirchen sind die reichsten architektonischen Zeugnisse des Mittelalters in Köln und gehören seit Jahrhunderten zu den wichtigsten Wahrzeichen der Stadt. Der Förderverein Romanische Kirchen Köln e.V. hat zu seinem zwanzigjährigen Bestehen Schriftstellerinnen und Schriftsteller gebeten, ihre persönlichen Eindrücke über ihre romanischen Kirchen zu formulieren; deren Texte werden durch einige ältere vom 16. bis zum 20. Jahrhundert ergänzt. Die Texte stammen von Hans Bender, Hanns Dieter Hüsch, Dieter Wellershoff, Lew Kopelew u.v.a.m.

"Romantik in Köln - Eine Anthologie über die Kirchen" herausgegeben vom Förderverein Romantische Kirchen Köln. Greven Verlag, Köln 2001. 310 Seiten, mit zahlreichen Fotografien von Celia Körber-Leupold. Gebunden, 21,90 Euro. ISBN 3-7743-0323-1.
Davon kann man träumen: In Köln, vielleicht an einem verlängerten Wochenende, das Schweigen der alten romanischen Kirchen zu genießen. Man würde Samstag mittags nahe der Kirche St. Aposteln sicher einem mit Einkaufstüten beladenen Paar begegnen, das, auf der Suche nach weiteren Schnäppchen, sich plötzlich vor dem Chor der Kirche wiederfindet und erstaunt innehält: "Was ist denn das Schönes?" Dann würden die beiden aber sofort weitergehen, benommen "von den Erregungen ihrer eigenen Welt". Das Paar, das Dieter Wellershoff beobachtet hat, kam wahrscheinlich von auswärts. Doch glaubt er, daß für die Masse der Einheimischen, die ihre Einkäufe machen oder in einem der meist überfüllten Cafés Kaffee trinken, die am Weg liegenden romanischen Kirchen zum Seitenblick geworden sind. Unterwegs, das Schweigen der alten Kirchen zu ergründen, ist Wellershoff kleinen Gruppen begegnet, die die Orte nur aus kunsthistorischem Interesse besuchten. "Jedesmal war ich froh", schreibt er, "wenn sie gegangen waren und der Raum wieder in seiner wortlosen Erhabenheit zu sprechen begann von der Angst der Menschen vor dem Tod, ihrem Leiden an Ungerechtigkeit und Unglück und ihrem Wunsch, ihre Sterblichkeit zu überwinden . . ." - während draußen im Gewühl des städtischen Alltags die entgegengesetzte Moral herrscht: "Nimm dir, was du kriegen kannst, und genieße dein Leben, denn irgendwann, vielleicht bald, ist die Party für immer zu Ende." "Dazwischen", sagt Wellershoff, "kann es im Grunde keine Vermittlung geben. Es sind einander ausschließende Konzeptionen." Wellershoff spricht von dem Bedürfnis, sich in einer hochtourigen Gegenwart gelegentlich in Selbstvergessenheit und Stille zurückzuziehen, um zu erleben, wie man sich allmählich innerlich ordnet. Oder auch erschrickt vor dem "ewigen Schweigen dieser unendlichen Räume" - so ergeht es der ehemaligen Kunststudentin in Jochen Schimmangs kleiner Erzählung "Gott um halb sieben", die vor dem draußen in der rheinischen Fassung lärmenden Welttheater in die Kirche St. Aposteln geflüchtet ist und begreift: "Das unendlich Große und das unendlich Kleine, und wir dazwischen, mit ein bißchen Verstand versehen, aber doch Witzfiguren, unsicher und schwankend." So führen in diesem Buch Schriftsteller durch die dreizehn romanischen Kirchen Kölns und teilen immer auch mit, was sie hineintreibt: Hans Bender, der in seiner Wohnung in der Taubengasse Sonntag morgens die Glocken von St. Pantaleon hört und keine weite Reise hat, um dort in die Epoche der Ottonen einzutauchen; oder es erinnert sich Hans Werner Kettenbach an Kindheitswege zusammen mit seinem Vater nach Alt St. Heribert und forscht einem Gefühl von Geborgenheit nach, und er freut sich, daß "seine" alte Kirche am Rheinufer heute eine neue Berufung erfahren hat, indem sie von der griechisch-orthodoxen Gemeinde Kölns benutzt wird und jedem, der eintritt, "immer noch das Gefühl der Geborgenheit unter Mitmenschen zu geben vermag, ob er nun ihrer Konfession angehört oder nicht". Da erzählt Hans Dieter Hüsch von der "dicken Kirche" Groß St. Martin, in deren Umgebung er lange gewohnt hat, und er spricht von der "Musik des Nichtwissens", die beim Betreten einer Kirche immer durch ihn durchgeht, "eine Musik, die man nicht notieren kann, aber sehr wohl alsbald in Herz und Hirn dringt"; oder es erzählt Erich Kock von St. Maria im Kapitol und erinnert daran, wie gerade diese Kirche am Ende des Zweiten Weltkriegs "wie ein gestrandetes Schiff auf Trümmerwogen" lag. "Was wird aus unseren Kölner Kirchen?" lautete damals eine Vortragsreihe an der Universität. Ob man sie wieder aufbauen könne; und in der mittelalterlichen Form rekonstruieren dürfe. Adenauer meldete sich zu Wort: "Redet nicht so viel! Fangt endlich an!" Ein anderer Urkölner und Adenauers Ansichten sonst nicht gewogen, Heinrich Böll, hat später seine Besucher immer wieder in die wiederaufgebauten romanischen Kirchen geführt, die für ihn viel kölnischer waren als der Dom, der, "ein wenig fremd, für Fremde, so nahe am Bahnhof und viel zu nahe an den großen Hotels liegt". Ins imaginäre Stadtwappen würde der Dom nicht passen, fand Böll. Aber eine romanische Kirche wie St. Gereon würde sich gut ausmachen: "Märtyrerkirche, Meutererkirche: ein gegen Rom rebellierender Thebäer gab ihr den Namen, und das architektonische Hauptmerkmal von St. Gereon hat einen heimatlich klingenden Namen: Dekagon." Ach, wußte Böll: "Köln gibt's schon, aber es ist ein Traum." (Lin.)
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
In diesem Buch führen Schriftsteller durch Kölns dreizehn romanische Kirchen, schreibt äußerst angetan ein mit "Lin." zeichnender Rezensent. Besonders schätzt er dabei, dass die Autoren immer auch mitteilen, was sie in die jeweilige Kirche hineintreibt, von der sie geschrieben haben. Für den Kölner Heinrich Böll seien die wiederaufgebauten romanischen Kirchen stets "viel kölnischer" als der Kölner Dom gewesen, schreibt der Rezensent und bringt die Rolle der Kirchen für Kölns Selbstverständnis auf den Punkt. Zu den Autoren des Bandes gehören Jörg Schimmang, Hans Dieter Hüsch, Hans Bender oder Dieter Wellershoff, wie "Lin." uns wissen lässt. Voller Inbrunst ist er in dies dicke Buch getaucht und hat sich vom dort propagierten Rückzug aus der "hochtourigen Gegenwart" in "Selbstvergessenheit und Stille" der alten Kirchen offensichtlich überzeugen lassen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH