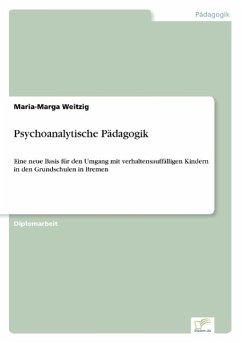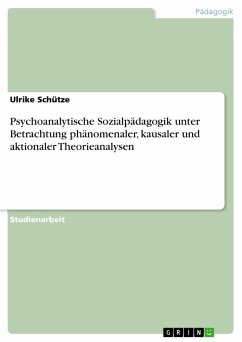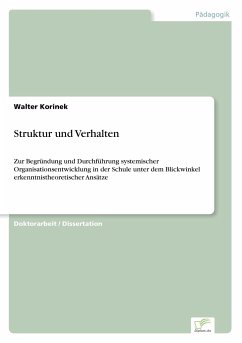Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Pädagogik - Schulpädagogik, Note: 1,0, Universität Bremen (Gesundheitswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:
Der Umgang mit behinderten, entwicklungsgestörten und verhaltensauffälligen Kindern ist Bestandteil beruflichen Alltags in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, in Kindertagesstätten und Schulen. Hier sehen sich Pädagogen tagtäglich mit einer Fülle von Problemen konfrontiert, deren Entstehung ihnen oft unverständlich erscheinen und mit deren Lösung sie sich häufig überfordert fühlen. Sie benötigen daher ein ständig aktualisiertes theoretisches und methodisches Wissen, um die schwierigen Anforderungen bewältigen zu können. Nun weiß ich aus Berichten von Lehrern aus Integrationsklassen, dass es häufig weniger die behinderten, als vielmehr die entwicklungsgefährdeten Kinder sind, die aufgrund sozialer oder psychischer Probleme zu aggressivstem Verhalten neigen und oft große Schwierigkeiten haben, sich in den Ablauf der Schule einzufügen.
Im Mittelpunkt sozialer Arbeit steht immer die Begegnung von Menschen. Sozialarbeit wird ihrem Auftrag nur gerecht, wenn diesem Aspekt die nötige Aufmerksamkeit geschenkt wird, geht es doch in ihren Arbeitsfeldern nicht zuletzt auch um pädagogische Prozesse. Für erfolgreiches Denken und Handeln müssen daher zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens muss man über klare Zielvorstellungen verfügen: Der sozial Handelnde muss möglichst genau wissen, was er mit seinen Bemühungen erreichen möchte. Sonst bliebe er orientierungslos und hätte auch für die Angemessenheit seines Handelns keine Bewertungskriterien. Zweitens braucht man ein detailliertes Gegenstandsverständnis, d. h. für mich, klare, umfassende und möglichst erschöpfende Vorstellungen davon zu haben, an dessen Veränderung man interessiert ist. Man muss also wissen, nach welchen Regeln und Gesetzmäßigkeiten es funktioniert . Welchen Beruf auch immer Menschen ausüben - setzen wir es als selbstverständlich voraus, dass sie etwas davon verstehen - wir erwarten, dass sie über klare und brauchbare Vorstellungen von ihrer Materie verfügen. Professionalität ergibt sich aus dem jeweiligen Gegenstandsverständnis.
Der Gegenstand von Sonderpädagogen und Pädagogen in Integrationsklassen sind Kinder mit Behinderungen oder Kinder, die von Behinderungen bedroht werden. Kinder bringen heute eine ungeheure Vielfalt der verschiedensten Lebenszusammenhänge mit - unterschiedliche Familienstrukturen, materielle, soziale und kulturelle Hintergründe. Integrative Erziehung ist demnach eine Pädagogik der Vielfalt. Immer dann, wenn reguläre Pädagogen nicht mehr weiter wussten, waren Sonderpädagogen gefragt. Damit bin ich bei meinem Problemaufriss angelangt: Es gilt berechtigte Zweifel anzumelden, ob zur Einlösung des Anspruchs, eine Pädagogik der Vielfalt zu sein, das Gegenstandsverständnis in der Integrationspädagogik in ausreichendem Maße klar, eindeutig und detailliert genug vorhanden ist. Dies könnte bedeutsame Folgen für das professionelle Können des Grundschullehrers haben, der sich nach Inkrafttreten des neuen Schulgesetzes im Lande Bremen als Integrationspädagoge verstehen soll.
Präzise Fachkenntnisse und klare Bestimmungsmerkmale bewegen sich hier oft auf dem Niveau von Alltagsplausibilitäten. Am Begriff der Lernbehinderung lässt sich das exemplarisch festmachen. Eberwein stellt fest, dass dieser zentrale Begriff trotz langer Diskussion bisher nicht ausreichend geklärt und präzisiert werden konnte. Daher können die Gruppe der sogenannten Lernbehinderten und ihre charakteristischen Merkmale nicht eindeutig bestimmt werden.
Nach Schlee können auch die Bemühungen, mit Hilfe empirischer Untersuchungen die Merkmale von Lernbehinderung zu erfassen, nicht fruchten. Wenn aber nicht klar und eindeutig ist, was unter einer Lernbehinderung zu v...
Der Umgang mit behinderten, entwicklungsgestörten und verhaltensauffälligen Kindern ist Bestandteil beruflichen Alltags in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, in Kindertagesstätten und Schulen. Hier sehen sich Pädagogen tagtäglich mit einer Fülle von Problemen konfrontiert, deren Entstehung ihnen oft unverständlich erscheinen und mit deren Lösung sie sich häufig überfordert fühlen. Sie benötigen daher ein ständig aktualisiertes theoretisches und methodisches Wissen, um die schwierigen Anforderungen bewältigen zu können. Nun weiß ich aus Berichten von Lehrern aus Integrationsklassen, dass es häufig weniger die behinderten, als vielmehr die entwicklungsgefährdeten Kinder sind, die aufgrund sozialer oder psychischer Probleme zu aggressivstem Verhalten neigen und oft große Schwierigkeiten haben, sich in den Ablauf der Schule einzufügen.
Im Mittelpunkt sozialer Arbeit steht immer die Begegnung von Menschen. Sozialarbeit wird ihrem Auftrag nur gerecht, wenn diesem Aspekt die nötige Aufmerksamkeit geschenkt wird, geht es doch in ihren Arbeitsfeldern nicht zuletzt auch um pädagogische Prozesse. Für erfolgreiches Denken und Handeln müssen daher zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens muss man über klare Zielvorstellungen verfügen: Der sozial Handelnde muss möglichst genau wissen, was er mit seinen Bemühungen erreichen möchte. Sonst bliebe er orientierungslos und hätte auch für die Angemessenheit seines Handelns keine Bewertungskriterien. Zweitens braucht man ein detailliertes Gegenstandsverständnis, d. h. für mich, klare, umfassende und möglichst erschöpfende Vorstellungen davon zu haben, an dessen Veränderung man interessiert ist. Man muss also wissen, nach welchen Regeln und Gesetzmäßigkeiten es funktioniert . Welchen Beruf auch immer Menschen ausüben - setzen wir es als selbstverständlich voraus, dass sie etwas davon verstehen - wir erwarten, dass sie über klare und brauchbare Vorstellungen von ihrer Materie verfügen. Professionalität ergibt sich aus dem jeweiligen Gegenstandsverständnis.
Der Gegenstand von Sonderpädagogen und Pädagogen in Integrationsklassen sind Kinder mit Behinderungen oder Kinder, die von Behinderungen bedroht werden. Kinder bringen heute eine ungeheure Vielfalt der verschiedensten Lebenszusammenhänge mit - unterschiedliche Familienstrukturen, materielle, soziale und kulturelle Hintergründe. Integrative Erziehung ist demnach eine Pädagogik der Vielfalt. Immer dann, wenn reguläre Pädagogen nicht mehr weiter wussten, waren Sonderpädagogen gefragt. Damit bin ich bei meinem Problemaufriss angelangt: Es gilt berechtigte Zweifel anzumelden, ob zur Einlösung des Anspruchs, eine Pädagogik der Vielfalt zu sein, das Gegenstandsverständnis in der Integrationspädagogik in ausreichendem Maße klar, eindeutig und detailliert genug vorhanden ist. Dies könnte bedeutsame Folgen für das professionelle Können des Grundschullehrers haben, der sich nach Inkrafttreten des neuen Schulgesetzes im Lande Bremen als Integrationspädagoge verstehen soll.
Präzise Fachkenntnisse und klare Bestimmungsmerkmale bewegen sich hier oft auf dem Niveau von Alltagsplausibilitäten. Am Begriff der Lernbehinderung lässt sich das exemplarisch festmachen. Eberwein stellt fest, dass dieser zentrale Begriff trotz langer Diskussion bisher nicht ausreichend geklärt und präzisiert werden konnte. Daher können die Gruppe der sogenannten Lernbehinderten und ihre charakteristischen Merkmale nicht eindeutig bestimmt werden.
Nach Schlee können auch die Bemühungen, mit Hilfe empirischer Untersuchungen die Merkmale von Lernbehinderung zu erfassen, nicht fruchten. Wenn aber nicht klar und eindeutig ist, was unter einer Lernbehinderung zu v...