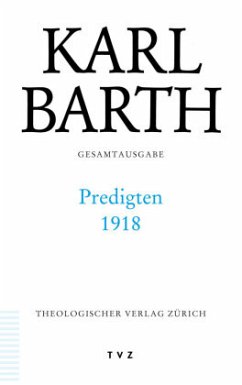1918 wurde für Karl Barth das Jahr des 'Römerbriefs': 1916 begonnen, wurde das erste Manuskript im Sommer 1918 fertig und sogleich zu dem Ende 1918 erscheinenden Buch umgearbeitet. 1918 war aber auch das Jahr, in dem der Erste Weltkrieg unter großen Erschütterungen zu Ende ging. Im November entluden sich die sozialen Spannungen in der Schweiz in einem 'Generalstreik', um den es in der Folge in Safenwil zu 'scharfen Gefechten' in der Kirchenpflege und in der von Barth geleiteten Sozialfürsorgekommission kam, welche die Folgen der heftigen Grippewelle lindern sollte. Vieles davon klingt in den 44 Predigten dieses Jahrgangs an. Vor allem aber bieten sie ein eindrucksvolles Bild der mit der Arbeit am Römerbrief verbundenen theologischen Reorientierung: sie zeigen, wie Barth immer wieder um ein neues Verstehen der Bibel ringt und eben von daher auch ein besseres Verständnis für das Zeitgeschehen und für das Leben seiner Gemeinde zu gewinnen versucht. Die Intensität dieser Arbeit dokumentiert sich auch daran, dass Barth mehrere Predigten sofort überarbeitete, so daß sie in zwei Fassungen vorliegen. So machen diese Predigten - unter denen neben drei Predigten zu Römer 12,1-2 und der kursorischen Auslegung von Matthäus 8 die Adventspredigten über Johannes 1,1-5 besonders zu erwähnen sind - in einzelnen Schritten eine hermeneutisch-exegetische Arbeit sichtbar, die Theologie und Kirche entscheidend verändern sollte.

Es ist einer der gelungensten Zufälle der Ökonomiegeschichte, dass die ersten acht Seiten des Notizbuches, das Karl Marx in den Jahren 1844 bis 1847 geführt hat, verloren gegangen sind. So beginnt dieses erste der insgesamt zwanzig erhaltenen Notizbücher mit dem Namen Adam Smiths. Marx hatte 1844 eine Liste seiner Bibliothek aufgestellt, deren achtundzwanzigster Eintrag die französische Übersetzung des "Wealth of Nations" war - und er findet sich am Beginn der neunten Seite des Notizbuches. Nun steht also das Buch, dessen theoretische Wirkung in der Geschichte der Volkswirtschaftslehre ohne Beispiel ist, auch am Anfang des neuesten Bandes der "Marx Engels Gesamtausgabe" (Mega), der seinerseits einen neuen Anfang darstellt. Denn das editorische Jahrhundertprojekt, das nach der Wende von 1989 arg ins Trudeln geraten war, ist bei einem renommierten Verlag untergekommen (Karl Marx, Friedrich Engels: "Gesamtausgabe". Vierte Abteilung: Exzerpte, Notizen, Marginalien. Band 3. Akademie Verlag, Berlin 1998, 2 Bd., zus. 866 S., Abb., geb., 298,- DM).
Es ist ein seltsames Gefühl, diese neue Ausgabe auf dem Schreibtisch zu sehen, neben den Textbänden des Dietz-Verlags, die ich bei gelegentlichen Besuchen in der DDR vom Zwangsumtauschgeld gekauft habe; das letzte Mal noch im September 1989 den ersten Teil des "Kapitals" in 33. Auflage. Später waren mir die Wühlkisten der Buchhändler vor dem Hauptgebäude der Humboldt-Universität geeignete Jagdgründe für weitere Einzelbände. Dort im Treppenhaus ist die elfte "Feuerbach-These" zu lesen, deren Wortlaut dem Notizbuch von 1844 bis 1847 entstammt - in dessen Schreibweise: "Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretirt, es kömmt drauf an sie zu verändern."
Engels hat im Jahr 1888 als erster Besitzer des Notizbuches nach Marx' Tod die berühmten elf Thesen im Anhang einer eigenen Feuerbach-Studie publiziert und sie dabei als das erste Dokument bezeichnet, "worin der geniale Keim der neuen Weltanschauung niedergelegt ist". Verfasst wurden sie vermutlich im Frühjahr oder Sommer 1845, als Engels in Brüssel zu Marx stieß und beide, wie Marx sich vierzehn Jahre später erinnerte, "mit unserem ehemaligen philosophischen Gewissen" abrechnen wollten. Dank der neuen Edition, die jeden noch so belanglosen Eintrag in dem Notizbuch wiedergibt, muss man die "Feuerbach-Thesen" als Auftakt einer geplanten, aber nicht mehr realisierten Serie von thetischen Auseinandersetzungen mit der deutschen Philosophie verstehen, denn vor der Überschrift ("ad Feuerbach") findet sich die Nummerierung "1)". Man kann sich gut vorstellen, dass Max Stirner die "2)" hätte werden können.
Denn Stirner publizierte im folgenden Jahr seine Übersetzung des "Wealth of Nations", womit der einstige Mithegelianer für Marx verloren war. Diese Übertragung sollte Schule machen; sie prägt die deutsche Smith-Rezeption bis heute. Nun aber ist auf der Grundlage der 1976 erschienenen "Glasgow-Edition" eine neue deutsche Ausgabe erschienen, die sich bemüht, das gängige Bild Smiths zu korrigieren (Adam Smith: "Untersuchung über Wesen und Ursachen des Reichtums der Völker". Aus dem Englischen von Monika Streissler. Verlag Wirtschaft und Finanzen, Düsseldorf 1999. 2 Bd., zus. 924 S., geb., 168,- DM). In der Einleitung nimmt Erich W. Streissler Smith davor in Schutz, zum Ahnherrn des Konkurrenzprinzips und der Rationalisierung verklärt zu werden; er zeigt Smith als Vertreter eines konsequenten Individualismus, dessen Theorie keinesfalls revolutionär gewesen ist. Aber gewirkt hat sie so, nicht zuletzt auf Marx, der Smith 1844 erstmals las. Auch er beschränkte seine Rezeption, allerdings auf die Werttheorie, die ihm entscheidende Anregungen zum "Kapital" verschaffte. Im Vorgriff auf dieses Buch ist die Lektüre des neuen Mega-Bandes besonders faszinierend. Bisweilen, und gerade im zweiten Brüsseler Heft von 1845 (mithin zeitgleich zur Abfassung der "Feuerbach-Thesen" entstanden), ist auch hier schon der spätere Marx eingestreut.
Ein Feuer speiender Berg scheint sich aus den Fluten der fremden Gedanken zu erheben, wenn Marx lospoltert: "Es handelt sich heut zu Tage nicht mehr darum: Soll das Privatvermögen existiren? Soll die Familie existiren? etc. Wenn die bestehenden Zustände aufrechterhalten werden sollen, so müssen sie in ihrem ganzen Umfang erhalten werden. Also: Soll das Eigentum u. der Pauperismus existiren? Soll die Ehe u. die Prostitution, die Familie u. die Familienlosigkeit existiren?" Und wenig später: "Die jetzige Industrie ist die aufgelöste, negirte Organisation der Arbeit. Sie wiederherstellen wollen ist ein reaktionairer frommer Wunsch."
Diese papierenen Aufschreie sind die Blitze, aus denen der dialektische Materialismus seinen Antrieb ziehen wird. In den Exzerpten des neuen Mega-Bandes ist immer wieder der Kampf mit Smith zu spüren; akribisch notiert Marx Einwände gegen den "Wealth of Nations", und geradezu befriedigt klingt die Niederschrift einer Lesefrucht aus Andrew Ures "Philosophy of Manufactures" (in französischer Übersetzung gelesen): "Lorsqu'Adam Smith écrivit son ouvrage immortel . . . le système automatique d'industrie était encore a peine connu." Technisch war Smith für Marx überholt, die Zukunft gehörte dem, der das Prinzip der Arbeitsteilung auf seinem aktuellen Stand zu berücksichtigen wusste.
Es sind zwei wunderbare Mega-Bände, die die Genese einer Theorie zeigen, deren politische Wirkung die theoretische von Smiths Werk leider noch weit übertreffen sollte. Und es sind zwei wunderbare Smith-Bände, die das Hauptwerk des Schotten sprachlich ganz gegenwärtig machen. Die zwei Giganten der Ökonomie stehen jetzt in ihren Schubern in enger Nachbarschaft beieinander in meinem Regal.
ANDREAS PLATTHAUS
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main