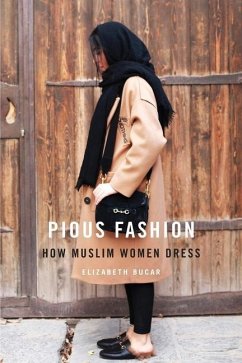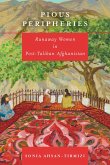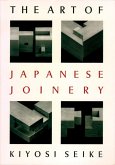For many westerners, the veil is the ultimate sign of women's oppression. But Elizabeth Bucar's take on Muslim women's clothing is a far cry from this attitude. She invites readers to join her in three Muslim-majority nations as she surveys pious fashionfrom head to toe and shows how Muslim women approach the question "What to wear?" with style.--

Neben dem Tschador ist viel Platz: Elizabeth Bucar vergleicht islamische Modestile
Eine Frau kann ein Kopftuch tragen, einen körperbedeckenden Mantel und eine lange Jeans - und trotzdem als Schlampe dastehen. Ein schlechter Schleier sei ein Schlampen-Outfit, das erklären Frauen, die im Buch "Pious Fashion" von Elizabeth Bucar zu Wort kommen. Dass Kopftuchträgerinnen untereinander solidarisch seien, ist einer der Mythen, mit denen Bucar aufräumt. Musliminnen, die sich durch das Tragen "frommer Mode" für ein Leben nach islamischen Werten entscheiden, stehen in modischer Konkurrenz zueinander und beurteilen den Kleidungsstil anderer Frauen nach ästhetischen, sozialen und politischen Maßstäben. Das ist auch die Lebenswirklichkeit vieler muslimischer Frauen in Deutschland: der Wunsch, sich einerseits religiös angemessen zu kleiden und andererseits attraktiv und feminin zu sein. Kleider machen Leute, Schleier machen Frauen.
Die Autorin lehrt Theologische Ethik an der Northeastern University in Boston. Zur islamischen Verschleierung hat sie 2012 einen "Ratgeber für Anfänger" herausgebracht, mit ihrem neuen Buch ertastet sie einen besonders bunten Zipfel des Schleiers: High-Fashion-Kopftücher, Designer-Ganzkörperschleier, stylish-islamische Outfits. Frömmigkeit und Mode sind keine Widersprüche - noch ein Mythos weniger -, ihre Kombination funktioniert aber nach regional unterschiedlichen Regeln. Bucar zeigt das anhand von Beispielen aus drei Metropolen islamisch geprägter Länder: Teheran, Yogyakarta und Istanbul. Dass kein arabisches Land in die Studie aufgenommen wurde, ist ein echter Mangel, denn auf der Arabischen Halbinsel begann Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts der Trend zur schwarzen Ganzkörperverschleierung.
Als vergleichende Studie definiert, ist "Pious Fashion" eher eine Sammlung von Beobachtungen und Anekdoten zum politisch-historischen Hintergrund der Verschleierung in der jeweiligen Region sowie Ergebnissen aus nichtrepräsentativ zusammengestellten Fragebogenaktionen. Zu Wort kommen modebewusste jüngere Frauen, vor allem Studentinnen. Landfrauen, konservative Frauen, Greisinnen, Mädchen und auch Männer dürfen nicht mitreden. Manche Erlebnisse und Ergebnisse stammen von 2011 und sind mit Fotos aus dem Jahr 2017 belegt, aber Bucars Verdienst ist weniger die Wissenschaftlichkeit oder die modische Aktualität als der unverstellte Blick auf das Forschungsobjekt.
Gebatikte Kopftücher, Blusen und Hosen - im indonesischen Yogyakarta war man 2011 damit bestens angezogen, da der Staat Batikstoffe als nationale Tradition definiert hat. Dass Frauen auf Java traditionell schulterfreie Kleidung und offene Haare trugen, ist ebenso gleichgültig wie das bis 1992 gültige Kopftuchverbot an Schulen. Der Schleier ist wieder schick. Die öffentliche Identität des Landes ist muslimisch, und so wird der Kleidungsstil der Frauen öffentlich verhandelt. Das ist einer der Mode-Mechanismen, die Bucar aufdeckt. Politik und Gesellschaft definieren islamische Schönheitsideale, Frauen internalisieren diese. Wie eine Frau sich kleidet, ist keine Privatsache, sondern ein Thema allgemeinen Interesses. Wer sein Kopftuch nicht im politischen oder zumindest modischen Wind wehen lässt, muss sich neue Freunde suchen. Ein Kopftuch ist eben nicht einfach nur ein Kleidungsstück.
In Iran ist es Pflicht, dazu mindestens ein weiter Mantel oder eine Tunika, die bis zur Mitte der Oberschenkel reicht. Bei förmlichen Anlässen wählen iranische Frauen einen Tschador, den traditionellen schwarzen Ganzkörperumhang, um angemessen gekleidet zu sein - und zwar ganz unabhängig davon, ob es traditionelle oder moderne Frauen sind. Der Tschador, unter dem westlich orientierten Schah-Regime verpönt und symbolisches Kleidungsstück der islamischen Revolution, mag bei Studentinnen und der reichen wie intellektuellen Elite genau deshalb uncool sein, er ist aber dennoch das bevorzugte Kleidungsstück bei wichtigen Anlässen, ähnlich einem Kostüm im Westen.
Für die Türkei stellt Bucar für die jüngste Vergangenheit eine "Politisierung der weiblichen Kleidung" fest, ebenso wie eine Renaissance des Kopftuchs - und eine besonders große Vielfalt an Stilen, die den sozioökonomischen und kulturellen Status der Trägerin zeigen. Bucar konstatiert für die Gegenwart: "Die moderne türkische Ideal-Frau strebt keinen strikten Säkularismus mehr an, selbst wenn sie sich als Europäerin begreift."
Kopftuch zu tragen zeigt einerseits Zugehörigkeit, andererseits Abgrenzung. Die Art der Verschleierung verhüllt den Körper und demonstriert Werte, Status, Schönheitsideale und Haltung, sie ist aber auch verhandelbar, von den Frauen wie von der Öffentlichkeit. Das vorgegebene Frauenbild spiegelt sich in der islamischen Mode, die Mode aber beeinflusst auch das Frauenbild, indem sie Femininität innerhalb des Vorgegebenen inszeniert. Ein Kopftuch mit Totenkopfprint zu einer langen Fellweste und Turnschuhen kombiniert bleibt ebenso im Rahmen des Frommen wie ein langes bordeauxrotes Lederkleid zu einem cremefarbenen Spitzenkopftuch und einer grün-pinken Schlangenlederhandtasche oder ein Ton-in-Ton-Outfit aus fließendem Chiffon mit einer Chanel-Handtasche.
Eine Frau, die sich nicht an diesen Rahmen hält, erlebt Sanktionen, vielleicht von der Sittenpolizei, vor allem aber von anderen Frauen aus ihrem Umfeld: zu altmodisch, zu modern, zu westlich, zu auffällig, zu ungepflegt, zu enthüllt, zu bedeckt. Ein Kernproblem: Frauen werden von der Gesellschaft ebenso wie von anderen Frauen dazu angehalten, kein "zu viel" von irgendetwas zu zeigen oder zu leben. Der von Frauen selbst internalisierte und weitergegebene Mäßigungsdruck zeigt sich in der islamischen Welt zuallererst in der Kleidung. In Europa, wo Hotpants erlaubt sind, zeigt er sich beim Lohnniveau und der Vergabe von Führungspositionen - oder bei Lästereien über die Hotpants der Nachbarin.
FELICIA ENGLMANN
Elizabeth Bucar: "Pious Fashion". How Muslim Women Dress.
Harvard University Press, Cambrigde / Mass.,
London 2017. 235 S., Abb., geb., 28,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main