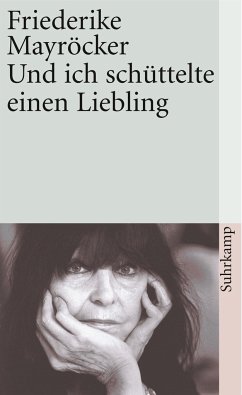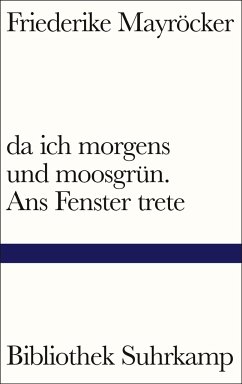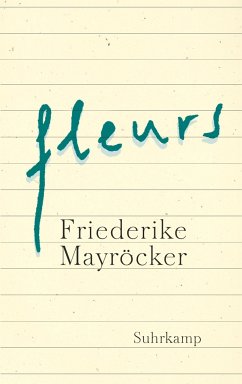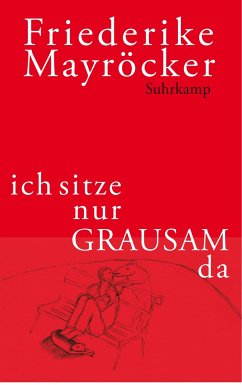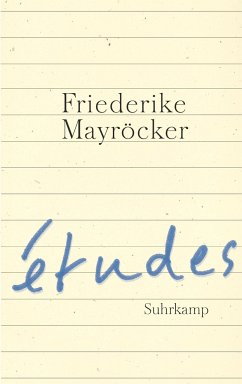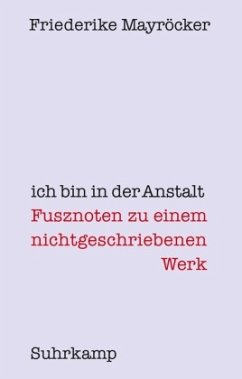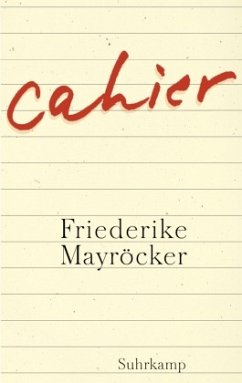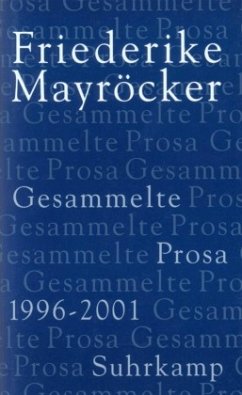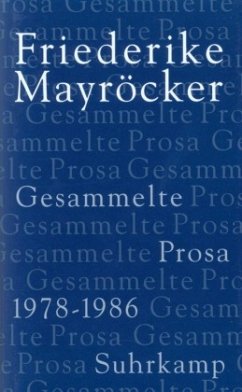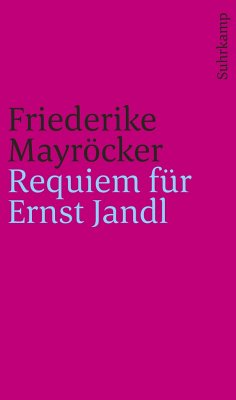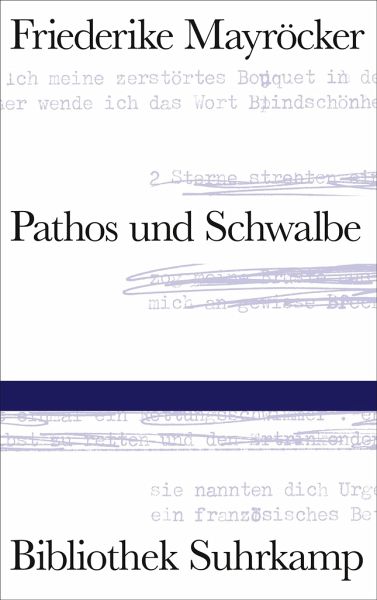
Pathos und Schwalbe

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die Sommermonate des Jahres 2015 muss Friederike Mayröcker im Krankenhaus verbringen. Wochenlang ist sie abgeschnitten von ihrer papierenen Schreibhöhle, dem legendär gewordenen Gehäuse ihres Poesiewerks. Das Schreiben in der fremden, ungewohnten Umgebung ist unmöglich, nicht weil die lästigen körperlichen Gebrechen die Dichterin daran hindern, sondern weil das beständige Flüstern und Wispern der sich aneinanderschmiegenden Zettel und Blätter nicht hörbar ist, dem jene Wort- und Satzkonzentrate abgelauscht werden, die den einzigartigen Mayröcker-Sound erzeugen. Die Dichterin behilf...
Die Sommermonate des Jahres 2015 muss Friederike Mayröcker im Krankenhaus verbringen. Wochenlang ist sie abgeschnitten von ihrer papierenen Schreibhöhle, dem legendär gewordenen Gehäuse ihres Poesiewerks. Das Schreiben in der fremden, ungewohnten Umgebung ist unmöglich, nicht weil die lästigen körperlichen Gebrechen die Dichterin daran hindern, sondern weil das beständige Flüstern und Wispern der sich aneinanderschmiegenden Zettel und Blätter nicht hörbar ist, dem jene Wort- und Satzkonzentrate abgelauscht werden, die den einzigartigen Mayröcker-Sound erzeugen. Die Dichterin behilft sich auf ihre Art, mit einem beständigen »Kritzeln«, einem Protokoll der einförmigen Tage: »verbringe die Tage mit Lesen Schlafen Essen«. Kaum zurück in ihrer Klause, verspinnt und verwebt sie die Notate zu jener unvergleichlichen Poesie, die »dicht wie ein Felsen und zart wie die allerzarteste Membran« (Klaus Kastberger, Die Presse) ist.
Pathos und Schwalbe, das neue Buch von Friederike Mayröcker, ist Radikalität und Unbeugsamkeit, ist Überfluss und Präzision. Und es ist das bewegende Zeugnis eines Lebens, das nur ein Ziel kennt: »ich müszte den ganzen Tag für mich haben um unbändig, ich meine schreiend, schreiben zu können.«
Pathos und Schwalbe, das neue Buch von Friederike Mayröcker, ist Radikalität und Unbeugsamkeit, ist Überfluss und Präzision. Und es ist das bewegende Zeugnis eines Lebens, das nur ein Ziel kennt: »ich müszte den ganzen Tag für mich haben um unbändig, ich meine schreiend, schreiben zu können.«