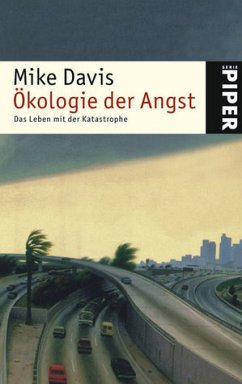In den letzten Jahrzehnten wurde Los Angeles von alttestamentarisch anmutenden Katastrophen heimgesucht: Dürre, Sturmfluten, Tornados. Zugleich wird die amerikanische Großstadt immer häufiger zum Schauplatz von fiktiven Katastrophen - in Filmen und in der Literatur. Am Beispiel der Megalopolis Los Angeles analysiert der Soziologe Mike Davis, wie ein größenwahnsinniger Urbanismus Katastrophen gebiert und zugleich von ihnen ablenkt. Und er zeigt: Die drohende ökologische wie soziale Apokalypse ist hausgemacht.
Dies ist ein unentbehrliches Buch für alle, die sich für die Zukunft unserer Großstädte interessieren.
Dies ist ein unentbehrliches Buch für alle, die sich für die Zukunft unserer Großstädte interessieren.

Los Angeles hat gelernt, mit Naturkatastrophen zu leben, doch Mike Davis findet neue Worte für den Schrecken
Als 1990 Mike Davis' Buch "City of Quartz" erschien (deutsch 1994), avancierte der Autor augenblicklich zum Zerstörer des Mythos von Los Angeles und zum Künder der unausweichlichen Katastrophe. In dieser Metropole - von postmodernen Philosophen gern zum Exempel für eine hyperreale, simulierte Existenz stilisiert - entdeckte Davis gefährliche und äußerst reale soziale Verwerfungen. Der offiziellen Ideologie der "Booster" und Immobilienmakler, die L.A. als sonniges Paradies anpreist, stellte Davis eine dunklere Geschichte gegenüber. Diese Alternativgeschichte legt dar, dass eine soziale Ausbeutung von schockierendem Ausmaß, konsequente rassische Ausgrenzung und die Übertünchung dieser unschönen Realitäten durch das marktgerechte Image einer vom Klima verwöhnten, mit Palmen bestückten Traumstadt von Anfang an zum feudalen südkalifornischen Lebensstil gehörten.
"City of Quartz" wurde ein Bestseller, gleichermaßen beliebt in den Hörsälen und bei Durchschnittslesern, die sich für soziale und städtebauliche Fragen interessierten. Als 1992 nach der Misshandlung von Rodney King die in "City of Quartz" prophezeiten sozialen Unruhen tatsächlich eintraten, galt Davis als Seher, auf den fortan zu hören war. Erst vor kurzem nahm das maßgebende Institut für Journalismus an der New York University "City of Quartz" in eine Liste der hundert besten Werke des amerikanischen Journalismus im zwanzigsten Jahrhundert auf. Mike Davis war es gelungen, eine neue Art der Stadtsoziologie zu betreiben, die sich zwar auch auf statistische Datenauswertung stützt, aber mehr der analytischen Schärfe des Autors vertraut. Davis' ausgeprägter Wille zur Interpretation macht zudem bei den Geschichts- und Kulturwissenschaften produktive Anleihen und verlässt sich oft auf die Suggestivkraft einer spekulativen Rhetorik.
Als Davis 1998 seine Analyse von Los Angeles in "Ökologie der Angst" im gewohnten Stil fortsetzte und auf ökologische Fragen ausdehnte, war die von ihm angegriffene L.A.-Elite zum Kampf gerüstet. Angezettelt von Brady Westwater, einem unter Pseudonym operierenden Immobilienmogul und Hobbyhistoriker aus Malibu, begann eine Pressekampagne gegen Davis. Nicht nur Lokalblätter, sondern auch bekannte Titel wie das Internet-Magazin "Salon" und der renommierte "Economist" nahmen die Vorwürfe auf. Es wurde bemängelt, dass es eine erstaunliche Anzahl Fehler in "Ökologie der Angst" gebe. Davis gestand einige davon ein und versprach, sie zu korrigieren. Dieses Versprechen wird in der deutschen Ausgabe eingehalten, allerdings nur für diejenigen Fehler, die Davis anerkennt, und nicht für fragwürdige Interpretationen, die oft weit über die Tatsachen hinausschießen.
Das Hauptproblem von "Ökologie der Angst" liegt in der doppelten Identität dieses Buches. Es will gleichzeitig Polemik und soziohistorische Studie sein. Damit aber ist die Kollision von Übertreibung und Faktentreue schon angelegt. Dem Buch fehlt zudem eine klare These. Die einzelnen Kapitel lesen sich wie separate Essays zu divergenten Themen, die von einer Soziologie der Erdbeben und Großbrände bis zu menschenfressenden Raubtieren in der Sierra Madre und der Darstellung von Los Angeles in Literatur und Film reichen. Einzeln gelesen, erweisen sich fünf der sieben Kapitel des Buches als hervorragende kritische Analysen von Phänomenen, die oft wenig mit der Besonderheit von Los Angeles zu tun haben.
Gerade weil Davis oft weit über die Stadt und ihre besonderen Probleme hinausschweift, wird die allgemeine Gültigkeit vieler seiner Befunde deutlich. Dies werden vor allem Leser zu schätzen wissen, die mit den südkalifornischen Verhältnissen nicht allzu vertraut sind und sich weniger für die reichen lokalhistorischen Details von Davis' Studie interessieren als für die allgemeinen Einsichten in die Vernetzung von sozialen, ökonomischen und ökologischen Fragen.
Ironischerweise geht Davis' ausschweifende Argumentation, die sich vehement gegen den städtebaulichen Wildwuchs Südkaliforniens richtet, gleichzeitig oft selbst im unkontrollierten Wuchern des Textes fast unter. So wird die "Ökologie der Angst" zwar formal zur eigentlichen Simulation ihres Gegenstandes, die Prägnanz der Kritik aber leidet. Ging es in "City of Quartz" noch darum, die Geschichte der sozialen Konstruktion von Los Angeles nachzuzeichnen, so wird die Stadt in "Ökologie der Angst" zur umfassenden Allegorie des nachindustriellen Kapitalismus und seiner ungelösten Probleme: der auf Rassismus und Klassenunterschieden beruhenden sozialen Ausgrenzung und des problematischen Verhältnisses von Gesellschaft und Natur. Die Stadt der Engel, ehemals Symbol des kalifornischen Lebensstils und Wohlstandes, ist allmählich zur Chiffre der Katastrophe geworden. Mit dem statistischen Nachweis, dass die Zahl der fiktionalen Zerstörungen von Los Angeles in Film und Literatur seit den sechziger Jahren sprunghaft anstieg, stützt Davis diese These.
Mit dramatischem Flair untersucht er die verschiedenen Attraktionen dieses "apokalyptischen Themenparks". Am Beginn steht das Ethos des amerikanischen Westens, das die Natur als feindliche, zu unterjochende Macht sieht. Die Landschaft soll werden, was der Siedler in ihr sehen möchte. Eine solche Denkweise, die Davis in Los Angeles exemplarisch verkörpert sieht, richtet "falsche Erwartungen an die Umwelt" und verdeckt den Umstand, dass die zwangsläufig eintretenden "natürlichen" Katastrophen gesellschaftlich bedingt sind. Südkalifornien ist nicht nur eminent gefährdetes Erdbebengebiet, wie das große Beben vom Januar 1994 zeigte, sondern ist auch einigen beunruhigenden Wetterphänomenen unterworfen.
Davis weist überzeugend nach, dass die ersten englischsprachigen Siedler, anders als ihre Spanisch sprechenden Vorgänger, über keine geeigneten Ausdrücke verfügten, um die Klima und Landschaft prägende "Dialektik von Wasser und Dürre, die eine mediterrane Landschaft kennzeichnet", zu beschreiben. Die Folge dieser semantischen Lücke war die Urbanisierung eines zur Massenbesiedelung völlig ungeeigneten Gebiets. Während aber die Erdbebengefahr im kalifornischen Bewusstsein fest verankert ist, vermochte sich die Erkenntnis der zerstörerischen, zyklisch auftretenden Kataklysmen, die typisch für das mediterrane Klima sind, außerhalb der Fachdisziplinen nicht durchzusetzen.
Nur auf der Grundlage dieser Naturvergessenheit lässt sich Los Angeles als Paradies denken. In einem seiner schwächeren Kapitel versucht Davis diese These am Beispiel der regelmäßig in Südkalifornien auftretenden Tornados zu illustrieren. Zwar sind die meisten dieser Stürme nicht so stark wie in den Tornadogegenden des Mittleren Westens; bei der Häufigkeit gibt es jedoch kaum Unterschiede. Trotzdem seien diese gewaltigen Naturphänomene in Südkalifornien "kulturell unsichtbar geblieben", woraus Davis folgert, dass hier selbst das Wetter "ideologisch verbrämt" werde. Wer aber die in den Anmerkungen angeführten Quellen überprüft, wird zum Schluss kommen, dass Davis grandios übertreibt. Es kann kaum die Rede davon sein, dass die Medien das Auftreten von Tornados verschweigen. Recht hat er allerdings, wenn er betont, dass sie in Südkalifornien trotz ihrer Häufigkeit als Ausnahmeerscheinungen behandelt werden.
An diesem Beispiel wird deutlich, dass Davis oft ohne argumentative Notwendigkeit übertreibt und damit die Glaubwürdigkeit seiner wichtigen Studie aufs Spiel setzt. In diesen Übertreibungen und der oft bewusst alttestamentarischen Katastrophenrhetorik werden Davis' ideologische Vorurteile am deutlichsten. Nicht ganz zu Unrecht werfen einige Kritiker dem Neo-Marxisten paranoide Tendenzen vor. Selbst Autoren, die mit der Analyse im Wesentlichen übereinstimmen, gehen auf Distanz. Sie befürchten, dass seine Übertreibungen und Ungenauigkeiten auch die berechtigte Kritik an Los Angeles kompromittieren könnten.
Überzeugender sind Passagen, in denen Davis die fragmentierte Klassen- und Rassengesellschaft von Los Angeles analysiert. Es dürfte kaum einen Leser geben, den die bis ins Detail nachgewiesene profitorientierte Fahrlässigkeit im Wohnungsbau, die das Beben von 1994 aufdeckte und auf die Davis auch die ungenügenden Brandschutzmaßnahmen in den Armenghettos zurückführt, nicht empört. Hier werden die konkreten sozialen Konsequenzen deutlich, wenn sich zur Naturvergessenheit die soziale Gleichgültigkeit gesellt. Ebenso wird die genau nachgezeichnete Eskalation der Gewalt gegen Minderheiten niemanden kalt lassen.
Als Historiker, der überzeugen will, und Polemiker, der übertreiben muss, steht Davis Los Angeles zwiespältig gegenüber. Einerseits zielt seine detaillierte Kritik der politisch und ökonomisch motivierten Stadtplanung auf eine öffentliche Diskussion und die Verbesserung der angeprangerten Praktiken. Andererseits kann sich der Leser des Eindrucks nicht erwehren, dass Davis kaum noch an eine Veränderung zum Besseren glaubt. Das Buch endet mit einem düsteren Ausblick auf eine Apokalypse, die schon begonnen hat. Manche Stelle verrät eine anarchistische Schadenfreude über den als unvermeidlich beschworenen Untergang von Los Angeles. Es scheint, dass nicht nur "die ganze Welt", wie Davis schreibt, sondern vor allem der Autor selbst nichts mehr genießen würde, "als Los Angeles in den Pazifik rutschen oder im San-Andreas-Graben versinken zu sehen".
PETER GILGEN
Mike Davis: "Ökologie der Angst". Los Angeles und das Leben mit der Katastrophe. Aus dem Englischen von Gabriele Gockel, Bernhard Jendricke, Gerlinde Schirmer-Rauwolf. Verlag Antje Kunstmann, München 1999. 541 S., Abb., geb., 78,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"L. A. braucht Leute wie Mike Davis, deren Imagination das ergänzt, was in der Wirklichkeit nicht mehr oder noch nicht sichtbar ist." (Die Zeit)