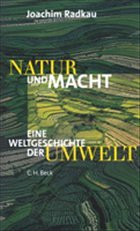Die Geschichte des Verhältnisses von Mensch und Natur ist keineswegs nur eine Geschichte der Krisen und Katastrophen, sondern ebenso auch die menschlicher Naturverbundenheit und stiller Regeneration der natürlichen Umwelt. Erstmals werden hier von Joachim Radkau die vielgestaltigen Verflechtungen von Natur, Mensch und Zivilisation und ihr weitreichender Einfluß auf die Weltgeschichte nachgezeichnet.
Rezensionen/Reviews:
- "Buch des Jahres" der Zeitschrift
Politische Ökologie
- Dieses Buch war dringend angezeigt ... Wirklich lesenswert! (Weltwoche)
-... eine äußerst interessante Darstellung ... Das Buch ist ein Durchbruch. (taz)
- ... Radkau liefert den historischen Hintergrund, vor dem heutige Umweltprobleme diskutiert werden sollten. (Die Welt)
- ... eine großartige, alle Epochen und Erdteile umgreifende Umweltgeschichte. (FAZ)
Rezensionen/Reviews:
- "Buch des Jahres" der Zeitschrift
Politische Ökologie
- Dieses Buch war dringend angezeigt ... Wirklich lesenswert! (Weltwoche)
-... eine äußerst interessante Darstellung ... Das Buch ist ein Durchbruch. (taz)
- ... Radkau liefert den historischen Hintergrund, vor dem heutige Umweltprobleme diskutiert werden sollten. (Die Welt)
- ... eine großartige, alle Epochen und Erdteile umgreifende Umweltgeschichte. (FAZ)

Die vergessenen Helden der Umwelt / Von Franziska Augstein
Die größte Leistung der historischen Umweltforschung, schreibt Joachim Radkau, bestehe "in der Wiederentdeckung der einstigen Flut von Beschwerden". Es war eben nicht so, dass die Menschen in der Antike keinen Schmerz empfunden und die des Mittelalters keinen Geruchssinn gehabt hätten. Kaum dass die Kultur entwickelt war, wurde ihre garstige Seite beklagt, wurden Gestank und Schmutz als lästig und die Erschöpfung der Ressourcen als Bedrohung wahrgenommen. Es fragt sich nur, unter welchen Umständen die Menschen nicht nur fluchten, sondern ihre Sorge um die "Umwelt" politisch umsetzten.
Joachim Radkaus großartige, alle Epochen und Erdteile umgreifende Umweltgeschichte zeigt, wie eng der jeweilige Zustand der drei Elemente "Wasser, Luft und Boden" mit den Wechselfällen des politischen und sozialen Lebens verquickt ist. Seine "Weltgeschichte der Umwelt" erstreckt sich über ein weites Themenfeld. Dazu zählen: die Geschichte der Seuchen und der Hygiene, die Entwicklung der Wahrnehmung von Natur und Landschaft, die Wechselwirkung zwischen der Umwelt und der vorherrschenden materiellen Lebensgrundlage der Bevölkerung, die Auswirkungen verschiedener Herrschaftsformen auf die Umwelt und der Wandel des Umweltbewusstseins bis hin zu Ursprüngen und Stand der ökologischen Bewegung.
Weil die Umweltbewegung ihre Kraft auch aus irrationalen Ängsten und nostalgischen Vorstellungen bezieht, haben viele gängige umwelthistorische Annahmen wenig mit der Wirklichkeit zu tun. Die germanischen Wälder? Es gab sie schon nicht mehr, als Varus seine Legionen verlor. Die historische Waldarmut des Mittelmeerraumes? Seit dem neunzehnten Jahrhundert wurden in Griechenland mehr Wälder abgeholzt als in den vorhergehenden zweitausend Jahren. Im übrigen erlebte Griechenland seinen ersten Entwaldungs- und Erosionsschub in prähistorischer Zeit. Dass die mediterrane Flora einen biologischen Verfall darstelle, ist den Europäern erst eingefallen, als sie den Wald als Prototypus von "Natur" ansahen "mithin im neunzehnten Jahrhundert." Aber neben dem Wald, schreibt Radkau, gelte es, auch die Wiesen "zu würdigen", die an Artenreichtum den Wäldern überlegen seien.
Heutzutage stehen traditionale Gesellschaftsformen wie das Nomadentum und die bäuerliche Subsistenzwirtschaft in dem Ruf, ökologisch verträglicher gewirtschaftet zu haben, als moderne Industriegesellschaften es tun. Das letzteren innewohnende Prinzip des endlosen Wachstums verträgt sich nicht mit dem Umstand, dass die Ressourcen endlich sind. Die Umweltbewegung setzt deshalb auf das vor rund zwei Jahrhunderten von einem deutschen Forstreformer formulierte Prinzip der Nachhaltigkeit, das darin besteht, der Natur zurückzugeben, was man ihr genommen hat. Von diesem Lehrsatz sagt Radkau aber, dass er eine ewige, statische Welt voraussetze, "eine Welt, die es nicht gibt".
So sinnvoll es sei, im Einzelfall nachhaltig zu wirtschaften, so wenig könne erwartet werden, dass die Menschheit sich in allem danach richte. Die bloße Idee, dass der "im Einklang mit der Natur" lebende Mensch automatisch auch schonend mit ihr umgehe, ist nach Radkau ein Mythos. Im Gegenteil: Menschliches Einwirken sei dann besonders folgenschwer, wenn es natürliche Tendenzen verstärke. Und auch die Vorstellung, dass der Bedarf an Rohstoffen der Anfang vom Verhängnis sei, ist irrig: Je dringender eine Gesellschaft auf bestimmte Güter angewiesen ist, umso besser sorgt sie für deren Bestand. Dass die Deutschen im neunzehnten Jahrhundert führend in der Forstwissenschaft waren, lag zum Beispiel daran, dass sie keine Kolonien hatten, sondern ihren Bedarf aus den eigenen Wäldern decken mussten. Hinzu kam eine jahrhundertelange Einübung in den Interessenstreit: Bauern und Fürsten brauchten den Wald aus unterschiedlichen Gründen. Jene trieben ihre Schweine dort hinein, dass sie sich ihr Futter suchten, der Staat benötigte Bauholz, und die Fürsten wollten jagen gehen. Gerade "aus dem Zusammenwirken einer Vielfalt von Interessen", schreibt Radkau, könne sich ein tieferes Verständnis für die Bewahrung der Umwelt ergeben.
Den Nordamerikanern ist es bis vor recht kurzer Zeit erspart geblieben, ähnliche Rücksichten obwalten zu lassen: Sie konnten gen Westen ziehen, wenn es am Ort nichts mehr zu holen gab und der Boden ausgelaugt war. So erklärt sich, warum die Vereinigten Staaten bis zum heutigen Tag wenig Sinn für den Umweltschutz haben. Der amerikanischen "frontier"-Ideologie entsprechend, schreibt Radkau, sei der Zaun "der Stolz" der Farmer gewesen. Europas sesshafte Bauern hingegen mussten düngen, weshalb der Misthaufen in der Alten Welt der Gipfel der bäuerlichen Ethik wurde: "Wo Mistus, da Christus." Und was nicht zu Dünger vermoderte, das fraß das Schwein, das Radkau zu "den unbekannten Helden der Umweltgeschichte" rechnet. Radkau selbst zählt schon längst zu den bekannten Vertretern im boomenden Unterfach der Umweltgeschichte, und alles, was der Leser sich von einem Werk mit dem großen Titel "Natur und Macht" erwarten kann, wird er in diesem Buch auch finden.
Joachim Radkau: "Natur und Macht". Eine Weltgeschichte der Umwelt. Verlag C. H. Beck, München 2000. 438 S., geb., 58,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main