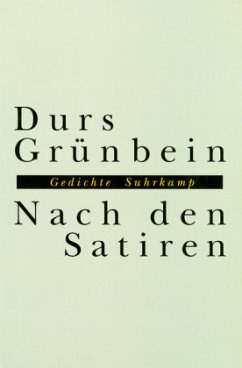Durs Grünbein hat sich Zeit gelassen mit einem neuen Gedichtband. Fünf Jahre nach Falten und Fallen zieht der Autor eine Bilanz seiner dichterischen Arbeit vor dem magischen Jahr 2000. Die enzyklopädische Neugier, die Grünbeins Texte seit jeher prägte, kennzeichnet auch diese Gedichte, in denen er sich neues poetisches Terrain erschließt. Weit gespannt ist dabei der Bogen: von der Antike bis in die unmittelbare Gegenwart, von der Heimatstadt Dresden über die Kontinente bis hin zu Saturn und Venus, die »entgleist ihre Runden drehn. / Wenn im Teilchenzoo Ordnung herrscht und ihr kennt jedes Gen« von der Mikro- bis zur Makrowelt und zurück. Grünbein ist gelegentlich »Kälte« bescheinigt worden, doch jederzeit nachvollziehbare »Präzision« beschreibt die Art seiner Wahrnehmung besser.
»Und hinter allem steckt eine Liebe zum Lebendigen, Vergänglichen, die den Körper und alle Phänomene rings um ihn her noch einmal - metaphysisch - umfängt.«
Nicht der Blütenstaub, fein verteilt, nicht
dieser Schmerz
An den Haarwurzeln, mit jedem Frühling
erneuert,
Nicht das Erwachen ist grausam. Was
aber dann?
»Und hinter allem steckt eine Liebe zum Lebendigen, Vergänglichen, die den Körper und alle Phänomene rings um ihn her noch einmal - metaphysisch - umfängt.«
Nicht der Blütenstaub, fein verteilt, nicht
dieser Schmerz
An den Haarwurzeln, mit jedem Frühling
erneuert,
Nicht das Erwachen ist grausam. Was
aber dann?

Durs Grünbeins neue Gedichte / Von Ernst Osterkamp
Fünf Jahre ist es her, seit Durs Grünbeins Gedichtbücher "Falten und Fallen" und "Den Teuren Toten" erschienen sind. Seitdem hat sich der Dichter viel umgesehen in der Welt und manches gelesen, zum Beispiel Werke über römische Geschichte. Das Resultat liegt nun gewichtig in unserer Hand: 220 Seiten neue Gedichte, ein stattlicher Band. Man wird lange daran zu lesen haben.
Die Lyriker haben gute Gründe, in ihren Bänden selten die Zahl von hundert Seiten zu überschreiten. Jenseits dessen droht die Gefahr des Sammelsuriums, der nur durch eine Tendenz zur Zyklusbildung entgegengesteuert werden kann, die das einzelne lyrische Gebilde einbindet und überformt. Man kann das gut an Stefan Georges streng komponiertem "Siebenten Ring" erkennen, dessen Umfang demjenigen von Grünbeins neuem Buch entspricht. Da wird das Chaos der Zeit mit einem Willen zur inneren Werk-Einheit bewältigt, der das einzelne Gedicht nicht ohne Gewalt dem zyklischen Zusammenhang unterwirft.
Seit seinem ersten Buch "Grauzone morgens" (1988) neigte Durs Grünbein zum Zyklischen und zum langen Gedicht. Sie ist gewachsen, seit ihn sein Lebensweg aus der Grauzone in das Chaos der Glitzerzonen dieser Erde, vom Potsdamer Platz bis zum Sunset Boulevard, geführt hat. Dahinter steht der Wille, die Erscheinungsfülle der Welt in sich aufzunehmen, ohne sich von ihr überwältigen zu lassen. Zur poetischen Organisation der Vielfalt der Phänomene bieten sich zyklische Strukturen an. Auf Durs Grünbeins Formbewußtsein ist Verlaß, er beherrscht das poetische Handwerk wie kaum ein anderer Lyriker seiner Generation.
Seinem neuen Buch hat er einen triadischen Aufbau gegeben. Der Band wird eröffnet von "Historien", den Mittelteil bildet jener vier lange Gedichte umfassende Zyklus "Nach den Satiren", der dem Buch den Titel gab, dann folgt ein stattlicher "Physiognomischer Rest", der rund hundert Seiten umfaßt. Die Titel des ersten und dritten Teils sind unbestimmt genug, um Gedichte von unterschiedlichster Form und Thematik unter sich versammeln zu können. Während in den "Historien" geschichtliche Szenen, Begegnungen, Gestalten und öffentliche Ereignisse dominieren, halten die Gedichte des "Physiognomischen Rests" die vom Dichter durchreiste Gegenwart fest - es handelt sich zum großen Teil um Gedichte über Städte und Landschaften - und zeichnen auf diese Weise eine Physiognomie des wahrnehmenden Ich. So erfolgt innerhalb des Bandes eine thematische Umakzentuierung vom geschichtlichen Erinnerungsbild zur Gegenwartserfahrung des poetischen Subjekts, wobei die Geschichtsreflexion des mittleren Zyklus die Tafeln des Triptychons miteinander verklammert. Auf diese Weise hat Grünbein mit dem Zyklus "Nach den Satiren" seinen 1994 entstandenen vermischten Gedichten ein organisierendes Zentrum gegeben.
Die Satire will Grünbein als "Gesang der Satten" verstanden wissen; die Zeit nach den Satiren ist demnach die Zeit des Katzenjammers nach den guten Mahlzeiten. Nach den Satiren, dies heißt zugleich aber auch: nach den Utopien. Denn die Satire als kritische Wider-Rede gegen die Zustände der Wirklichkeit bedarf eines positiven Gegenbildes, von dem aus sie Kritik übt. Grünbeins Gedichte kennen solche Gegenbilder nicht; sie gebärden sich utopieresistent. "Mag sein, daß die Utopien mit der Seele gesucht werden", so sagte er 1995 in der Büchner-Preis-Rede, "ausgetragen werden sie auf den Knochen zerschundener Körper, bezahlt mit den Biographien derer, die mitgeschleift werden ins jeweils nächste häßliche Paradies." Mit dem Utopieverlust tritt auch die Satire in eine neue geschichtliche Situation. Das berühmte Diktum des römischen Satirikers Juvenal "Difficile est saturam non scribere" scheint seine Gültigkeit eingebüßt zu haben; es ist offenbar außerordentlich schwierig geworden, Satiren zu schreiben. So satirebedürftig die Verhältnisse der Welt am Ende des Jahrtausends auch geworden sein mögen, große Satiren bringen sie nicht hervor. Kritik vermuckert in Jux und Kalauern, wird Teil der Spaßkultur.
Grünbeins Zyklus "Nach den Satiren" reagiert hierauf. Er stellt ihm ein Motto aus Juvenals dritter Satire voran: "In der Stadt zu schlafen kostet viel Geld. / Davon rühren alle Übel her." In der Satire läßt Juvenal seinen Freund mit einer grandiosen Schelte auf Rom begründen, weshalb er die moralisch korrupte und zum Inbegriff aller Zivilisationsschäden verkommene Metropole verläßt und sich nach Cumae an der Küste der Campagna zurückzieht. In den großen Gedichten seines Zyklus tritt Grünbein als ein "urbaner Widergänger" des Juvenal auf, der sich durch den "blutigen Brei" der Städte am Jahrtausendende arbeitet, ohne daß es für ihn den Hoffnungsblick auf ein Cumae, auf einen Fluchtort aus der Moderne, noch gäbe:
"Hier wo das Herz der Gewalt schlägt. An deinen Schläfen
Fängt sich ein Luftstrom aus alten Städten. In deiner Hand
Erinnert die Münze an die Kühle der Thermen Roms
In der Zeit der Satiren . . ."
Sein Weg durch die Metropolen in der Zeit nach den Satiren wird zu einem Weg durch die globalisierte Moderne, aus der es keinen Rückzug mehr gibt. Dies markiert den Kontrast zu dem Muster des Juvenal: Die Tore Roms läßt niemand mehr hinter sich. Deshalb endet der Zyklus auch mit einem Vers, in dem das Morgenrot als die utopische Hoffnungschiffre par excellence - Ernst Blochs geliebte Aurora - pervertiert erscheint im Zeichen der Apokalypse: "Dann schien der Morgenhimmel pompejanisch rot."
Grünbein durchwandert die Metropolen wie ein künftiges Pompeji. Die Moderne wird auf seinem nächtlichen Weg durch die Stadt, den das erste Gedicht des Zyklus nachzeichnet, zu ihrer eigenen Antike. Aus dem Gewirr an Stimmen und Bildern, das sein Gedicht festhält, wird der Zustand der Welt an der Jahrtausendwende so ablesbar wie an dem von der Naturgewalt des Vulkans zerstörten Pompeji die Verhältnisse der zivilisierten Welt vor zwei Jahrtausenden. Es ist ein resümierender Blick, der hier auf die Unwirtlichkeit der Städte und auf die Schrecken unserer Zeit fällt, und daß ihn ein gewisses Klassizitätsverlangen steuert, will der Dichter auch keineswegs verleugnen:
"Mach ein Register
All der Dinge, die dir jetzt wichtig sind. Wie sieht er aus,
Dein Schild des Achill, dieser Fahrplan aus Nichtigkeiten,
Ereignisschwer."
Homers Beschreibung des Achilles-Schildes im 18. Gesang der "Ilias": Das nennen wir einen anspruchsvollen Vergleich! "Mit wenig Gemälden", so befand schon Lessing, "machte Homer sein Schild zu einem Inbegriffe von allem, was in der Welt vorgehet." Es ist der ganze lebendige Kosmos, den der Schild des Achill zeigt, ein geordneter Weltzustand, in dem sich alles harmonisch zu einem Ganzen fügt. Deshalb zitiert ihn Grünbein als ironisches Gegenbild zu seinem eigenen Zeitgedicht, in dem die von Körper und Gehirn "traumlos, mit registrierendem Schritt", aufgezeichneten Wahrnehmungsfetzen das Bild einer disharmonischen, zerrissenen, von Gewaltverhältnissen bestimmten Welt ergeben:
"Episoden aus Schmerz,
War das der Körper, sein Gedächtnis die Melodie von Gewalt,
Die das Gewege durchzieht, der neuralgische Kehrreim
In den Rückenwirbeln, sein Herzton ein Echolot in Zeit?
In die du eingehst, restlos, ein bald verschwundener Zeuge.
Einer, der auszog, das Fürchten zu lernen und dem der Kopf
Dröhnte am Morgen, von Redefetzen und Marktgeschrei,
Schrillen Szenen, wiederkehrend wie Schwalben im Sturzflug
Unter den Himmeln."
Zu den Vorzügen von Grünbeins Poesie gehört ihre eminente Körperlichkeit. Weil sich der Körper als Aufzeichnungssystem in ihnen zu Worte meldet, stehen die Gedichte dieses hochgebildeten Poeten auch nicht in der Gefahr, zu Bildungspoesie zu verflachen. Daß Gehirn und Körper, poetisches Kalkül und somatisches Gedächtnis zusammenwirken, gibt Grünbein die Möglichkeit, die Spannung, auch den hohen Ton, über weite Räume hinweg zu halten.
Daran vermag auch nichts zu ändern, daß sich in diesem antiutopischen, postsatirischen Szenario des Jahrtausendendes gelegentlich matte Verse finden:
"Durch laute Straßen
Ziehen bewaffnete Kinder zum Duell auf den Schulhof.
Halb verwelkt sind die Rosen, die der stumme Verkäufer
Anpreist wie ein gehetztes Tier. Vor dem bösen Blick
Aus dem Kinderwagen schreckt selbst die Mutter zurück.
An einer Kreuzung hackt ein Mädchen auf Kohlköpfe ein."
Da macht sich für Augenblicke die Ästhetik eines apokalyptischen Video-Clips breit. Darin deutet sich eine gewisse Gefahr von Grünbeins Kunstfertigkeit an. Man glaubt ihm nämlich nicht, wenn er sagt: "Hunderte Leben seit Juvenalis, macht es dich stumm, / Wenn du siehst, wie ein Messer die Worte abfängt." Diesen wortgewaltigen Dichter macht so schnell nichts stumm.
Das dritte dieser sprachmächtigen Zeitgedichte ist ein Berlin-Poem, das seinesgleichen in der Gegenwartsliteratur nicht hat. Man staunt, daß so etwas in dem abgedroschenen Genre möglich ist. Die Stadt, die ihre Vergangenheit wegzubaggern, zu überbauen sucht, wird in trennscharfen Bildern vergegenwärtigt, die von der ewigen Wiederkehr des Verdrängten handeln. Seine emblematische Verdichtung findet dies Motiv im Zentrum des Gedichts im Bild eines Baggers, der am Potsdamer Platz den Schädel eines Wehrmachtssoldaten freilegt. Aber das Gedicht weiß, daß es solcher Funde in dieser Stadt nicht bedarf, um die Schrecken der Vergangenheit ins Bewußtsein zu heben:
"Wie wehrlos eine Stadt liegt, wenn beim Anflug sinkend
Das Flugzeug einen Schatten wirft im Abendrot
Auf graue Wohngebiete, Parks flaniert von Lagerhallen,
In denen Güter warten auf den Abtransport,
Die morgen Schrott sind oder Grund zum Töten."
Das Berlin-Gedicht wird ohne jeden moralisierenden Duktus zu einem großen Gedicht gegen das Vergessen.
Das Grundthema des neuen Gedichtbuchs von Durs Grünbein ist die Vergänglichkeit. In seinem Zentrum steht der Tod, die stärkste aller Antiutopien. Der Band entfaltet auf weite Partien eine Vergänglichkeitsklage (und schließt damit an die in "Den Teuren Toten" versammelten lässigen Grabinschriften an). Das beginnt mit den fünf den Band eröffnenden Stilleben - nature morte im wahrsten Wortverstand - unter dem Titel "In der Provinz", die Grünbein jeweils um einen Tierkadaver zu Kabinettstücken des Memento mori gruppiert. Und es endet mit süffig-melancholischen Litaneien des Dichters, der mit nunmehr 37 Jahren wie einst Dante seines Lebens Mitte erklommen wähnt - "Es ist Halbzeit, mein Lieber" - und, da ihm im Unterschied zu diesem Ausblicke in die Transzendenz verwehrt sind, im Gespräch mit seinem Dämon im musikalischen Parlando seiner gereimten Langverse erste vorläufige Lebensresümees zieht:
"Unterscheiden macht älter. Nicht nur Schmerz separiert,
Auch das Feilschen mit dir. Auch die Hand, die dies schreibt.
Was kein Schlaflied vorhersah, fern der Märchen krepiert
Erst das Kind in mir, dann, - sein gehätschelter Leib."
Das ist wunderbar. In der schwebenden Eleganz dieser unangestrengten Verse entfaltet sich ein unverwechselbarer Grünbein-Blues, eine hochgebildet-urbane Melancholie, die den Leser schon deshalb nicht herabstimmt, weil er sich in diesen Stimmungen gerne wiedererkennt. Bei manchen der lyrischen Selbstvergewisserungen des Sonettzyklus "Nachbilder" fragt sich der Leser unwillkürlich, ob er sich Verse wie diese nicht gerne von Marianne Faithfull oder auch von Ingrid Caven vorsingen lassen möchte:
"Nichts macht immun gegen die Einsamkeit,
Die aus der Kindheit kommt, - wie zweite Masern.
Wenn nach dem letzten Lichtblick alles stargrau bleibt,
Die Fesseln (Verse, Träume, Frauenhaar) zerfasern."
Da blickt einer mit so eleganter Trauer auf die "verlorne Zeit" zurück, daß der Leser gleich beherzter auf die Jahrtausendwende schaut. Grünbeins lyrische Könnerschaft beschert dem Leser seines neuen Buches nicht wenige Glücksmomente.
Doch wie ungleichwertig sind die Stücke dieses langen Buches! Ich bekenne, daß mich die vielen Rollengedichte aus dem kaiserzeitlichen Rom, die den ersten Teil des Bandes aufschwellen, wenig dazu animieren, unsere eigene Spätantike in ihnen reflektiert zu finden. Diese Inszenierung kruder Todesarten, diese Auftritte des Augustinus, des Julian Apostata und des Heliogabalus, diese Reden von Kynikern und Stoikern sind bildungsgesättigte Virtuosen-Poesie, marmorglatt, zart und traurig, und das wäre es dann auch. Es ist, als ob hundert Jahre nach George wieder ein junger Dichter seinen "Algabal" zu schreiben unternommen hätte.
Auch die zahlreichen lyrischen Ansichtskarten, die Grünbein uns aus Los Angeles, von den Westindischen Inseln oder aus Venedig schreibt, überfliegt man rasch und legt sie ebenso rasch beiseite. "Jede Eva / Gehört einem kahlen Touristen, den Sonnenbrand / Von leichter Arbeit befreit hat. / Mittags ist Halbzeit im Nichtstun. Die Körper / Ächzen vom Ausruhn." So etwas gehört in den Reiseteil der Zeitungen, nein, nicht einmal dort hinein. (Das Gedicht ist aber drei Seiten lang.) Die zehn Gedichte umgreifenden "Grüße aus der Hauptstadt des Vergessens" an der amerikanischen Westküste reproduzieren die glitzernde Oberfläche der Stadt, ohne sie aufzubrechen. Es ist, als ob dort, wo das Vergessen regiert, Grünbeins poetische Einbildungskraft lahmgelegt wäre. Der Vergleich mit dem eindrucksvollen Dresden-Zyklus "Europa nach dem letzten Regen" in diesem Band zeigt sofort, daß Grünbein dort seine ausdrucksstärksten Gedichte schreibt, wo er von der Geschichte eingeholt wird. Es sind dies kurze, bildkräftige Stücke über die unauslöschlichen Wunden, die die Geschichte der Stadt geschlagen hat. Es könnte ihnen das Goethesche Motto "Im Gegenwärtigen Vergangenes" voranstehen.
Es gehört zu Grünbeins Könnerschaft und bezeichnet eine ihrer Gefahren, daß er ein Meister der Amplifikation, der rhetorischen Erweiterung und Aufschwellung seiner Themen ist. Grünbein schreibt eben nicht ein oder zwei, er schreibt gleich zehn Venedig-Gedichte, und jedes von ihnen sieht aus, als sei es von Anbeginn für eine Anthologie der schönsten Venedig-Gedichte konzipiert worden.
Er gibt an einem Sommertag dem Einfall nach, dem eigenen Fuß ein Denkmal zu setzen, in dem Bewußtsein, daß "man ihn so nie wieder sehn wird, nackt, / Mit warmen Venen, kuriosen Büscheln Haar, / Entspannt im Gras." Es ist dies eines der großen Motive aller Poesie: im Bewußtsein der Hinfälligkeit anzuschreiben gegen den Tod und ihn damit im Medium der Dichtung zu überwinden. In Grünbeins "Denkmal" aber wird "dieser eine Fuß", der "Einzig / Ist unter mehreren Milliarden", zu einem allegorischen Repräsentanten der Menschheitsgeschichte vom "Auszug aus dem Paradies" über Xenophons "Anabasis" bis zu den Weltkriegen, dies in elf Strophen von je elf Versen Umfang (eine Strophenform, deren innere Notwendigkeit mir nicht plausibel ist), denen noch ein 122. Vers angehängt wird; kurz, unter Grünbeins amplifizierenden Händen wird ein Gedicht auf einen niederen Gegenstand zu einem neobarock prunkenden Virtuosenstück. 1876 hat Adolph Menzel seinen Fuß gemalt: blaugeädert, knorpelig, mit roten Druckstellen. Menzel brilliert nicht mit seinen Mitteln, sie dienen allein der Vergegenwärtigung seines Bildthemas. Ebendeshalb wird sein Abbild der eigenen Kreatürlichkeit zum Inbild der irdischen Hinfälligkeit, gewinnt sein "Denkmal für den Fuß" - ein grandioses Zeugnis stummer Poesie - jene Würde und Repräsentativität, von der ich mir vorstelle, daß auch Grünbein sie angestrebt hat. Er macht aber zu viele Worte.
Es ist also ein reiches, aber auch zwiespältiges Buch. Entzücken wechselt mit Befremden. Der Leser wird von der Musikalität der Gedichte Grünbeins, ihrem Formenreichtum und ihrer Bildintensität hingerissen, von ihrer Sensibilität und ihrem Ernst bewegt. Dazwischen aber: Passagen des routinierten Leerlaufs. Es ist wohl so, wie es im Zyklus "Asche zum Frühstück" heißt: "Unmöglich, das Glückskind zu bleiben."
Durs Grünbein: "Nach den Satiren". Gedichte. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1999. 232 S., geb., 36,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main