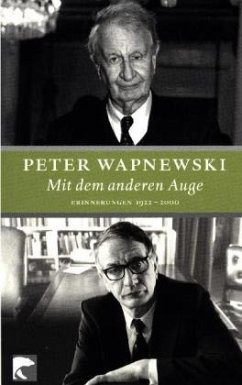Im ersten Band seiner Erinnerungen spiegelt Peter Wapnewski meisterhaft Vergangenheit und Gegenwart ineinander.Wir erleben mit ihm die bleiernen Jahre des Krieges und seiner Bombennächte; die braunen Jahre der Denunziation mit der Anklage durch das Kriegsgericht; schließlich die Gründung eines bürgerlichen Lebens in der Universität.
Im zweiten Band besichtigt der berühmte Gelehrte sein Leben und seine Zeit und entwirft, in unbestechlicher Zeugenschaft und meisterhafter Darstellungskunst, das Bild seines Jahrhunderts. Peter Wapnewski erzählt mitreißend von seiner Rückkehr aus Harvard und der beginnenden akademischen Karriere im Deutschland der Wirtschaftswunderjahre und wachsender gesellschaftlicher Spannungen. Der Wechsel an die Freie Universität Berlin führt ihn ins Zentrum der studentischen Revolte von 1968. Konsequent und engagiert bezieht Wapnewski zu den politischen und künstlerischen Fragen Stellung. Seine Zugehörigkeit zur Gruppe 47 macht ihn zum intimen Kenner der literarischen Szene, deren wichtigste Protagonisten wie Günter Grass, Uwe Johnson und Marcel Reich-Ranicki er in einfühlsamen Porträts schildert. Als Gründungsrektor des Wissenschaftskollegs hat er nachhaltigen Anteil an der kulturellen und wissenschaftlichen Ausstrahlung dieser Institution in der Hauptstadt. Mit seinen sprachmächtigen Erinnerungen erweist sich Wapnewski einmal mehr als glänzender Erzähler.
Im zweiten Band besichtigt der berühmte Gelehrte sein Leben und seine Zeit und entwirft, in unbestechlicher Zeugenschaft und meisterhafter Darstellungskunst, das Bild seines Jahrhunderts. Peter Wapnewski erzählt mitreißend von seiner Rückkehr aus Harvard und der beginnenden akademischen Karriere im Deutschland der Wirtschaftswunderjahre und wachsender gesellschaftlicher Spannungen. Der Wechsel an die Freie Universität Berlin führt ihn ins Zentrum der studentischen Revolte von 1968. Konsequent und engagiert bezieht Wapnewski zu den politischen und künstlerischen Fragen Stellung. Seine Zugehörigkeit zur Gruppe 47 macht ihn zum intimen Kenner der literarischen Szene, deren wichtigste Protagonisten wie Günter Grass, Uwe Johnson und Marcel Reich-Ranicki er in einfühlsamen Porträts schildert. Als Gründungsrektor des Wissenschaftskollegs hat er nachhaltigen Anteil an der kulturellen und wissenschaftlichen Ausstrahlung dieser Institution in der Hauptstadt. Mit seinen sprachmächtigen Erinnerungen erweist sich Wapnewski einmal mehr als glänzender Erzähler.

Lebensdankbar: Peter Wapnewski schreibt seine Erinnerungen fort
Peter Wapnewski ist ein sehr höflicher Autobiograph. Wo immer sich die Gelegenheit ergibt, und das ist im zweiten Teil seiner Erinnerungen häufig genug, spart er nicht mit Reverenzen, Freundlichkeiten und Danksagungen. Das Buch durchzieht geradezu ein Fluidum des Wohlwollens - kein Wunder, ist es doch über weite Strecken ein Buch der Freunde und der Erfolge. Umso auffälliger die wenigen, aber kräftigen Seiten, auf denen offen Unmut, ja Zorn geäußert wird.
Am heftigsten trifft es den Philosophen Martin Heidegger. Der erste Teil der Autobiographie ("Mit dem anderen Auge. Erinnerungen 1922 bis 1959"; F.A.Z. vom 5. Januar 2006) berichtete, noch mit ratloser Beklommenheit, wie der Freiburger Student ihn 1944 besucht und ihm dann in Heidelberg als Gast im Hause Gadamer wiederbegegnet. Im Vorwort des jetzt erschienenen zweiten Teils werden jäh alle Illusionen verabschiedet: Ein "Götze" ist Heidegger jetzt und "erbärmlich" sein Verhalten, "der letzte Kleinbürger" auch mit "passageren Liebschaften", kurzum "ein schreckenmachendes Muster" für den moralisch inkompetenten Intellektuellen. Gekränktes Vertrauen spricht so und kennt kein Pardon.
Ganz anders die große Kränkung, die sich mit der Jahreszahl 1968 verbindet und im zweiten Teil von Wapnewskis Erinnerungen rumort. Wapnewski hatte das Pech, von einem gloriosen Ruf an die FU Berlin binnen kurzer Zeit und ganz und gar unvermutet mitten ins peinlichste Chaos versetzt zu werden. Im Zentrum der Ereignisse und am eigenen Leibe erlebte er, wie seine Vorstellungen von der Universität pulverisiert wurden. Die Fassungslosigkeit des erfolgreichen und beliebten Professors, der sich natürlich zu den Liberalen mit dem unschönen Präfix, dem "kleinen, aber festen Häuflein der sogenannten Liberalen" zählte, ist noch heute spürbar. Dümmlich, peinlich, schäbig oder auch theatralisch und wehleidig, so lauten im Rückblick, durch keine liberale Milde mehr gebremst, die Befunde zur Studentenrevolte. Einen Aufstand der Nichtschwimmer gegen das Wasser nennt er sie hintersinnig.
Nicht vergeben hat Wapnewski auch eine weitere Dauerkränkung, die das alte West-Berlin zu bieten hatte - die Schikanen der Grenzorgane, die man bei jeder Fahrt nach "Westdeutschland" (so heißt das noch heute) hinzunehmen hatte. Eingeprägt haben sie ihm ein "tiefes Misstrauen" gegen "diese Brüder und Schwestern" mit dem sächsischen Dialekt und den unerbittlich vereisten Gesichtern.
Aber die harschen Töne und solche Würze sind selten, allzu selten. Wapnewski schreibt mit gedämpften Affekten. Man versteht, er will kein unvornehm lautes Ich, keinen "Ich-Gesang", keine Sentimentalitäten, kein Pathos. Doch wie soll das "autobiographische Tun" vonstatten gehen, wenn das Ich (wie Ranke es will) getilgt werden soll? Kommt es da nicht zum performativen Widerspruch mit der Gattung selbst? Gibt es nicht auch die ehrenwerte Literatenformel von der Welt, gesehen durch ein Temperament? Wie es scheint, hat Wapnewski das Private mit dem Subjektiven verwechselt und so seinen Spielraum unnötig eingeengt - zum Nachteil seiner doch zu Recht neugierigen Leser. So wirkt sein Buch nicht selten eilig, bis in die Syntax hinein mit ihrer Neigung zu elliptischen Konstruktionen, kurz angebunden aus lauter Zurückhaltung, abbreviatorisch an Insider sich richtend, wo man sich doch viel öfter (wie im ersten Teil) gelassene erzählerische Umständlichkeit gewünscht hätte. Zum Beispiel dann, wenn der von der Berliner Revolte Vertriebene am Strand von La Jolla in Kalifornien deren Inspirator Herbert Marcuse begegnet.
Zwar legen sich die fünf Berliner Semester wie ein schwerer Brocken quer zur Karriere des germanistischen Stars. Doch Wapnewski wusste sich dem Desaster in die freundlichen Gefilde des Badischen zu entziehen, nach Karlsruhe, wo die Germanistik noch in kleiner Idyllik betrieben wurde. Wenn Talleyrand gesagt haben soll, dass die "douceur de la vie" nie größer war als vor der Revolution, so lässt Wapnewski kaum einen Zweifel daran, dass die alte Universität vor ihrer Abschaffung am besten war. Jedenfalls für Gelehrte seines Zuschnitts. Sein leuchtendes Beispiel ist Heidelberg, eine Stätte geradezu vollkommenen professoralen Glücks. Mit Stolz, der kaum durch eine Prise Ironie gedämpft wird, porträtiert Wapnewski die Philosophische Fakultät, die ihn zu einem der Ihren machte, erst durch die Habilitation, dann durch einen ordentlichen Ruf, nachdem er, so wollte es die Regel, einen solchen von auswärts, von Harvard, erhalten hatte. Ein Herrenclub ohne Damen - aber was für Namen, von Hans-Georg Gadamer (mit dem "noblen weisheitsgeprägten Kopf") bis zu Sühnel, Hölscher und Henkel.
Das war die alte Universität. Über ihre Atmosphäre kann man bei Wapnewski einiges lernen. Freundschaften (und nicht nur Netzwerke) gehörten zu ihr wie urbane Formen, unerbittliche Reibereien wie höchstes Niveau. Namentlich aber hören wir von Gastlichkeiten, guten Abendessen, Gesellschaften, Feiern und Festen - das ancien régime war gast- und also menschenfreundlich. Geselligkeiten, in vielfältiger, durchweg prominenter Besetzung, kommen auch schriftstellerisch bei Wapnewski gut weg. Geselligkeit gewährt und verkörpert ihm die Leichtigkeit des Seins. ". . . it's not school hour, it's social hour" - die Belehrung, die eine amerikanische Gastgeberin ihren wissbegierig den deutschen Gast attackierenden Kindern erteilt, könnte in jeder klassischen Höflichkeitslehre vorkommen. Wapnewski, offensichtlich von ihr entzückt, handhabt sie wie ein Motto. Seine besondere Abneigung gilt deshalb dem "angestrengten Tiefsinn" in jeder Form, Leichtigkeit soll Front machen gegen "die grübelnde Innerlichkeit des gedankenbeschwerten Diskurses". Der Gelehrte, so scheint es, möchte sich nicht bei berufstypischen Fehlern ertappen lassen.
Er zahlt dabei freilich einen nicht geringen Preis - er verzichtet fast ganz auf die Gegenstände seiner Gelehrsamkeit. Fast nichts lesen wir über die Interessen und womöglich Faszinationen, die Wapnewski an sein Fach, die Mediävistik, gefesselt haben. Fast nichts auch (außer den Titeln) über seine zahlreichen Bücher, seine Forschungsperspektiven, seine Entdeckungen oder auch seine engeren Fachkollegen (mit der freundschaftlichen Ausnahme Joachim Bumkes). Auch der Status seines Fachs, das sich ja - siehe Berlin - prinzipiellen Bezweiflungen ausgesetzt sah, interessiert ihn offenbar nicht recht. Nein, Wege der Forschung, die Wissenschaft und ihre Adepten hält er von sich fern. Erstaunlich und doch auch bedauerlich bei einem Zeugen solchen Formats oder, mit den Worten von Hans Pyritz, die Wapnewski anlässlich des eigenen Rigorosums überliefert: "Bisschen mehr hatte ich erwartet."
Trotz aller Trauer über den Verlust der alten Universität, die Wapnewski nicht verschweigt, bleibt ihm die schwebende Leichtigkeit des Seins treu. Sie trägt ihn über alle Universitätsmiseren hinweg. Immer wieder erreichen ihn Rufe; kaum zu zählen sind die Gastprofessuren in aller Welt; dazu kommen Vizepräsidentschaften beim Goethe-Institut und beim Deutschen Akademischen Austauschdienst, die ihn über Jahre zu einer globalisierten Besuchs- und Vortragstätigkeit nötigen. Eine neue Sphäre der Erlesenheit öffnet sich ihm im Zeichen Richard Wagners. "Mein Wagner", überschreibt er das Kapitel, das diese Herzenssache darlegt, der er, sein Fachgebiet entschieden erweiternd (und nicht fliehend), sechs Bücher und zahlreiche Aufsätze widmet. Das führt ihn auf die Weltbühnen von Bayreuth und Salzburg und in alle bedeutenden Opernhäuser der Welt. Und manchmal in Höhen, "die höher sind denn alle Vernunft". Skeptiker können ihn nicht beirren. Nicht Richard von Weizsäcker, der ihm sagt, Wagner werde durch Wapnewski erst erträglich. Noch weniger Habermas, der in einer Florentiner Bar, Wapnewskis Interessen abwägend, erklärt: "Herr Wapnewski, es wäre der Reifung und Ausstattung Ihres inneren Erlebnisraums sehr zugute gekommen, wenn Sie sich beschränkt hätten auf die Belehrung durch Katzen."
Eine Genugtuung besonderer Art bedeutet die Rückkehr in das einst so peinvolle Berlin. Diesmal kommt Wapnewski gleich als Obeneinsteiger, als Gründungsrektor des neuen und sofort fabelhaften Wissenschaftskollegs - ein Lehrstuhl an der TU ist lediglich Beigabe. Der Berliner Senat klotzt und sorgt für märchenhafte Bedingungen. Höhe und Fülle des Wirkens: Wapnewski kann in Grunewald unumschränkt regieren. Der Rektor lädt Jahr für Jahr eine erlesene Gelehrtenschar in sein Haus und lässt alle seine Register spielen, die intellektuellen und natürlich die geselligen. Berühmt wurde die mittägliche Tafelrunde, zu der er die Fellows verpflichtete. Das sich anschließende Tischtennisspiel mit dem Rektor war allerdings freiwillig.
Läge die Analogie zu Elias Canettis "Geretteter Zunge" nicht allzu nahe, hätte Wapnewskis Erinnerungsbuch auch "Mit dem geretteten Auge" heißen können. Man merkt ihm an: Hier schreibt ein Entronnener, der sein Glück zu schätzen und gegen mancherlei dunkle Untergründe zu hüten weiß. Wapnewski endet mit dem lebensfreundlichen Ergebnissatz aus Hans Castorps Erfahrungen im Schnee. Nichts vielleicht kennzeichnet sein eigenes Buch besser als das Wort, das er gelegentlich einem Freund zuerkennt: "lebensdankbar".
HANS-JÜRGEN SCHINGS
Peter Wapnewski: "Mit dem anderen Auge". Erinnerungen 1959-2000. Berlin Verlag, Berlin 2006. 255 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main