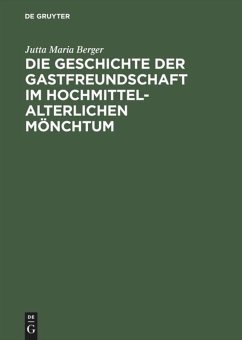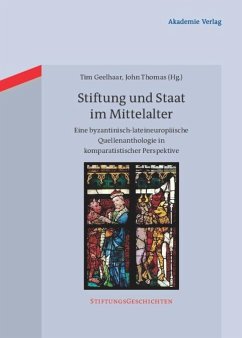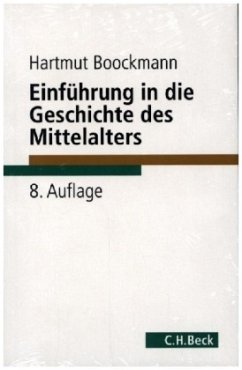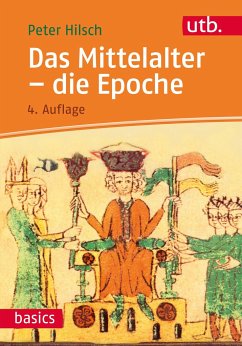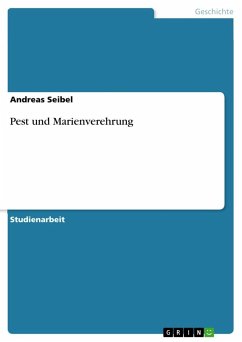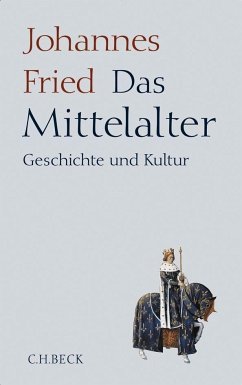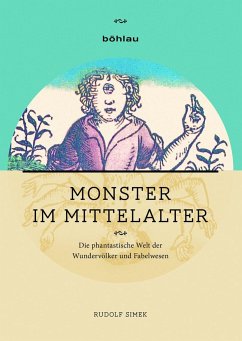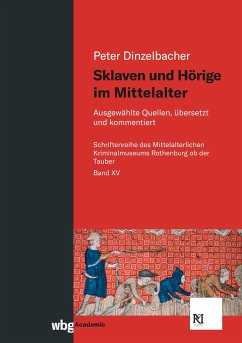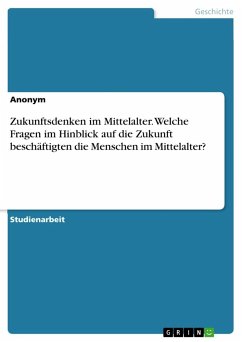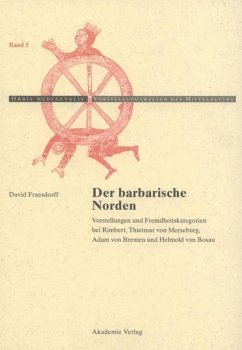küßten sich bloß und erhoben sich wieder.
Als nachts darauf wirklich das kaiserliche Schlafgemach hergerichtet wurde, stellten die Frauen aus Portugal Rauchfässer auf, sagten Zaubersprüche über dem Lager, ließen aber auch einen Priester das Bett segnen und mit Weihwasser besprengen. Friedrich fürchtete die Wirkung des Zaubers und befahl seine junge Gemahlin zu sich. Die aber weigerte sich standhaft; es sei Sitte, daß der Mann zum Lager der Frau komme. Schließlich einigten sich beide auf einen Kompromiß: Der Kaiser ging zu Eleonore, und die ließ sich von ihm zu einem anderen Bett führen.
Die Geschichte - aufgezeichnet durch Enea Silvio Piccolomini, damals Sekretär des Kaisers, der später Papst werden sollte - gehört zu rund 150 Zeugnissen, die Hans-Henning Kortüm in seiner Einführung in die Geschichte mittelalterlicher Sinnwelten zusammengestellt hat. Die Quelle ist exemplarisch für die Mentalitätengeschichte. Der heutige Leser empfindet deutlich die Distanz der Moderne, deren Teil er ist, zu den Verhaltensweisen der spätmittelalterlichen Menschen, zu ihren Einstellungen und ihren Erwartungen an die Wirklichkeit. Gleichzeitig nimmt er wahr, wie fremd verschiedene Gruppen des Mittelalters selbst einander sein konnten und wie das, was sie verband - hier Zauberei und Religion -, vielschichtig und widersprüchlich ihr Leben bestimmte.
Kortüm hat versucht, die kollektive Gebundenheit in Mentalitäten, Imaginationen und Lebensformen in synchronen und diachronen Schnitten durch das Mittelalter zu präsentieren. Er unterscheidet die Vorstellungshorizonte einzelner Stände und Schichten - Adel und Ritter, Kirche, Bürger, Randgruppen, Bauern und Intellektuelle - und exemplifiziert den Wandel der Mentalitäten an Natur- und Zeiterfahrungen, an der Auseinandersetzung mit Krankheit und Tod, mit Sexualität und Liebe sowie mit Lehre und Praxis des Christentums. Seine besondere Leistung besteht in der Auswahl der Texte aus einem Zeitraum von rund tausend Jahren.
Kortüm gibt aber auch Hinweise auf die neueren Debatten um den umstrittenen Mentalitätenbegriff, auf die Auswege und Aporien der Forschungsgeschichte. Eigenes trägt er zu diesen theoretischen Auseinandersetzungen kaum bei. Das Kernproblem, wie und ob denn überhaupt das Handeln, Fühlen und Denken von einzelnen und Kollektiven mit einheitlich konzipierten Mentalitäten in Verbindung gebracht werden können, wird in seinen Kommentaren nur angedeutet. Generelle Aussagen über die großen sozialen Einheiten, die er untersuchte, hat der Autor zu Recht vermieden.
Man sollte freilich die mittelalterliche Kirche nicht mit Kortüm als Gruppe bezeichnen, gehörten ihr doch neben Klerikern und Mönchen (fast) alle Christen im Laienstande an. Bezeichnenderweise mißlingt Kortüm auch die Erfassung der Intellektuellen als soziale Gruppe. Die Eigenheiten dieser Personen in ihrer Weltorientierung kann er nicht an gleichzeitig lebenden Gemeinschaften demonstrieren, sondern nur in einer, übrigens faszinierenden, Reihe von Porträts, angefangen von dem Angelsachsen Alkuin in der Umgebung Karls des Großen (um 800) bis hin zum Bischof von Brixen, dem Kardinal Nikolaus von Kues (
1464), der an seinem unpolitischen Denken scheiterte.
Wer sich der Lektüre der langen Quellenexzerpte überläßt, gerät immer wieder ins Staunen über die Ambivalenz von Fremdheit und Nähe zwischen Mittelalter und Moderne; Kortüm hat die Texte meistens zum ersten Mal in deutscher Übersetzung dargeboten. Nur einmal ist ihm ein Mißgeschick unterlaufen: Sein Hauptzeugnis für die Mentalität der jüdischen Minderheit, die Bekehrungsgeschichte des Hermann von Köln (Ende 12. Jahrhundert), ist nach der Untersuchung eines israelischen Gelehrten von 1988 eine reine Fiktion, bar jeder Kenntnis jüdischer Kultur. MICHAEL BORGOLTE
Hans-Henning Kortüm: "Menschen und Mentalitäten". Einführung in die Vorstellungswelten des Mittelalters. Akademie Verlag, Berlin 1996. 373 S., br., 29,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main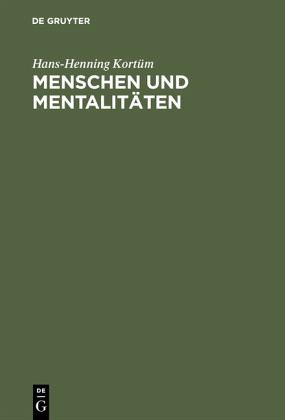





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.09.1996
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.09.1996