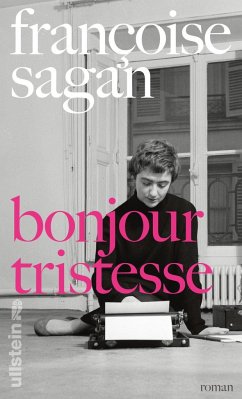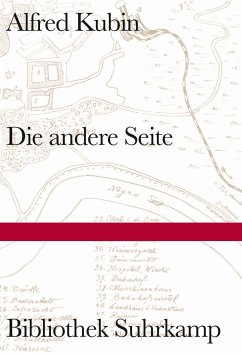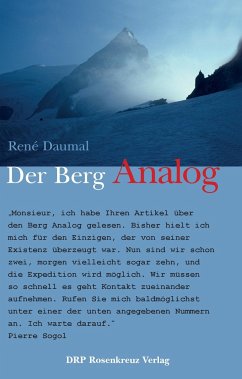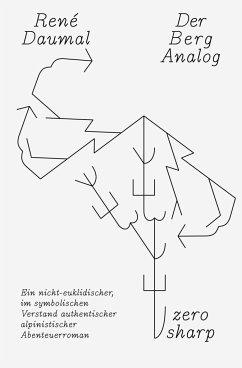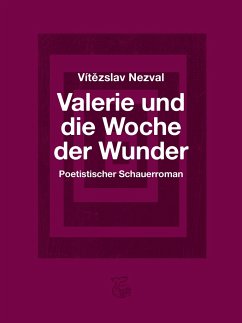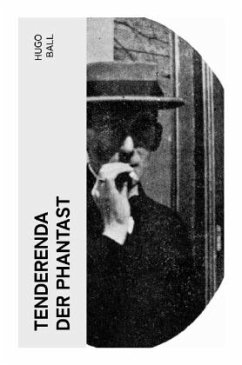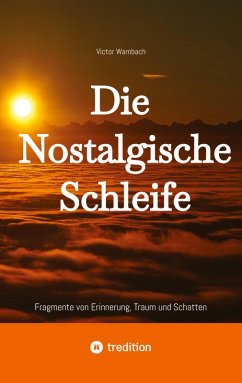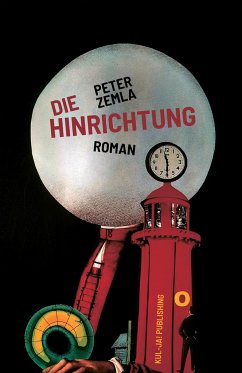sollten, wählte er dabei aus der 1935 bei Gallimard erschienenen Sammlung "La nuit remue". Unter diesem Titel hatte Michaux Texte zusammengestellt, die seit 1928 entstanden und zum Teil bereits zuvor unter dem Titel "Mes Propriétés" im kleinen Verlag eines Freundes erschienen waren.
Die deutsche Neuausgabe präsentiert im wesentlichen diese Sammlung in den Übersetzungen, die Kurt Leonhard und Paul Celan für die zweisprachige Ausgabe der "Dichtungen, Schriften" anfertigten. Für diese seit langem vergriffene Edition hatte Michaux Anfang der sechziger Jahre selbst die Auswahl getroffen. Die von ihm damals weggelassenen Texte sind nun hinzugefügt und werden ergänzt durch einige Stücke aus dem Umkreis sowie einige später entstandene Texte. Dieter Hornig hat die neu hinzugekommenen Texte mit sicherem Gefühl für Michaux' kunstvoll kunstlose Sprachformen ins Deutsche gebracht.
Um mit Michaux bekannt zu werden, eignen sich diese Stücke vorzüglich. Leichter vielleicht noch als die im selben Zeitraum auf den großen Reisen entstandenen Bücher und der "Plume" von 1930 lassen sie die verschiedenen Tonlagen des Autors hören und stehen auch für die endgültige Verabschiedung der Vorstellung, die gediegene große Form eines Romans erfüllen zu wollen, einer Idee, der Michaux bis in die Mitte der dreißiger Jahre nachhing. Nun hatte er sich entschieden, endgültig der "unordentliche" Autor zu sein, den die Abgrenzungen von Gattungen und Genres nicht kümmern. Dazu gehörte auch eine Wendung gegen die Sprache selbst, wie einige Stücke sie zeigen, in denen die Worte zerstückelt und neu geprägt werden. Daß die deutsche Ausgabe diese Gedichte wegläßt, ist ein wenig schade, da der Impuls, sich von der Sprache abzustoßen, nicht beiläufig war. Die Idee der neu erfundenen "Alphabete" und "Ideogramme" ließ ihn über Jahre nicht los, und die frühen "essais d'écriture" zeigen ebenso wie viele spätere Tuschzeichnungen Formen der "Schrift" abseits aller konventionellen Lesbarkeit.
Solches Abstandnehmen von den Worten, denen die Bilder entgegen- und zur Seite gestellt werden, ist bei Michaux freilich nur das Komplement einer unheimlich anmutenden Souveränität im Feld der Sprache selbst. Unheimlich deshalb, weil sie sich kaum auf Vorbilder beziehen läßt, weder direkt noch als Gegenrede. Was Michaux verweigert, ist schlicht Literatur in konventionellem Sinn: als Schreiben mit Blick auf den Leser, als professionelles Schreiben, das auf Wirkung zielt. Was er dagegen aufzubieten hat, ist Dichtung "als eine Form des exorzierenden Denkens", Befreiung vom Druck einer Realität, mit der nicht zu Rande zu kommen ist.
Die Bewunderung Lautréamonts verbindet ihn dabei mit den Surrealisten, genauso wie die Überzeugung, daß das Poetische überall zu finden und durch den Versuch der willentlichen Hervorbringung nur abzutöten ist. Aber die Differenzen zum Bretonschen Programm sind klar. Nie ließ sich Michaux von der Illusion täuschen, das Poetische sei einfach durch die Ausschaltung der bewußten Verfügungen zu erreichen: Entweder resultiere daraus bloßes Material, oder das durchaus bewußte Nacharbeiten an der Form werde verleugnet.
Für Michaux braucht es beides, den "anderen Zustand" und das Geschick, ihn zur Darstellung zu bringen: ein Akt der Balance zwischen Gewährenlassen und listiger Gegenwehr. Nur so ist der innere Bereich des Poetischen zur Darstellung zu bringen, "der früher vielleicht der Bereich der Sagen war und ein Teil des religiösen Gebiets (ein Teil nur)". Weshalb es auch die Heiligen und Mystiker sind, die bei Michaux neben Lautréamont zu stehen kommen. Sie sind die Zeugen der inneren Auslieferung und gewagten Selbsterprobung, die Michaux vom Dichter erwartet - um jene Zustände "von Innen zu berühren", die die wissenschaftlichen Vorstöße in den psychisch-somatischen Untergrund des Subjekts für Michaux' Blick immer zahlreicher zutage förderten.
Die "unmöglichen" Bilder und rätselhaften Geschichten, die er den inneren Berührungen abgewinnt, sind von jener fraglosen Natürlichkeit, die den Vergleich mit Kafka nahelegt. Wenige Zeilen genügen, um die Konvention der Realität zu verlassen: "Als ich in meinem verfluchten Körper umherirrte, kam ich in ein Gebiet, wo die Teile meiner selbst sehr selten waren; um dort zu leben, müßte man ein Heiliger sein. Aber ich, der ich früher so sehr nach Heiligkeit gestrebt hatte, jetzt, wo die Krankheit mich dazu zwingen wollte, sträubte ich mich und sträube mich noch immer, und es ist ganz klar: so werde ich nicht leben."
Die inneren Landschaften sind nicht zu trennen von den phantastischen Territorien, auf denen sich nie gesehenes Leben regt - Pflanzen, Tiere oder auch nur alle Arten von Augen: ",Manche waren groß wie Fußbälle, andre hoch auf langen Beinen, andre nicht größer als Ameisenaugen. Das alles ist gut für den Kochtopf!' sagte eine Stimme. Sofort wurde die Ebene leergeschabt und blankgeputzt, und nichts war mehr da als der dunkle Boden, der aus Lehm war." Auf den "Besitztümern" vernichtet der Eigentümer seine nicht zum Leben taugenden Schöpfungen selbst: "Dann schaffe ich alles ab, und es ist nichts mehr da als die Sümpfe, die mein Besitztum sind und mich zur Verzweiflung treiben wollen. Und wenn ich drauf versessen bleibe, so weiß ich eigentlich nicht, weshalb."
Trocken und eindringlich rhythmisiert ist Michaux' Tonfall; nur die Gedichte leisten sich hin und wieder etwas an Getragenheit. Gewaltsam geht es manchmal in diesen Imaginationen zu, immer fremdartig, fast skurril und doch gleichzeitg auch merkwürdig vertraut. Man meint diese inneren "Besitztümer" zu kennen und wird doch von jeder neuen Wendung überrascht, mitgerissen von einer Sprache, die alle rhetorischen Effekte wie Schlacken von sich abfallen läßt. Daß diese faszinierenden Texte wieder auf deutsch zugänglich sind, dafür kann man Verlag wie Übersetzer kaum genug loben.
HELMUT MAYER
Henri Michaux: "Meine Besitztümer - und andere Texte 1929-1938". Aus dem Französischen übersetzt von Paul Celan, Kurt Leonhard und Dieter Hornig. Literaturverlag Droschl, Klagenfurt 2003. 192 S., br., 23,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
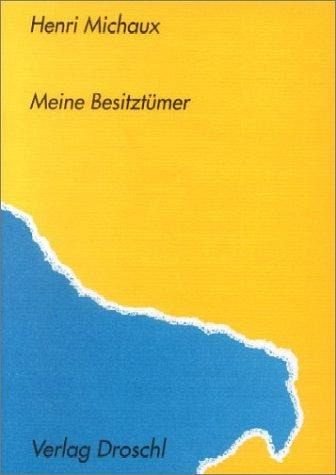




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.12.2003
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.12.2003