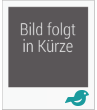Nicht lieferbar

Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:




Peter Handke erzählt aus dem Leben des 56jährigen Schriftstellers Gregor Keuschnig. Dessen Wunsch, allein zu sein, hat zur Trennung von Frau und Sohn geführt, und so lebt er in einem kleinen Pariser Vorort, "in der hintersten, verstecktesten, am wenigsten zugänglichen Bucht des Weltstadtmeeres". Lediglich sieben Freunde sind ihm geblieben, deren Treiben er aus der Ferne verfolgt. So begleitet er in Gedanken den Sänger Emmanuel ins schottische Hochland, den Maler Francisco durch die Städte Nordspaniens, den Architekten Guido durch Japan. Indem Handke sich in den Schriftsteller Keuschnig h...
Peter Handke erzählt aus dem Leben des 56jährigen Schriftstellers Gregor Keuschnig. Dessen Wunsch, allein zu sein, hat zur Trennung von Frau und Sohn geführt, und so lebt er in einem kleinen Pariser Vorort, "in der hintersten, verstecktesten, am wenigsten zugänglichen Bucht des Weltstadtmeeres". Lediglich sieben Freunde sind ihm geblieben, deren Treiben er aus der Ferne verfolgt. So begleitet er in Gedanken den Sänger Emmanuel ins schottische Hochland, den Maler Francisco durch die Städte Nordspaniens, den Architekten Guido durch Japan. Indem Handke sich in den Schriftsteller Keuschnig hinein versetzt, schreibt er von sich selbst, von seinen Erfahrungen, seinen Vorstellungen vom Leben und Schreiben.
Produktdetails
- Verlag: Suhrkamp
- Sonderausg.
- Seitenzahl: 1066
- Abmessung: 192mm x 126mm x 56mm
- Gewicht: 918g
- ISBN-13: 9783518409329
- ISBN-10: 3518409328
- Artikelnr.: 25251783
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.01.1995
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.01.1995Staunen und Raunen
Peter Handkes neuer Roman und die deutsche Literaturkritik
Wenn in Literaturkritiken von der "Epiphanie der Ding-Welten" die Rede ist und vom "Projekt in seiner Größe", wenn man vom Versuch erfährt, "die Welt im Wort aufzuheben", wenn man liest, der Autor habe "das Blendwerk seines Fürsichseins" durchschaut und sein Buch ziele, "in der Versenkung ins Kleine und Partikulare", durchaus "aufs Große und Ganze" - wenn man solche Wendungen vor Augen hat, ist sonnenklar: Peter Handke muß etwas Neues veröffentlicht haben. Das geschieht, der Autor ist fleißig, nicht eben selten. Mit schöner Regelmäßigkeit geraten manche Kritiker dann ins Staunen und Raunen.
Beim neuen Buch aus Handkes Bleistift,
Peter Handkes neuer Roman und die deutsche Literaturkritik
Wenn in Literaturkritiken von der "Epiphanie der Ding-Welten" die Rede ist und vom "Projekt in seiner Größe", wenn man vom Versuch erfährt, "die Welt im Wort aufzuheben", wenn man liest, der Autor habe "das Blendwerk seines Fürsichseins" durchschaut und sein Buch ziele, "in der Versenkung ins Kleine und Partikulare", durchaus "aufs Große und Ganze" - wenn man solche Wendungen vor Augen hat, ist sonnenklar: Peter Handke muß etwas Neues veröffentlicht haben. Das geschieht, der Autor ist fleißig, nicht eben selten. Mit schöner Regelmäßigkeit geraten manche Kritiker dann ins Staunen und Raunen.
Beim neuen Buch aus Handkes Bleistift,
Mehr anzeigen
dem vor kurzem erschienenen Roman "Mein Jahr in der Niemandsbucht", gesellte sich zum Regelmaß sogleich das Außergewöhnliche: der schiere Umfang. Obwohl im "Spiegel" beschwichtigend vermerkt wurde, Handkes Verlag habe mit der Wahl "einer den Augen wohltuenden großen Schrift" wohl "etwas nachgeholfen", konnte "Die Zeit", die letzten siebenundsechzig Seiten großzügig unterschlagend, ein "Tausend-Seiten-Werk" ankündigen. Solche Ausmaße verlangen, vor aller Interpretation, nach dem treffenden Namen fürs gewaltige Kind. "Mammutwerk" schlug "Der Spiegel" vor, "monumentales Werk", meinte "Die Woche", die "Neue Zürcher Zeitung" setzte auf "Epos", "Tagesspiegel" und "Focus" plädierten für "Opus magnum". Gewinner freilich war "Die Presse" in Wien, die im Roman das "Opus maximum" erkannte.
Der 1942 geborene Peter Handke war einmal ein wichtiger Schriftsteller. Zumal den Lesern seiner Generation boten die frühen poetischen Provokationen mannigfache Möglichkeiten, begeistert und bewegt zu sein. Hier war eine Stimme, die sich nicht vereinnahmen ließ vom gesellschaftskritischen Chor am Ende der sechziger Jahre, hier war ein Autor, der einen untrüglichen Sinn für überraschende Effekte hatte und die Gabe besaß, für seine Arbeiten Titel zu finden, die rasch zu Slogans wurden, zu Erkennungszeichen nicht nur unter Eingeweihten und Gleichgesinnten.
Vom Theaterstück "Publikumsbeschimpfung" (1966) bis zum Lyrikband "Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt" (1969), von der Erzählung "Die Angst des Tormanns beim Elfmeter" (1970) bis zur Geschichte "Der kurze Brief zum langen Abschied" (1972), von der Aufsatzsammlung "Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms" (1972) bis zur Prosa "Die linkshändige Frau" (1976): diese Bücher stifteten Identität und Gemeinschaft zugleich. Den Gipfel erreichten Handkes treffliche Titeleien mit dem Band "Die Stunde der wahren Empfindung" (1975) - schon zuvor hatte die Erzählung "Wunschloses Unglück" (1972) den Autor auch bei uneingeweihten Skeptikern hoffähig gemacht: Sie ist, bis heute, sein bestes Werk.
Die Spaltung unter den Gläubigen der ersten Stunde begann 1979 mit dem Buch "Langsame Heimkehr". Handkes Jünger waren älter geworden. Des Dichters entschiedene Wendung vom Provozierenden ins Feierliche und Erhabene, ins Bedeutungsschwangere und sakral Umwölkte erschien nicht wenigen unter ihnen ein wenig peinlich. Aber diese Wende brachte ihm, markante Zäsur in der Geschichte seiner Wirkung, neue Begeisterte, ja eine neue Teilgemeinde ein: die enttäuschten Achtundsechziger. War Handke bis etwa Mitte der siebziger Jahre eine Galionsfigur wider den herrschenden Zeitgeist, so wurde er fortan zum Repräsentanten eines kulturellen Hauptstroms. Neue Innerlichkeit, Narzißmus, Esoterik: aus diesen Gefühls- und Gedankenquellen speist sich seither seine Anhängerschaft. Sicher jedenfalls ist, daß seine Texte einen besonderen Typus von Lesern erfordern, eine Gruppe von "entsprechend Eingestellten", wie sie Gottfried Benn einst in ganz anderem Zusammenhang im Hinblick auf lyrische Ausdrucksweisen reklamiert hat.
Imaginäre Fronten
Wem solche Einstellung fehlt oder abhanden kam, der hat es schwer mit Handkes neuestem Buch. Gewiß, auf den über tausend Seiten von "Mein Jahr in der Niemandsbucht" finden sich einige Passagen, die auch den gleichmütigen Leser berühren: das Kapitel "Geschichte des Priesters" etwa, gut dreißig Seiten über den Alltag eines österreichischen Dorfgeistlichen, in denen Handke manches von der Genauigkeit wiederaufscheinen läßt, die "Wunschloses Unglück" zum Ereignis machte.
Die immer ähnlichen Gänge des Ich-Erzählers Gregor Keuschnig in die Natur jedoch, sein immer ähnliches Einkehren in Bars und Kneipen, sein immer ähnliches Räsonieren über das wahre Erzählen und die wahren und falschen Freunde, seine immer ähnlichen Schilderungen von Fußreisen durch Schottland, Japan oder Griechenland, seine ständige Bereitschaft, sich in jedes Blatt, in jeden Käfer, in jeden Frosch am Weges- und am Tümpelrand deutend zu vertiefen, sein ständiges Reden über das Schweigen: sie ermüden rasch, erzeugen, je nach Temperament, Gereiztheit oder Langweile, Ödnis oder Ärger.
Und die selbstironischen Sätze, die Handke einstreut, die Nörgeleien an seinem Erzähler, die er anderen Figuren des Buchs in den Mund legt, selbst jene fast heiteren Einschübe, die ihm bisweilen glücken: sie gleichen das Erschrecken über so manche Ausbrüche von Haß und Selbsthaß nicht aus, Sprachausbrüche, welche sich einmal mehr als die finstere Kehrseite jener hellsichtigen Sensibilität erweisen, die Handkes Helden für sich in Anspruch nehmen. Ein Objekt dieser unheimlichen Aversionen ist ein Literaturkritiker, in dem unschwer Marcel Reich-Ranicki zu erkennen ist - "mein Feind in Deutschland", heißt es von ihm, als sei Kritik eine Kategorie des Krieges. Handkes Haßsprache, die im Roman und im Zusammenhang mit Reich-Ranicki auch fahrlässig und infam den Begriff "Ghetto" verwendet, fand vor kurzem in einem Interview des Autors im "Stern" einen Tiefpunkt, der an schlimmste deutsche Zeiten erinnert: "weil man dem nichts übelnehmen kann", steht da über den "Feind" zu lesen, "weil er selber das Grundübel ist". Die nationalsozialistische Kampfpresse benutzte das Wort beständig: "Der Jude ist das Grundübel der Welt."
Was verführt Kritiker dazu, solche Äußerungen entweder zu ignorieren oder sie lediglich als untypische, den Glanz des neuen Romans keineswegs trübende Fehlleistungen zu nehmen? Wohl auch ein Denken in imaginären Frontlinien. So hat die Publizistin Sigrid Löffler in ihrer Rezension der "Niemandsbucht" vermutet, der Roman werde "den alteingespielten Häme-Automatismus der deutschsprachigen Anti-Handke-Liga unfehlbar ein weiteres Mal anwerfen". Eine solche Liga existiert nicht. Indes, es gibt eine Handke-Gemeinde. Ihr die begeisterten Rezensenten einfach zuzuordnen, sollte man sich hüten. Sie suchen und finden beim Lesen und Schreiben vor allem sich selbst. Ein erstaunlicher Mechanismus ist dabei am Werk: Je begeisterter sie sind, desto abstrakter und dunkler werden die Gedanken und Begriffe, mit denen sie ihr Lob begründen.
Handkes Buch trägt den Untertitel "Ein Märchen aus den neuen Zeiten", ein Schlüsselwort des Romans heißt "Verwandlung". Der Untertitel, notiert Jürgen Busche in der "Süddeutschen Zeitung", "korrespondiert eher zu der Veränderungsabsicht, in der die Niemandsbucht verwandelnd erlebt und beschrieben wird". Wie ist das zu verstehen? Unfreiwillig komisch wird Busche, wenn er den ersten Teil des Romans beschreibt: "Es ist die Geschichte, wie Peter Handke zum Dichter wurde. Seine Jahre als Jurist tauchen auf. Aber es müssen nicht die von Peter Handke sein." Undurchsichtig dann das Resümee: "Das Jahr in der Niemandsbucht", liest man, bezeuge "die Wirklichkeit einer poetischen Utopie. Leben als Erfahrung, Anfang und Erwartung wird in den Stoff gewebt, aus dem alle Utopien sind, in den Stoff des Erzählens, das erfindet, ohne etwas Spezielles zu erfinden." Welch eine Logik: Alle Utopien bestehen aus einem Erzählen, das eigentlich nichts erfindet. Gesetzt den Fall, der Roman erzähle genau dies: Sollte man ihn kennen?
Zungenreden
Martin Meyer, Feuilletonchef der "Neuen Zürcher Zeitung", hält es statt mit der Utopie eher mit der "Epiphanie". Die Entwicklungslinien des Romans und die Wege seiner Figuren zusammenfassend, erklärt er den Lesern: "Zur Leiter (das ,Bild' taucht später ausdrücklich auf) schließen sich die verschiedenen Schicksalsstationen zusammen - zu einem Sog in die Höhe der Transzendenz . . . Die Lehr- und Wanderjahre dieser Figuren schärfen nicht nur den ästhetischen Sinn. Sie holen zuletzt das Metaphysische herbei: im geglückten Dasein." Gesetzt den Fall, der Roman erstrebe genau dies: Sollte man ihn lesen?
Religiöses und Philosophisches, Epiphanie und Utopie verbinden sich bei Ulrich Greiners Rezension in der "Zeit": Ein "schönes und strenges Exerzitium" sieht er in dem Buch, in dessen Verlauf sich den Freunden des Erzählers "der Weg ins Freie öffnet, in die Niemandsbucht. Sie ist der Niemands-Ort, der Nirgendwo-Ort, also Utopia - und zugleich jene Ansiedlung unweit von Versailles, in der Peter Handke alias Gregor Keuschnig seit einigen Jahren lebt." Gesetzt den Fall, der Roman handle just davon: Sollte man sich mit ihm beschäftigen?
Vollends ins Zungenreden gerät der Kritiker der "Frankfurter Rundschau". Er, Thomas Assheuer, erklärt uns die Phasenfolge des Geschehens und weist dabei auf den Rang des Buches hin: "Die Katastrophe wird zur Idylle, damit die Idylle zum Epos wird, zur Erzählung aus der Totalen, zum neuen Wilhelm Meister nach dem Untergang der bipolaren Welt, die Handke mit dem Ende des Römischen Reichs vergleicht." Viel ist ferner die Rede von "Schuld" und "Schrecken", das "Unsagbare und Unvordenkliche" nicht zu vergessen. Gesetzt den Fall, der Roman wäre als Katastrophenidyllenepos wirklich hinter dem Unvordenklichen her: Sollte man das, 1067 Seiten lang, nachvollziehen?
Man könnte lange weiterzitieren. Gewichtige Worte etwa über "das eigentliche Weltwerden der Welt", besinnliche Wendungen über die "nahezu tempusfrei irrlichternde Melodie" des Buchs, wuchtige Kommentare über den "Grenzgänger" Handke, der "im Philosophischen" beides will: "Erlösung für die Geschichte (ja, ,der' Menschheit) und zugleich die Begegnung mit den Urbildern". Wieviel aber man immer zitierte, es bliebe der Vorwurf, man habe die Zitate aus dem Zusammenhang gerissen, die Rezensionen böswillig zusammengefaßt: "Böswillige Kritiker jedenfalls", notierte der Rezensent des "Focus" vorsorglich, "haben leichtes Spiel."
Nein, böswillig muß man nicht sein, um in den Zitaten das Klima zu erkennen, in dem das Lob dieses Buchs gedieh. Naturgemäß hat der Roman solch raunende Hymnen auch verdient. Dies angebliche "Opus maximum" ist durch und durch scharlatanesk. Von Januar bis Dezember 1993 hat Handke aufgeschrieben, was ihm so alles durch den Sinn ging. Die lobenden Kritiker haben darin nun den tiefsten Tiefsinn erkannt - und darüber die aufklärerische Tradition ihres Metiers verraten. Den Schaden hat nicht der Autor, wohl aber die deutschsprachige Literaturkritik.
Treffend faßte Wolfram Knorr in der Zürcher "Weltwoche" zusammen, was es mit dem Band "Mein Jahr in der Niemandsbucht", aber auch mit dessen Kritikern auf sich hat: "Es ist der Kitsch der gebildeten Stände, der hier versammelt ist." JOCHEN HIEBER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Der 1942 geborene Peter Handke war einmal ein wichtiger Schriftsteller. Zumal den Lesern seiner Generation boten die frühen poetischen Provokationen mannigfache Möglichkeiten, begeistert und bewegt zu sein. Hier war eine Stimme, die sich nicht vereinnahmen ließ vom gesellschaftskritischen Chor am Ende der sechziger Jahre, hier war ein Autor, der einen untrüglichen Sinn für überraschende Effekte hatte und die Gabe besaß, für seine Arbeiten Titel zu finden, die rasch zu Slogans wurden, zu Erkennungszeichen nicht nur unter Eingeweihten und Gleichgesinnten.
Vom Theaterstück "Publikumsbeschimpfung" (1966) bis zum Lyrikband "Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt" (1969), von der Erzählung "Die Angst des Tormanns beim Elfmeter" (1970) bis zur Geschichte "Der kurze Brief zum langen Abschied" (1972), von der Aufsatzsammlung "Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms" (1972) bis zur Prosa "Die linkshändige Frau" (1976): diese Bücher stifteten Identität und Gemeinschaft zugleich. Den Gipfel erreichten Handkes treffliche Titeleien mit dem Band "Die Stunde der wahren Empfindung" (1975) - schon zuvor hatte die Erzählung "Wunschloses Unglück" (1972) den Autor auch bei uneingeweihten Skeptikern hoffähig gemacht: Sie ist, bis heute, sein bestes Werk.
Die Spaltung unter den Gläubigen der ersten Stunde begann 1979 mit dem Buch "Langsame Heimkehr". Handkes Jünger waren älter geworden. Des Dichters entschiedene Wendung vom Provozierenden ins Feierliche und Erhabene, ins Bedeutungsschwangere und sakral Umwölkte erschien nicht wenigen unter ihnen ein wenig peinlich. Aber diese Wende brachte ihm, markante Zäsur in der Geschichte seiner Wirkung, neue Begeisterte, ja eine neue Teilgemeinde ein: die enttäuschten Achtundsechziger. War Handke bis etwa Mitte der siebziger Jahre eine Galionsfigur wider den herrschenden Zeitgeist, so wurde er fortan zum Repräsentanten eines kulturellen Hauptstroms. Neue Innerlichkeit, Narzißmus, Esoterik: aus diesen Gefühls- und Gedankenquellen speist sich seither seine Anhängerschaft. Sicher jedenfalls ist, daß seine Texte einen besonderen Typus von Lesern erfordern, eine Gruppe von "entsprechend Eingestellten", wie sie Gottfried Benn einst in ganz anderem Zusammenhang im Hinblick auf lyrische Ausdrucksweisen reklamiert hat.
Imaginäre Fronten
Wem solche Einstellung fehlt oder abhanden kam, der hat es schwer mit Handkes neuestem Buch. Gewiß, auf den über tausend Seiten von "Mein Jahr in der Niemandsbucht" finden sich einige Passagen, die auch den gleichmütigen Leser berühren: das Kapitel "Geschichte des Priesters" etwa, gut dreißig Seiten über den Alltag eines österreichischen Dorfgeistlichen, in denen Handke manches von der Genauigkeit wiederaufscheinen läßt, die "Wunschloses Unglück" zum Ereignis machte.
Die immer ähnlichen Gänge des Ich-Erzählers Gregor Keuschnig in die Natur jedoch, sein immer ähnliches Einkehren in Bars und Kneipen, sein immer ähnliches Räsonieren über das wahre Erzählen und die wahren und falschen Freunde, seine immer ähnlichen Schilderungen von Fußreisen durch Schottland, Japan oder Griechenland, seine ständige Bereitschaft, sich in jedes Blatt, in jeden Käfer, in jeden Frosch am Weges- und am Tümpelrand deutend zu vertiefen, sein ständiges Reden über das Schweigen: sie ermüden rasch, erzeugen, je nach Temperament, Gereiztheit oder Langweile, Ödnis oder Ärger.
Und die selbstironischen Sätze, die Handke einstreut, die Nörgeleien an seinem Erzähler, die er anderen Figuren des Buchs in den Mund legt, selbst jene fast heiteren Einschübe, die ihm bisweilen glücken: sie gleichen das Erschrecken über so manche Ausbrüche von Haß und Selbsthaß nicht aus, Sprachausbrüche, welche sich einmal mehr als die finstere Kehrseite jener hellsichtigen Sensibilität erweisen, die Handkes Helden für sich in Anspruch nehmen. Ein Objekt dieser unheimlichen Aversionen ist ein Literaturkritiker, in dem unschwer Marcel Reich-Ranicki zu erkennen ist - "mein Feind in Deutschland", heißt es von ihm, als sei Kritik eine Kategorie des Krieges. Handkes Haßsprache, die im Roman und im Zusammenhang mit Reich-Ranicki auch fahrlässig und infam den Begriff "Ghetto" verwendet, fand vor kurzem in einem Interview des Autors im "Stern" einen Tiefpunkt, der an schlimmste deutsche Zeiten erinnert: "weil man dem nichts übelnehmen kann", steht da über den "Feind" zu lesen, "weil er selber das Grundübel ist". Die nationalsozialistische Kampfpresse benutzte das Wort beständig: "Der Jude ist das Grundübel der Welt."
Was verführt Kritiker dazu, solche Äußerungen entweder zu ignorieren oder sie lediglich als untypische, den Glanz des neuen Romans keineswegs trübende Fehlleistungen zu nehmen? Wohl auch ein Denken in imaginären Frontlinien. So hat die Publizistin Sigrid Löffler in ihrer Rezension der "Niemandsbucht" vermutet, der Roman werde "den alteingespielten Häme-Automatismus der deutschsprachigen Anti-Handke-Liga unfehlbar ein weiteres Mal anwerfen". Eine solche Liga existiert nicht. Indes, es gibt eine Handke-Gemeinde. Ihr die begeisterten Rezensenten einfach zuzuordnen, sollte man sich hüten. Sie suchen und finden beim Lesen und Schreiben vor allem sich selbst. Ein erstaunlicher Mechanismus ist dabei am Werk: Je begeisterter sie sind, desto abstrakter und dunkler werden die Gedanken und Begriffe, mit denen sie ihr Lob begründen.
Handkes Buch trägt den Untertitel "Ein Märchen aus den neuen Zeiten", ein Schlüsselwort des Romans heißt "Verwandlung". Der Untertitel, notiert Jürgen Busche in der "Süddeutschen Zeitung", "korrespondiert eher zu der Veränderungsabsicht, in der die Niemandsbucht verwandelnd erlebt und beschrieben wird". Wie ist das zu verstehen? Unfreiwillig komisch wird Busche, wenn er den ersten Teil des Romans beschreibt: "Es ist die Geschichte, wie Peter Handke zum Dichter wurde. Seine Jahre als Jurist tauchen auf. Aber es müssen nicht die von Peter Handke sein." Undurchsichtig dann das Resümee: "Das Jahr in der Niemandsbucht", liest man, bezeuge "die Wirklichkeit einer poetischen Utopie. Leben als Erfahrung, Anfang und Erwartung wird in den Stoff gewebt, aus dem alle Utopien sind, in den Stoff des Erzählens, das erfindet, ohne etwas Spezielles zu erfinden." Welch eine Logik: Alle Utopien bestehen aus einem Erzählen, das eigentlich nichts erfindet. Gesetzt den Fall, der Roman erzähle genau dies: Sollte man ihn kennen?
Zungenreden
Martin Meyer, Feuilletonchef der "Neuen Zürcher Zeitung", hält es statt mit der Utopie eher mit der "Epiphanie". Die Entwicklungslinien des Romans und die Wege seiner Figuren zusammenfassend, erklärt er den Lesern: "Zur Leiter (das ,Bild' taucht später ausdrücklich auf) schließen sich die verschiedenen Schicksalsstationen zusammen - zu einem Sog in die Höhe der Transzendenz . . . Die Lehr- und Wanderjahre dieser Figuren schärfen nicht nur den ästhetischen Sinn. Sie holen zuletzt das Metaphysische herbei: im geglückten Dasein." Gesetzt den Fall, der Roman erstrebe genau dies: Sollte man ihn lesen?
Religiöses und Philosophisches, Epiphanie und Utopie verbinden sich bei Ulrich Greiners Rezension in der "Zeit": Ein "schönes und strenges Exerzitium" sieht er in dem Buch, in dessen Verlauf sich den Freunden des Erzählers "der Weg ins Freie öffnet, in die Niemandsbucht. Sie ist der Niemands-Ort, der Nirgendwo-Ort, also Utopia - und zugleich jene Ansiedlung unweit von Versailles, in der Peter Handke alias Gregor Keuschnig seit einigen Jahren lebt." Gesetzt den Fall, der Roman handle just davon: Sollte man sich mit ihm beschäftigen?
Vollends ins Zungenreden gerät der Kritiker der "Frankfurter Rundschau". Er, Thomas Assheuer, erklärt uns die Phasenfolge des Geschehens und weist dabei auf den Rang des Buches hin: "Die Katastrophe wird zur Idylle, damit die Idylle zum Epos wird, zur Erzählung aus der Totalen, zum neuen Wilhelm Meister nach dem Untergang der bipolaren Welt, die Handke mit dem Ende des Römischen Reichs vergleicht." Viel ist ferner die Rede von "Schuld" und "Schrecken", das "Unsagbare und Unvordenkliche" nicht zu vergessen. Gesetzt den Fall, der Roman wäre als Katastrophenidyllenepos wirklich hinter dem Unvordenklichen her: Sollte man das, 1067 Seiten lang, nachvollziehen?
Man könnte lange weiterzitieren. Gewichtige Worte etwa über "das eigentliche Weltwerden der Welt", besinnliche Wendungen über die "nahezu tempusfrei irrlichternde Melodie" des Buchs, wuchtige Kommentare über den "Grenzgänger" Handke, der "im Philosophischen" beides will: "Erlösung für die Geschichte (ja, ,der' Menschheit) und zugleich die Begegnung mit den Urbildern". Wieviel aber man immer zitierte, es bliebe der Vorwurf, man habe die Zitate aus dem Zusammenhang gerissen, die Rezensionen böswillig zusammengefaßt: "Böswillige Kritiker jedenfalls", notierte der Rezensent des "Focus" vorsorglich, "haben leichtes Spiel."
Nein, böswillig muß man nicht sein, um in den Zitaten das Klima zu erkennen, in dem das Lob dieses Buchs gedieh. Naturgemäß hat der Roman solch raunende Hymnen auch verdient. Dies angebliche "Opus maximum" ist durch und durch scharlatanesk. Von Januar bis Dezember 1993 hat Handke aufgeschrieben, was ihm so alles durch den Sinn ging. Die lobenden Kritiker haben darin nun den tiefsten Tiefsinn erkannt - und darüber die aufklärerische Tradition ihres Metiers verraten. Den Schaden hat nicht der Autor, wohl aber die deutschsprachige Literaturkritik.
Treffend faßte Wolfram Knorr in der Zürcher "Weltwoche" zusammen, was es mit dem Band "Mein Jahr in der Niemandsbucht", aber auch mit dessen Kritikern auf sich hat: "Es ist der Kitsch der gebildeten Stände, der hier versammelt ist." JOCHEN HIEBER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Broschiertes Buch
Nichts für «Lesefutterknechte»
Im riesigen Œuvre von Peter Handke stellt «Mein Jahr in der Niemandsbucht» mit dem Untertitel «Ein Märchen aus den neuen Zeiten» das Opus magnum dar. Das 1994 erschienene Buch ist autobiografisch geprägt, es …
Mehr
Nichts für «Lesefutterknechte»
Im riesigen Œuvre von Peter Handke stellt «Mein Jahr in der Niemandsbucht» mit dem Untertitel «Ein Märchen aus den neuen Zeiten» das Opus magnum dar. Das 1994 erschienene Buch ist autobiografisch geprägt, es beschäftigt sich mit dem mühsamen Selbstfindungsprozess eines Schriftstellers. Handke ist mit dem diesjährigen Nobelpreis geehrt worden «für ein einflussreiches Werk, das mit sprachlichem Einfallsreichtum Randbereiche und die Spezifität menschlicher Erfahrungen ausgelotet hat». Als Enfant terrible der österreichischen Literatur ist er wegen seiner politischen - um ein auf Tolstoi gemünztes Wort von Thomas Mann zu benutzen - «Riesentölpelei», die Balkankriege betreffend, erneut heftig umstritten. Was die Spannung vor der Bekanntgabe der diesmal ja zwei Preisträger anbelangt, hat Dennis Scheck erklärt, er nehme an, «dass sich Reinhard Mey in der Nähe seines Telefons aufgehalten habe», damit süffisant auf die umstrittene Preisvergabe an Bob Dylan anspielend. Rein literarisch ist Peter Handke allerdings unumstritten, er ist geradezu eine Lichtgestalt der zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur, von niemandem übertroffen. Der vorliegende, als Märchen deklarierte Band aus der Mitte seiner Schaffenszeit ist ein eindrucksvoller Beleg dafür.
Gregor Keuschnig, der fiktive Ich-Erzähler, ist auf der Suche nach seinem Platz in der Welt. «Einmal in meinem Leben habe ich bis jetzt die Verwandlung erfahren», lautet der erste Satz, der verzweifelnde Held befindet sich in einer Lebens- und Schaffenskrise. In der nahen Zukunft 1997 angesiedelt, handelt es sich dabei in erster Hinsicht um ein zu schreibendes Buch, das der nahe Paris in einem Vorort allein wohnende, von seiner Frau verlassene Chronist zu schreiben gedenkt, er hat sich ein Jahr Zeit für diese Klausur über sein verfehltes Leben genommen. Als seine «Niemandsbucht» bezeichnet er das in einem Wald jenseits der Seine-Höhenzüge gelegene Tal, in dem der Österreicher sich vor Jahren ein Haus gekauft hat. In einem breit angelegten Erinnerungsprozess beschreibt der meist im Freien, an verschiedenen Plätzen im Wald sitzende Schriftsteller minutiös seine Suche nach dem Wesen der Dinge und Begebenheiten, dabei einer Ästhetik folgend, die den Prozess der Wahrnehmung als solchen im Fokus hat. Die erhabensten Momente sind für ihn die Augenblicke, in denen er sich mit dem, was er unermüdlich erschaut hat, in stillem Einklang befindet.
Im mittleren Teil dieses Buches vom Scheitern werden märchenartig die Geschichten seiner sieben auf der ganzen Welt herumstreunenden Freunde dargestellt, zu denen er auch seinen Sohn zählt. Auf die Kritik seiner Frau an seinem sehr speziellen, anspruchsvollen Schreibstil reagierte er gereizt: «Und wenn ich dann weiterwetterte gegen die Bücher, die keinen Erzähler mehr hätten, sondern einen Conférencier, gegen alle die Lesefutterknechte mit einem so aufbereiteten Stoff, dass daran mehr zu lesen bliebe, meinte sie, neidisch sei ich auch». Die Problematik dieser in sich selbst kreisenden, narrativen Form wird überreich kompensiert durch eine fast unglaubliche sprachliche Präzision, eine üppige, oft verblüffende Wortgewalt. Diese im Kern spröde Beschreibungskunst widmet sich gleichermaßen detailliert und gekonnt der Natur und den Dingen wie auch den Menschen und der Gesellschaft in ihrem Wesen, - Politik, Ökonomie oder Psyche werden dabei rigoros ausgeblendet. Letzteres aber gilt nicht für ihn selbst, als Solipsist beschäftigt er sich unablässig mit sich selbst, mit jeder noch so kleinsten Regung seines depressiv veranlagten Gemüts.
Diese Utopie des Erzählens ohne Handlung ist für den Leser ein strenges Exerzitium, in dem der langatmige Umweg das Ziel ist. Also nichts für «Lesefutterknechte», bei denen allein der Plot zählt und nicht eine Sprachkunst, welche die stimmigen Bilder im Kopf sinnlich durch Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken zu ergänzen vermag, - fürwahr eine selten anzutreffende narrative Fähigkeit!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich