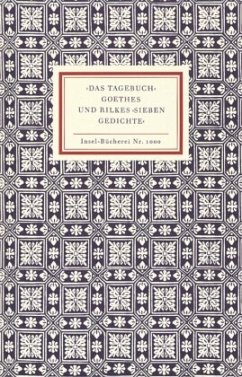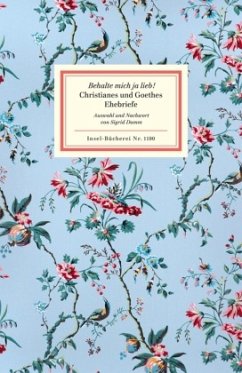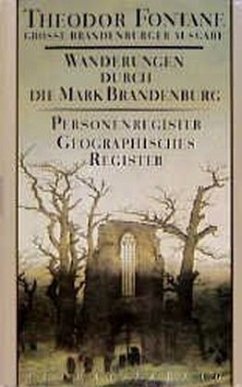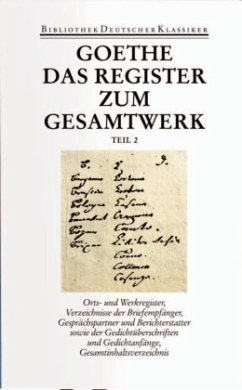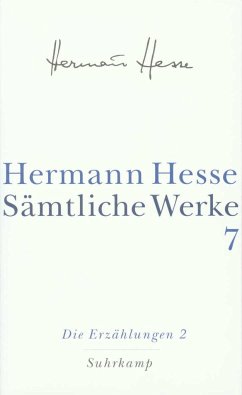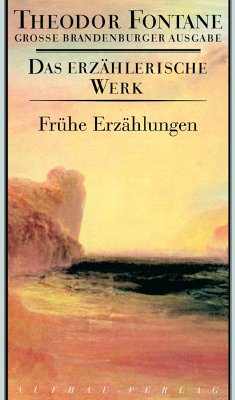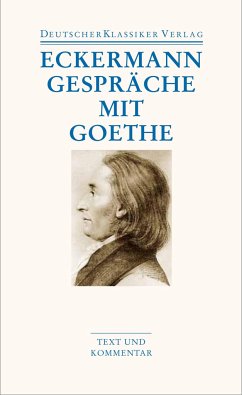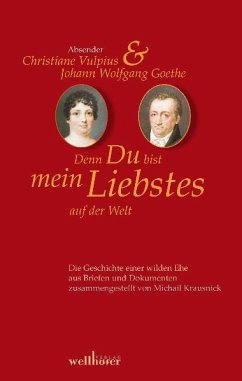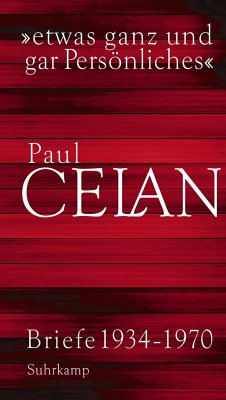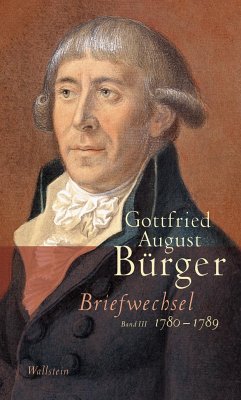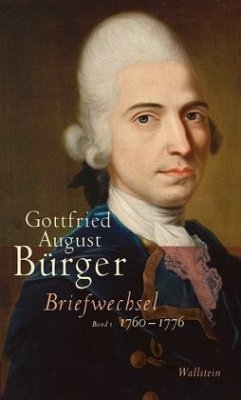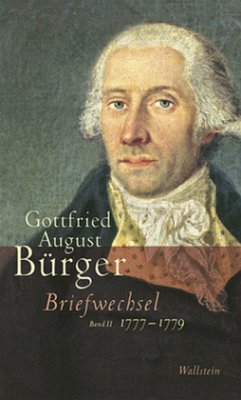durch Feuer randverziert, wohl aber von jener Glut erfüllt, die Frau von Stein über zehn Jahre hinweg lebendig erhält, indem sie verzehrende Stichflammen geschickt unterbindet. Das vertrauliche "Du" untersagt ihm die seit 1764 mit dem Stallmeister Josias von Stein verheiratete, nach sieben Schwangerschaften auch erschöpfte und etwas einsame Frau noch lange. Überhaupt stutzt sie den brauseköpfigen Stürmer und Dränger auf hofgefälliges Benehmen zurecht, wozu auch kalkulierte Besuchsverbote gehören.
Goethe deshalb aber für den allein Werbenden zu halten, der die Beziehung seit dem Brief vom 1. Mai 1776 als "eine anhaltende Resignation" ausgibt, wäre falsch. Vielmehr ist diese Lotte in Weimar noch vor Goethes Ankunft durch dessen Lotte in Wahlheim tief entflammt. Den befreundeten Arzt Johann Georg Zimmermann bittet sie um eine Charakteristik des umjubelten Schöpfers des "Werther" und erhält von diesem Postillon d'Amour nebst einem aus Lavaters "Fragmenten" getrennten Stich der begehrten "Adlerphysiognomie" (welche Barbarei!) den verlockenden Wink, dass "dieser liebenswürdige und bezaubernde Mann Ihnen gefährlich werden könnte!". Umgekehrt schürt Zimmermann Goethes Neugierde mit Lottes Silhouette, der sogleich im überschwänglichen Ton der Modephysiognomen auf dem Blättchen notiert: "Naivetät und Güte, selbstfließende Rede". So bahnte man damals Romanzen an.
Dass diese beiden Seelen, "unzertrennlich" aneinander "angewachsen", nie "sichtlich und gesetzlich" durch "irgend ein Gelübde oder Sakrament" zusammenfanden, wie es am 12. März 1781 "Nachts halb 11 Uhr" heißt - Goethe schrieb oft nach der abendlichen Trennung -, ist sicher den Umständen geschuldet. Aber nicht allein. Denn je länger man in diesen Botschaften liest - ihre Gegenbriefe verlangte Charlotte später zurück, um sie zu vernichten -, desto stärker entsteht der Eindruck eines kunstvollen Liebesspiels. Das geheime Drehbuch dafür mag das Romandebüt abgegeben haben, wie Jan Volker Röhnert in seinem schönen Nachwort meint: So habe Werther in Weimar mit Charlotte von Stein den Roman gleichsam nachgespielt und unter den neuen Eindrücken für die zweite Auflage überarbeitet, um sich dann 1786 nach Italien davonzumachen. Was unmittelbar davor geschah, gab schon Anlass zu vielfältigen Spekulationen. Goethe wäre indes nicht der erste oder letzte Dichter der Literaturgeschichte gewesen, der es sprachlich und stilistisch bei den Frauen am weitesten brachte und floh, sobald es richtig eng zu werden drohte.
Das Konzept der Hohen Liebe schimmert auf Schritt und Tritt durch dieses Arrangement. Gleich unter den ersten Sendungen findet sich das berühmte Briefgedicht "Warum gabst du uns die Tiefen Blicke / Unsre Zukunft ahndungsvoll zu schaun" mit den obligatorischen Klagen des Liebessängers: "Nur uns Armen liebevollen beyden / Ist das wechselseitge Glück versagt". Das Gegenstück zu dieser Minne im fast mittelalterlichen Sinne ist die körperliche Liebe, die Goethe an Karl August bei ihren gemeinsamen launigen Ausritten in die thüringische Landschaft ebenfalls in Versen festhält: "Der Prinz ist gut gesinnt für's Bett / Und ach wenn ich ein Misel hätt, / So schwäzzt ich nicht mit Baasen." Charlotte erfüllt indes nicht nur die Rolle als Zuhörerin und Gesprächspartnerin - "Ich halte mich glücklich, daß mir beschieden ist, seine goldnen Sprüche zu hören" -, sondern ausdrücklich auch als Seelenfreundin, Mutter, Schwester, wenn nicht "Madonna" oder "Engel". Das Briefgeständnis vom 2. Dezember 1781 zeigt, wie tief sich Goethe in die gegenläufigen Liebesentwürfe verkeilt hatte: "ich habe die ganze Nacht von dir geträumt. Unter andern hattest du mich an ein artiges Misel verheurathet und wolltest es solle mir wohlgehn." Als dieser Fall dann nach der Rückkehr aus Italien ohne Heirat eintritt, denunziert die tief gekränkte Frau von Stein die unschuldige Christiane Vulpius als "Hure", was damals jede Frau in außerehelicher Beziehung bezeichnen konnte.
In erster Linie sind Goethes Briefe an Charlotte von Stein ein literarisches Ereignis. Gerade weil ihm diese Liebe "so heilig sonderbar" war, wie es am 8. August 1776 heißt, dass sie "nicht mit Worten ausgedrückt werden" kann, wird sie so ausdauernd und variantenreich gepriesen. Zugleich war ihm seine "Einzige" aber auch Muse und Anregerin für die Dichtung: In den wohl schon 1784 entstandenen Versen des Gedichtes "Zwischen beiden Welten" erhebt Goethe sie neben Shakespeare zur wichtigsten Quelle seines Schreibens: "Lida! Glück der nächsten Nähe, / William! Stern der schönsten Höhe, / Euch verdank ich was ich bin".
Seinen Stern Lotte kürzt Goethe im Tagebuch mit dem astronomischen Zeichen der Sonne ab. Die Eintragungen sind aber äußerst knapp, ständig etwa: "Mit .
· gessen" oder "Abends zu .· ". Statt Ereignisse und Fakten bloß festzuhalten, entfalten Goethes Briefe an Frau von Stein seine tägliche Sicht auf das Leben, halten Begegnungen und Überlegungen fest, zeigen ihn in mannigfachen Rollen - als Dichter, Naturforscher, Staatsmann, Diplomaten oder Reisenden. Als diese Briefe 1848 erstmals aus dem Nachlass Charlottes ediert wurden, begrüßten Biographen sie als wiedergefundenen Schatz. Denn "Dichtung und Wahrheit" endet mit dem Wechsel nach Weimar, und die "Italienische Reise" oder die "Campagne in Frankreich" schließen sich erst noch an. Für das erste Weimarer Jahrzehnt ist kaum eine Quelle wichtiger.
Jan Volker Röhnert hat sich entschieden, seiner neuen Edition die - antiquarisch immer noch günstig verfügbare - dreibändige Insel-Ausgabe von 1907 zugrunde zu legen. Der damalige Herausgeber Julius Petersen hat eine Auswahl der Sammlung über mehrere Auflagen hinweg populär gemacht. Inzwischen sind natürlich Ergänzungen aufgetaucht, die sich etwa in den Nachtragsbänden zur Weimarer Ausgabe von 1990 finden. Davon nimmt Röhnert aufgrund seiner Vorentscheidung ebenso wenig Notiz wie von der historisch-kritischen Edition von Goethes Briefen durch die Klassik-Stiftung Weimar. Die legt im dritten (2014) und sechsten Band (2010) die Korrespondenzen von 1775 bis 1779 sowie 1785 bis 1786 in größter Vollständigkeit und philologischer Akribie vor.
Die Bemerkung, dass von "künftigen kritischen Editionen der Goethe-Briefe", die es also zum Teil bereits gibt, außer Revisionen in der Reihenfolge keine Überraschungen zu erwarten seien, wirkt unnötig abfällig. Denn mit der umfangreich kommentierten kritischen Ausgabe wollen Röhnerts hilfreiche Annotationen und Übersetzungen französischsprachiger Briefe gar nicht erst in Konkurrenz treten. Sein Ziel ist viel eher eine bibliophile Ausgabe: Limitiert auf 4444 numerierte Exemplare, durchschossen mit lindgrünen und rosa Zwischentiteln, liegen so die beiden prachtvollen Bände 360 und 361 der Anderen Bibliothek in der gewohnt hohen gestalterischen Qualität vor. Sie versprechen ein Lesevergnügen der ganz besonderen Art.
ALEXANDER KOSENINA
"Lotte meine Lotte". Die Briefe von Goethe an Charlotte von Stein, 1776-1787. Nachwort von Jan Volker Röhnert.
Die Andere Bibliothek, Berlin 2014/2015. 2 Bände, geb., 735 S., 76,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main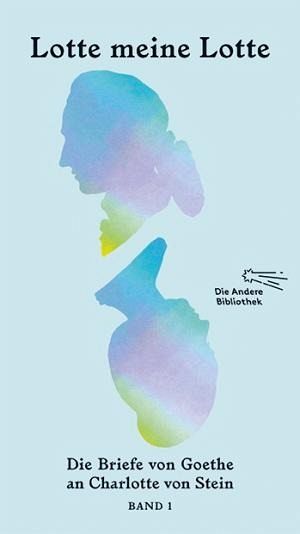
















 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.01.2015
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.01.2015