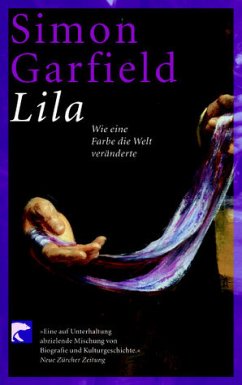Produktdetails
- Verlag: Berliner Taschenbuchverlag
- ISBN-13: 9783442761074
- ISBN-10: 3442761077
- Artikelnr.: 21966820

Simon Garfield schildert die Farbe Lila ohne roten Faden
Um Ostern 1856 sitzt William Perkin, ein Siebzehnjähriger, der eben begonnen hat, am Royal College die Vorlesungen des Chemikers August Wilhelm von Hofmann zu besuchen, zu Hause in London. Er sitzt da vor ein paar schmutzigen Reagenzgläsern und denkt über die Erzeugung von künstlichem Chinin nach. Bei seinen Versuchen, das kostbare Malariamittel chemisch herzustellen, geht der junge Student naiv, aber, so der Chronist, "von echtem Forscherdrang beseelt" vor. Durch die Destillation von Steinkohlenteer erhält er Anilin, mit einigen weiteren simplen Additions- und Subtraktionsverfahren endet er bei einem Stoff, der bis dahin jeden Forscher kalt ließ - gerade dreißig Jahre zuvor hatte der preußische Chemiker Otto Unverdorben sein so gewonnenes Indigo für Unrat angesehen und ausgegossen. Nicht so Perkin. "Mauvein", wie er den Farbstoff Lila tauft, heilt nicht, färbt aber teuflisch!
Zur Patentanmeldung und her mit einer Fabrik dafür! In der Frühzeit der Industrialisierung ist England die führende Wirtschaftsnation. Selbst die Weltwirtschaftskrise von 1857 scheint den Aufbau des Unternehmens nicht wirklich beeinträchtigt zu haben. Als Perkin fünfunddreißig ist, verkauft er seine Fabrik zur Erzeugung synthetischer Farben und zieht sich mit 100 000 englischen Pfund auf dem Konto ins Privatleben zurück.
Dieser Geschäftserfolg mit der ersten synthetischen Farbe, dem Lila, gründete sich, wie alles in der Mode, auf der Kombination von Schönheit und Massenhaftigkeit der Herstellung. Zuvor gehörte das Färben zu den umständlichen Tätigkeiten. Die oft tagelangen Verfahren mit kostbaren natürlichen Ausgangsstoffen wie Färberwaid und Krapp, Cochenille, Indigo und Färbereiche wurden wie eine Geheimwissenschaft von einer Generation an die nächste weitergereicht und blieben über Jahrhunderte beinahe dieselben. Perkin aber machte Buntheit zum bürgerlichen Volksbegehren und löste mit seiner Erfindung geradezu eine "folie mauve", einen Lilawahn der Damenwelt des neunzehnten Jahrhunderts im Gefolge der Kaiserin Eugenie und Queen Victorias aus. In Charles Dickens' Wochenzeitschrift "All the Year round" heißt es dazu: "O Mr. Perkin, haben Sie Dank dafür, daß Sie aus dem Kohlenkeller diese kostbaren purpurfarbenen Streifen und Bänder auf die Sommerkleider gezaubert haben, die uns auf den Straßen des West End wie Frangipaniblüten umwehen und törichte Junggesellen zu kühnen Vorschlägen und Träumen von Liebe und Landleben verführen."
Für solche lila eingefärbten Träume zahlte vermutlich mancher Arbeiter einen dermatologisch beschreibbaren Preis. Weniger heiter sind darum die Vertuschungsversuche von Vergiftungsfällen durch synthetisch gefärbte Kleider. "Wir möchten", setzt sich die BASF 1884 gegen die Anwürfe zur Wehr, "darauf hinweisen, daß bei den Arbeitern unserer Fabrik Haut und Speichel immer intensiv verfärbt sind, daß sie aber dessen ungeachtet vollkommen wohlauf und gesund sind, und daß ihre Sterblichkeit im Vergleich zu der von Arbeitern, die nie mit Farbstoffen zu tun haben, sehr gut abschneidet."
Abgesehen von der auffälligen Unbestimmtheit der Schlußwendung - könnte es sein, daß alle anderen Arbeiter eben mit anderen, nicht weniger giftigen Stoffen in Berührung waren? Noch schlechter dran waren nur die tatsächlichen Versuchskaninchen. Ihnen wurde zur Erprobung der Farbeigenschaften wochenlang der Hafer mit starken Lösungen von Magenta, Violett, Braun und Orange versetzt. In der Tatsache, daß sie ihn dennoch fraßen und weiß blieben, fand die Farbindustrie ihren Unschuldsbeweis.
Die Geschichte der Farben, ihrer Erzeugung und Verwertung in der Warenwelt ist also selber farbenreich. Das macht es reizvoll, eine solche Geschichte zu schreiben - aber auch riskant. Denn was genau wäre ihr Thema, die Geschichte wovon wäre hier zu schreiben? Eine Industrie-, eine Technik-, eine Konsumgeschichte? An Simon Garfields Buch über die Farbe Lila läßt sich erkennen, wie schwer es fallen kann, sich auch nur zu dieser Frage durchzuringen. Der Autor hat keinerlei Distanz zu seinem Gegenstand. Alles wird ihm zur Nachgeschichte der Erfindung seines Helden. Die Vita seines viktorianischen Erfinders aus Versehen, eines Abstinenzlers und Predigerverpflegers, vermengt er sprunghaft mit Exkursen zur gegenwärtigen Profitträchtigkeit der Chemie. Genies und Trendscouts der Farbenindustrie werden geehrt. Mit verschmocktem Humor berichtet Garfield davon, in Amerika sei ein Spray entwickelt worden, mit dem Frauen sich Gewißheit über erotische Eskapaden ihrer Männer verschaffen können. Auf die Intimwäsche vermutet untreuer Gatten aufgetragen, färbt es vorhandene Indizien lila. Ob das die Welt wirklich zu einem besseren Ort macht, läßt Garfield immerhin offen. Inwiefern es in die Geschichte des Mauvein gehört, leider auch.
Genauso unterschiedslos und ohne Sinn für die Frage, was eigentlich sein Thema ist, reiht Garfield Informatiönchen aus dem Leben seines Helden aneinander. "Noch vor dem ersten Gang - es gab Austern - konnten sich die Gäste, die mit ihrem Tischnachbarn nicht recht glücklich waren, in die Einzelheiten der Perkinschen Erfindung vertiefen", heißt es in Beschreibung eines festlichen Abendessens zu Ehren Perkins anno 1906. Der Autor dokumentiert die Speisenfolge und weiß ferner zu berichten, daß alle Herren unter den vierhundert Anwesenden lilafarbene Fliegen trugen, die ihnen im Vorfeld der Veranstaltung zugeschickt worden waren, sowie zu fünfzig Prozent Schnurrbärte. Er kann nicht an sich halten, die Villa des reichgewordenen emeritierten Fabrikanten zu beschreiben und endlich - hier ist Trauer Chronistenpflicht - die Beschriftungen der Kranzschleifen für die Ewigkeit festzuhalten. Garfield pflückt jedes Blümlein am kulturgeschichtlichen Wegesrand, ob es zum Gebinde paßt oder nicht.
In der Person des 1838 in London geborenen, abgebrochenen Chemiestudenten und Fabrikbesitzers Perkin idealisiert der Autor Garfield einen Mann, über den er außer den biographischen Eckdaten und minimalinvasiven Anekdoten nicht viel zu berichten weiß. Die Leerstellen füllt er mit Geschwätzigkeit. Aus dem Chemielabor des Privatforschenden Perkin hörte man nie wieder etwas. Garfield weiß aber natürlich, was sein zu Unrecht früh in Vergessenheit geratenes Genie eigentlich tat: "Perkin arbeitete in der evangelischen Kirche mit, veranstaltete wöchentliche Treffen mit durchreisenden Predigern und sammelte Geld für eine Orgel. Privat übte er Mildtätigkeit, Mäßigung und Abstinenz." Die Kulturgeschichte ist bunt, aber konturenlos.
Auch das zweite Strukturproblem des Buches hängt mit Garfields gar nicht stiller Heldenverehrung zusammen. In mehreren Exkursen in die Gegenwart versitzt er seine Zeit in den chemischen Labors der heutigen Textilindustrie und gibt die Ansichten maßgeblicher Farbtrendscouts so ausführlich und begeistert wieder, als diene sich sein Buch als Werbegeschenk für Anilinwerke an. Die an sich interessante Beobachtung, daß in Zeiten knapper werdender natürlicher Ressourcen wie Kohle und Öl sich die Textilindustrie wieder natürlicher Färbeverfahren erinnert, wird hingegen nur nachgereicht.
Wenn nach der Lektüre eines zweihundertdreißig Seiten langen Sachbuches der Eindruck zurückbleibt, es hätte ein lohnenswerter Aufsatz von dreißig Seiten werden können, darf der Leser befinden, er habe Zeit verschwendet. Leider drängt sich dieser Eindruck nicht erst gegen Ende des Bandes auf. Besteht der Fehler des Autors also in der Wahl seines Sujets, darin, daß hier etwa ein Fußnotenthema vorläge? Man mag es kaum glauben. Die Erfindung des künstlichen Farbstoffs Mauvein hatte unmittelbare wirtschaftliche und modische Auswirkungen, sie zeitigte später Folgen in Chemie und Medizin. Vor allem ereignete sie sich aus ökonomischer Sicht Mitte des neunzehnten Jahrhunderts offenbar gerade zum rechten Zeitpunkt.
Das kommt denn bei Garfield auch alles irgendwie, irgendwo vor. Handelte es sich bei dem vorliegenden Buch also um eine lesbare Entstehungsgeschichte der chemischen Farbenindustrie und ihrer umfangreichen wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, ökologischen, medizinischen und modischen Folgen, so hätte Garfield auf Wißbegierde rechnen dürfen. Aber der Autor hat eins nicht bedacht, und kein Lektor hat es ihm gesagt: Gerade eine Geschichte der Farben braucht einen roten Faden.
WIEBKE HÜSTER
Simon Garfield: "Lila". Wie eine Farbe die Welt veränderte. Aus dem Englischen von Hainer Kober. Siedler Verlag, Berlin 2001. 252 S., geb., 39,90 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main