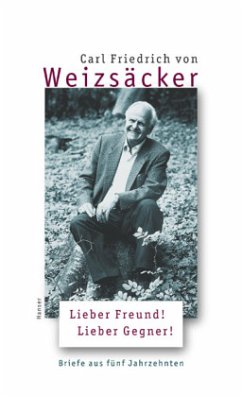Carl Friedrich von Weizäcker ist ein leidenschaftlicher Briefschreiber. Er hat neben einem reichen schriftstellerischen Werk als Wissenschaftler und als in das Zeitgeschehen eingreifender Intellektueller eine weitgespannte Korrespondenz mit Persönlichkeiten aus aller Welt geführt. Manche Briefe sind kleine Essays, manche resümierende Botschaften und manche emotionale oder drängende Appelle. Eine lebendige Dokumentation einer außergewöhnlichen Biografie und eines halben Jahrhunderts Zeitgeschichte.

Carl Friedrich von Weizsäcker schreibt in Briefen, was er alles überlesen hat / Von Achim Bahnen
Der Wissenschaftler ist nie nur Wissenschaftler". Wie ein Lebensmotto ragt dieser Satz aus der Einleitung heraus, die Carl Friedrich von Weizsäcker im Sommer 1946 einer Vorlesung über "Die Geschichte der Natur" voranstellte. Der Physiker wandte sich an Hörer aller Göttinger Fakultäten - im Bewußtsein des allgemeinen Bedürfnisses nach einem Weltbild, "das uns in der Verworrenheit unseres Daseins einen Halt böte". Halt bot dem Naturwissenschaftler zunächst die äußere Natur: der Kosmos, Galaxien, die Sterne. Doch dabei konnte es nicht bleiben. "Der Natur widerfährt ihre Geschichte, aber sie erfährt sie nicht." Wer von der Natur redet, darf vom Menschen nicht schweigen. Und so schloß Weizsäcker seinen Zyklus mit einem Vortrag über die "innere Geschichte" des Menschen, sprach über Freiheit, Transzendenz und Religion, von Leiden, Schuld und Macht. "Erkenntnis ohne Liebe" sei das Wagnis des neuzeitlichen Menschen. Der Redner zählte zu der Zeit kaum vierunddreißig Jahre, doch wenn man diese Texte liest, wird der Eindruck unabweislich, Carl Friedrich von Weizsäcker sei schon damals ein alter, weiser Mann gewesen.
Der Wissenschaftler ist nie nur Wissenschaftler: Für diese Einsicht hätte Weizsäcker wohl nicht der Atombombe bedurft, doch sein direktes Erleben dieser maßlosen Macht hat ihn zur immer neu versuchten Rechenschaft getrieben. Ein Homo politicus ist Carl Friedrich anders als sein jüngerer Bruder Richard nie geworden, die Wissenschaft war ihm bei allem Bemühen, der "Rakete der Menschheit" einen auch nur tangentialen Schub zu geben (so ein Bild in dem Band "Bewußtseinswandel" von 1988), stets Ausgangspunkt und Rückzugshort.
Der Wissenschaftler ist nie nur Wissenschaftler: Es ist die Schlichtheit solcher Sätze, die Weizsäckers Sprache geprägt und seine Wirkung gefördert hat. Es kann nicht verwundern, sie auch in einer Auswahl seiner Briefe zu finden, die nun drei Monate vor Vollendung seines neunten Lebensjahrzehnts erscheint. Der Wirkung solcher Sätze war sich der Autor wohl bewußt: "Ich gebe zu, daß ich manche Dinge vielleicht verhältnismäßig gut und eindrucksvoll formulieren kann", schreibt er im Juni 1957 an die Pazifistin Klara-Marie Faßbinder, um ihre Bitte, einen Vortrag zu halten, dann doch abzulehnen. Seit April des gleichen Jahres, kurz vor seinem Wechsel nach Hamburg auf einen Lehrstuhl für Philosophie, häuften sich die Anfragen, denn mit der "Göttinger Erklärung" von achtzehn Atomphysikern gegen eine atomare Bewaffnung Deutschlands hatte Weizsäcker große Aufmerksamkeit erlangt.
Weizsäckers Bewußtsein für die eigene Wirkung ist auch in vielen seiner Schriften von einer Bescheidenheit gebändigt, die zuweilen kokett erscheinen mag. Als er drei Jahrzehnte später der Bitte um Beteiligung an einem Aufruf gegen Naturzerstörung nicht nachkommt, heißt es flapsig: "Ich war ein geeigneter Initiator der Göttinger Erklärung, weil ich 45 Jahre alt war und den alten Herren, die das nie zustande gebracht hätten, die Arbeit abnahm." Die Rolle als zwar oft im Hintergrund wirkende, aber doch treibende Kraft mochte Weizsäcker nur selten offen eingestehen, als wäre ihm die Öffentlichkeit stets suspekt geblieben. Konrad Lorenz gegenüber, den er 1972 für einen Aufruf zugunsten einer Ratifizierung der Ostverträge gewinnen möchte, beteuert er seine eigene Skepsis "gegenüber der Methode der Politik durch öffentliche Erklärungen, an deren Aufkommen ich ja nicht ganz unschuldig bin".
Vor der "Göttinger Erklärung" war es Weizsäcker fünf Jahre lang gelungen, "für längere Zeit alles öffentliche Sprechen ganz zu unterlassen", wie er vom Mai 1952 an - hierhin datiert der erste abgedruckte Brief - gegenüber einer Reihe von Adressaten beteuert. Immer wieder ist dabei die Last zu spüren, die ein solches Sprechen, aber eben auch das Schweigen bedeutete. Dem "lieben, verehrten Herrn Heidegger" bekennt Weizsäcker, daß dieser wohl "an allen meinen frühen Äußerungen das nicht zu Ende Gedachte deutlich wahrgenommen haben" werde.
Gerade das nicht zu Ende Gedachte aber sollte immer mehr zum Stilprinzip von Weizsäckers Publikationen werden. Die Göttinger Vorlesung von 1946 erscheint fast wie aus einem Guß, wenn man sie mit späteren Büchern vergleicht, die das Vorläufige und Fragmentarische oft gar nicht verbergen wollen. Und immer wieder wird dabei inmitten aller großen Menschheitsfragen in Natur- und Geisteswissenschaft die eigene Existenz zum Thema. "Statt einer Zusammenfassung" steht am Ende der unter dem Titel "Der Garten des Menschlichen" 1977 vorgelegten Beiträge zur geschichtlichen Anthropologie eine "Selbstdarstellung", als wolle der Autor sagen: Wer von der Menschheit spricht, darf von sich selbst nicht schweigen. Die Vielzahl der persönlichen Zeugnisse, der Rechenschaften und Bemühungen um Selbstvergewisserung in Weizsäckers Werk legt die Frage nahe, was von einer Auswahl seiner Briefe zu erwarten sei.
Private Petitessen fehlen fast völlig. Kaum einmal eine Bemerkung wie im November 1955 an Heisenberg, daß München "doch von den deutschen Großstädten, auch für jemanden, der nicht dort aufgewachsen ist, die anziehendste" sei, verbunden mit der Frage an den Freund und Lehrer, "ob es im Herzogpark ... nicht doch etwas feucht und neblig ist", um dort ein Grundstück zu kaufen. Und nur ganz selten ist ein humorvoller Ton wie an den Physikerkollegen Max Delbrück zu hören, dem Weizsäcker gesteht, daß er ihn "damals im Stillen auch für einen Abtrünnigen von der Bohrschen Weisheit gehalten habe". An jenem 1. Februar 1956 muß der Schreiber schon sehr gut aufgelegt gewesen sein, daß er mit der Pointe schließt: "Der einzige von Ihren Wünschen, der meiner Meinung nach unerfüllbar ist, ist, daß bis zu Ihrem Kommen ein guter Zug zwischen Göttingen und Köln fahren wird."
Der lebendigste Eindruck vom Autor entsteht dem Leser durch die ständige Entschuldigung für verspätete Antworten und nicht gelesene Bücher. Entwaffnend ehrlich schreibt Weizsäcker dabei an Popper, daß er über dessen "Logik der Forschung" Vorlesungen gehalten und auch zum Abdruck gebracht habe, obwohl er in Poppers Hauptwerk früher nur "ein wenig und unsystematisch herumgelesen" habe. Im Vordergrund aber stehen die Sachfragen sowie die Verzahnung von Weizsäckers Lebensweg in den vergangenen fünf Jahrzehnten mit der Zeitgeschichte. Die Ergänzung der wichtigsten Nachkriegsthemen Frieden und Freiheit um Fragen der (globalen) Gerechtigkeit und des Umweltschutzes läßt sich in diesen Zeugnissen ebenso verfolgen wie die Bemühung um Einfluß auf die Politik und später - im sogenannten konziliaren Prozeß - auf die Kirchen.
Zu einem intellektuellen Lebensbild oder einer Einführung in Weizsäckers Denken fügt sich die Auswahl dennoch nicht. Zum einen ist sie allzu lückenhaft, in der zeitlichen Abfolge (zwischen Februar 1958 und Januar 1971 steht nur ein Brief an Otto Hahn) nicht anders als in den Briefbezügen. Zum anderen ist vieles unbedeutend oder aber redundant (im Vergleich mit den bereits publizierten Schriften ebenso wie in der Abfolge der Briefe). Terminabsprachen zur Verleihung des Sigmund-Freud-Preises wurden wohl nur des Ereignisses wegen abgedruckt. Eine Beschränkung hätte gewiß den Verzicht auf einige schmückende Namen bedeutet, die Lesefreude aber deutlich erhöhen können. Diese wird zudem durch den bescheidenen Kommentar getrübt. Den nötigsten biographischen Angaben zu den Adressaten sind Anmerkungen zu einzelnen Briefen und Anlässen beigefügt, die jedoch nicht im Ansatz vollständig sind und in der Gewichtung zufällig erscheinen. In vielen Fällen erhält der Leser gar keine Aufklärung, erfährt dagegen Wohlbekanntes über die Befreiungstheologie.
Die Chance, eine für die Nachkriegsrepublik so symptomatische wie prägende Gestalt zu Lebzeiten in Briefform noch einmal packend zu vergegenwärtigen, vielleicht sogar die Aktualität zentraler Denkmotive aufzuzeigen, wurde somit vertan. Nur wer lange stöbert, stößt auf so prägnante Rückblicke wie den an Jürgen Habermas, den langjährigen Kollegen am Starnberger Max-Planck-Institut: "Ich wollte gerne den militanten Linken, die ich ans Institut geholt hatte, einen wohlausgewiesenen linken Direktor servieren, der sie endlich zu law and order nötigen würde. Und das haben Sie ja auch aufs Vollkommenste getan."
Carl Friedrich von Weizsäcker: "Lieber Freund! Lieber Gegner!" Briefe aus fünf Jahrzehnten. Ausgewählt und mit Anmerkungen versehen von Eginhard Hora. Hanser Verlag, München 2002. 400 S., geb., 24,90
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Der Physiker Carl Friedrich von Weizsäcker kann auf ein beeindruckendes Leben zurückblicken, das Rezensent Michael Hampe in seiner Besprechung auch recht ausführlich Revue passieren lässt. Pünktlich zum neunzigsten Geburtstag Weizsäckers hat der Hanser Verlag nun eine Briefesammlung aus fünf Jahrzehnten herausgegeben, die viel über Weizsäckers Interessen. Qualifikationen und Engagement verraten, so der Rezensent. So enthält dieser Band auch die 1957 veröffentlichte "Göttinger Erklärung", in der sich 18 Atomphysiker gegen eine atomare Aufrüstung der Deutschen ausgesprochen hatten, sowie eine ganze Reihe aufschlussreicher Briefe an Politiker, Vertreter der Kirchen, Philosophen und Naturwissenschaftler. Der Band kann zwar nicht, meint Hampe, die Lektüre von Weizsäckers Büchern ersetzen, aber allemal dazu "anregen". Leider, bedauert der Rezensent, enthält die Briefesammlung weder ein Inhaltsverzeichnis noch ein Register, so dass sich der Leser die Mühe machen müsse, bestimmte Adressaten "aufs Geratewohl" zu finden.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH