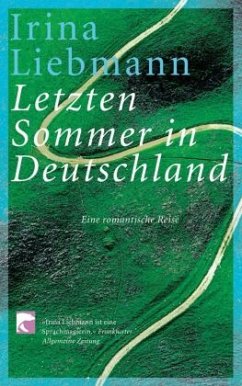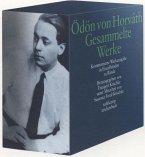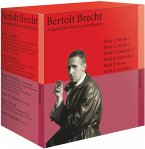Irina Liebmann ist nach der Wiedervereinigung auf eine lange Reise gegangen, auf eine Reise durch das eigene, das veränderte Land. Was ist los im Deutschland von heute? Die Autorin lässt ihren Blick schweifen auf ihrem Weg von Frankfurt an der Oder bis an den Rhein im Westen. Und so entstanden zauberhafte Porträts von Menschen und Städten, von Kirchen, Fabriken und Landschaften; es entstand ein einzigartiges Reisebuch, zugleich ein glänzendes Stück Literatur. Niemanden gelingt es so wie Irina Liebmann, eine subjektive, zeitgenössische Bestandsaufnahme eines Landes im Umbruch darzustellen.

Touchiert: Irina Liebmann verbringt einen Sommer in Deutschland
Im Sommer 1996 verläßt eine Frau in einem Honda die deutsche Hauptstadt, das ganze Land zu erkunden. Ein gutes Jahr später liegt ihr Reisebericht als Buch vor, 285 Seiten dick. Daß die Reisende hinschauen und darüber schreiben kann, hat Irina Liebmann mit ihren literarischen Reportagen über Berliner Verhältnisse bewiesen und dafür einigen Ruhm in die Scheuer fahren können. Aber Berlin, das waren Heimspiele. Im Vergleich dazu ist dieses Unterfangen eher eine Expedition, und um die Wegstrecken zwischen den Etappenzielen - es sind siebzehn - physisch überstehen zu können, versorgt sie sich regelmäßig bei Abfahrt mit einer Flasche Mineralwasser. Sie kommt auch immer an. Nicht unbedingt da, wo sie hinwollte, weil sie zum Beispiel auf die Ausfahrtsspur zu einem nicht geplanten Ort gedrängelt wurde. Aber das ist nicht weiter schlimm, denn meist hat auch dort mal eine Dichterin gewohnt, oder es gibt zumindest auskunftswillige Menschen beim Arbeits-und Kulturamt.
Was ist nun zu sagen zu den Ergebnissen dieser Reise? Das wird die Autorin auch gefragt, auf Seite 181, nach zwei Dritteln der literarischen Wegstrecke, in Nürnberg in einer Frauenwohngemeinschaft. "Ich sagte, ich hätte gesehen, daß die Fabriken verschwinden und die Burgen und Kirchen stehenbleiben." Nun, die längere Halbwertzeit letztgenannter Bauwerke in unseren Breiten ist bekannt. Sollte es das schon gewesen sein, die Quintessenz dieses Forschungsberichts? Aber nicht doch, denn bald darauf, in Ingolstadt, besichtigt sie die Werkshalle einer Automobilfabrik, und deren Vitalität kann es wohl mit der von Burg Eltz und Kölner Dom gleichzeitig aufnehmen. Die Autorin schreibt jedenfalls voller Bekennermut: "In dieser Halle habe ich mich ergeben, ich habe die Fronten gewechselt . . . Zum ersten Mal im Leben war ich nicht dagegen." Wie die vorherige Frontstellung nun aussah (Nieder mit den hochtechnisierten Fertigungsstraßen für erfolgreiche Produkte! - ?), bleibt dunkel. Manchmal fehlt eben etwas.
In Haus Wahnfried zum Beispiel ein Hitler-Bild. In Bayreuth war die Autorin vor Nürnberg, und daß der größte Feldherr aller Zeiten auch als der größte Wagner-Fan aller Zeiten glänzte, nicht zuletzt wegen Winifred, ist ihr bekannt. Aber weder auf dem Festspielhügel noch im Stadtmuseum findet sie Hinweise auf den prominenten Bayreuth-Besucher. Das wirft bei ihr die Frage auf: "Wieso wurde er hier so verleugnet?" Die Antwort weiß vielleicht der Wind. Oder Wolfgang Wagner. Irina Liebmann jedenfalls reicht sie an die Leser weiter.
Das ist paradigmatisch: Vieles wird touchiert in diesem Bericht, erweckt Neugier auf mehr, die Erzählung eines LPGlers in Zschopau etwa oder auch die Entdeckung der Autorin, daß ihre Freundin in Dresden gar nicht mehr ihre Freundin ist. Es habe wohl damit zu tun, daß sie die Wende nicht vor Ort erlebt habe, mutmaßt die 1988 in den Westen Übersiedelte, aber das ist es dann auch. Alle Bretter bleiben angebohrt, Irina Liebmann muß schließlich weiter. Geliefert wird so eine bunte Postkartensammlung, deren Motive bisweilen schön gezeichnet sind, einem aber fast ausnahmslos bekannt vorkommen. Und weshalb gerade diese der Berichterstatterin von Belang sind, ist nicht nachvollziehbar, weil dieses Ich, das ständig "Ich" sagt, kaum etwas von sich mitteilt. Dafür wird dann aber die italienische Bar, die sich heute in Marielouise Fleißers ehemaligem Tabakgeschäft in Ingolstadt befindet, als "voll, überfüllt beinahe" beschrieben und der Tatbestand dann beglaubigt durch ein Foto, auf dem genau eine (nicht füllige) Person an der Theke zu sehen ist. Ähnlich lichtbringend wie die bildhafte Anreicherung ist der häufige Wechsel des Prosa-Fließtextes in ein Druckbild, das den Anfangsverdacht nährt, hier könne es sich wieder um eine lyrische Passage handeln.
Der Verdacht bestätigt sich fast nie, es muß sich vielmehr um periodisch auftretende unwillkürliche Zuckungen in dem Finger handeln, der bei Irina Liebmanns Schreibgerät für die Bedienung des Zeilenwechsels zuständig ist. Die alte Meinung, daß Lyrik etwas mit Verdichtung zu tun habe, kann damit jedenfalls als widerlegt gelten. Es sei denn, es handelt sich nicht um Lyrik. Wie auch immer! Fast auf der Zielgeraden ihrer Reise, die am und im Rhein endet, besucht Irina Liebmann in München einen Dichter fremder Zunge, dessen Werk wiederum von der ihr in München quartiergebenden Freundin eingedeutscht wird. Auch eine solche Visite hat einmal ein Ende. "Der Schriftsteller begleitete mich zu einer Haltestelle, deren Namen ich vergessen habe." Das macht nichts. BURKHARD SCHERER
Irina Liebmann: "Letzten Sommer in Deutschland". Eine romantische Reise. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 1997. 285 S., geb., 42,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main