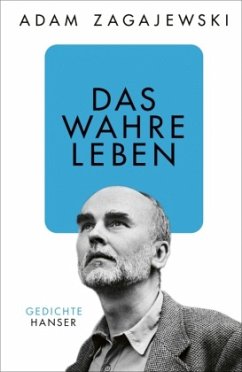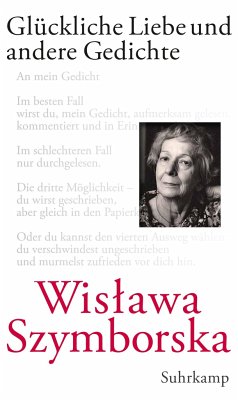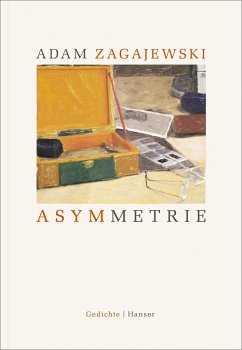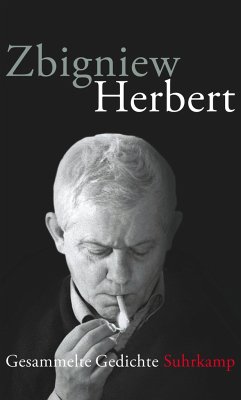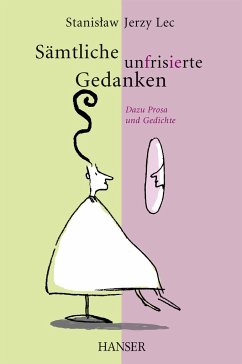Nicht lieferbar
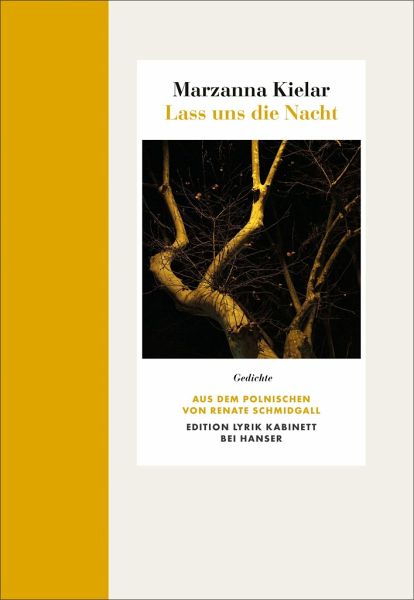
Lass uns die Nacht
Gedichte. Edition Lyrik Kabinett
Übersetzung: Schmidgall, Renate
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Die Gedichte der polnischen Lyrikerin Marzanna Kielar sind große Poesie des AugenblicksVon Milosz bis Szymborska, von Herbert bis Zagajewski - Polnisch ist die Weltsprache der Poesie. Die subtil schillernden Gedichte von Marzanna Kielar stehen in dieser Tradition, ob sie der trügerischen Idylle der Natur oder der Unwiederbringlichkeit der Liebe nachgehen. Der ewige Sommergarten ist der Ort, in dem sich das ganze Leben denken und spüren lässt: "Das, was auch dir gegeben sein wird, ein für alle Mal; /die fast schwarzen, süßen / Kirschen bluten in meiner Hand." Kielars Gedichte versuchen d...
Die Gedichte der polnischen Lyrikerin Marzanna Kielar sind große Poesie des AugenblicksVon Milosz bis Szymborska, von Herbert bis Zagajewski - Polnisch ist die Weltsprache der Poesie. Die subtil schillernden Gedichte von Marzanna Kielar stehen in dieser Tradition, ob sie der trügerischen Idylle der Natur oder der Unwiederbringlichkeit der Liebe nachgehen. Der ewige Sommergarten ist der Ort, in dem sich das ganze Leben denken und spüren lässt: "Das, was auch dir gegeben sein wird, ein für alle Mal; /die fast schwarzen, süßen / Kirschen bluten in meiner Hand." Kielars Gedichte versuchen den Augenblick zu erhaschen, da die Gegenwart endlich aufgehoben ist: "Ich streife eine Ameise von meinem Fuß / und schaue, was sie macht mit dem geschenkten Leben, mit ihrem Tropfen Zeit."