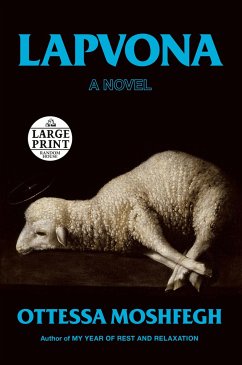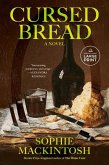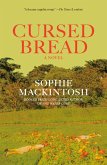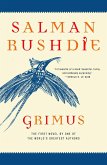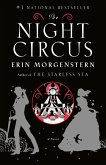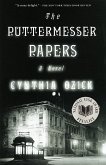Perfektion
Ob sie wohl jemals ein
schlechtes Buch schreiben wird?
Ottessa Moshfeghs neuer Roman „Lapvona“
VON SAMIR SELLAMI
Ottessa Moshfegh ist so etwas wie die Klassenbeste der US-amerikanischen Gegenwartsliteratur. Seit ihrer Erstlingsnovelle „McGlue“ aus dem Jahr 2014, einer Irrfahrt durch das zerklüftete Innenleben eines trunksüchtigen Seemanns, versetzen die Bücher der heute 41-jährigen Autorin aus Kalifornien Publikum und Kritik zuverlässig in Erstaunen.
Ein Jahr darauf folgte ihr erster Roman „Eileen“, der das Thema der Alkoholsucht aufnimmt, unter der auch Moshfegh in ihren Zwanzigern litt. Der endgültige Durchbruch kam dann spätestens 2018 mit dem Roman „Mein Jahr der Ruhe und Entspannung“, in dem sich eine junge Frau, die den Leerlauf der New Yorker Kunstwelt nicht mehr erträgt, dem Experiment verschreibt, zwölf Monate durchzuschlafen.
Ottessa Moshfegh schreibt einen Roman nach dem anderen und jeder von ihnen bewegt sich handwerklich sehr nahe an der Perfektion. Es sind neben den scharfkantigen Sätzen die Flüchtigkeiten und mit schnellen Pinselstrichen animierten Figuren, die ihren unverwechselbare Stil ausmachen, und es sind die komplexen, unvorhersehbaren Plots, die sie, wie sie selbst sagt, erst seit Kurzem ein wenig vorausplane. Dazu kommt, dass sie sich nie wiederholt, kein Roman gleicht dem anderen. Je mehr Ottessa Moshfegh man liest, umso schwieriger wird es, sich vorzustellen, dass sie jemals ein schlechtes Buch schreiben könnte.
Ihr neuer Roman spielt jetzt in einem fiktiven Fürstentum, das genauso heißt wie der Roman: „Lapvona“. Es liegt in einem mit viel Fleisch und sehr viel Blut heraufbeschworenen Pseudo-Mittelalter. Bei Moshfegh geht es immer sehr ausführlich um das Körperliche und sie schildert es, wie man es in ihrer Heimat Kalifornien, dem Hauptproduzenten glatter Oberflächen, sonst nicht zu sehen bekommt, weder in Hollywood noch auf Instagram. Seitenlang und mit einer beneidenswerten Geduld schildert sie Figuren, die ihren eigenen Körper mit einer robusten Lust am Ekel betrachten, sie zelebriert das Abstoßende, Kreatürliche, Würdelose, das mit dem Dasein als Mensch immer auch einhergeht, als wäre sie eine späte Verwandte von Georges Bataille. So wie bei Moshfegh wird vor allem über den weiblichen Körper in Kalifornien sonst nicht geredet.
Für diese Poetik scheint sie nun mit dem Mittelalter eine perfekte Bühne gefunden zu haben. Pünktlich zu Ostern ziehen die Räuber durch Lapvona, töten ein paar Männer, Frauen und Kinder, stecken minderwertige Habseligkeiten ein und hinterlassen Trauer, Rachsucht und Ratlosigkeit. Ihr Beutezug ist ein aber nur recht harmloser Vorbote dessen, was der Roman noch an fünf Jahreszeiten Grausamkeit aus dem Köcher zieht: die seltsam glaubwürdige Karikatur eines Provinzfürsten, der vor lauter Liegen das Laufen verlernt hat. Uneheliche, verkrüppelte Söhne und verstoßene Ehefrauen. Hunger, Vergewaltigung, Leibeigenschaft. Seuchen, Dürre, Flut. Menschen, die Menschen essen. Sprachlosigkeit, überall (nur nicht bei der Erzählerin).
Vorerst verschont von den Räubern bleiben die Lämmer Lapvonas, der Lammhirte Jude und sein krumm gewachsener Sohn Marek. Sie hausen weit außerhalb des Dorfkerns, am Fuß des Hügels, während der Fürst oben im Schloss seine kleine Gefolgschaft drangsaliert und den einzigen Sohn Jacob nach seinem Bilde heranwachsen lässt. Marek und Jacob verbindet „eine Art Freundschaft, voller Sticheleien und Beleidigungen“, sie streunen gemeinsam durch die Wälder, doch bald ermordet der Hirtensohn den jungen Fürsten. Jetzt stünde eigentlich die Todesstrafe an, stattdessen adoptiert der Fürst aus einer Laune heraus den Mörder seines Sohnes. Die Entscheidung wird nicht weiter erklärt, mit so etwas muss man bei Moshfegh einfach leben.
Dann kommt der Sommer, der die Gesichter „zu Totenköpfen verwelken“ lässt. Das Land trocknet aus, die Lämmer verdursten, und diejenigen Lapvoner, die es ihnen nicht ohnehin gleichtun, raunen sich zu: Ist das schon die Strafe Gottes für Mareks Mord? Und das Gerücht, das Schloss bleibe wie durch ein Wunder verschont, ein untrügliches Zeichen seiner Güte? Die Erzählerin weiß mehr: „Es war nicht Gottes Gnade, die das Schloss vor der Dürre bewahrte, sondern eine altbewährte, von den Herrschern für regenlose Jahreszeiten ersonnene Technik. Das Schmelzwasser des Schnees aus dem Hochgebirge speiste die Bäche und Flüsse, die Brunnen und Zisternen und wurde von einem Damm in einen Stausee umgeleitet, der am hinteren Ende der Schlossländereien versteckt in einem Kiefernwäldchen lag. Im Festungsgraben floss immer Wasser. Auf der Rasenfläche vor dem Schloss blühten die Blumen.“
Zu denen, die bis in den „Herbst“ überleben, gehört Ina, die „Säugamme“ Lapvonas, die eine ganze Dorfgeneration mit ihrer Milch genährt hat, die Säuglinge mit Kräutern und Salben versorgt und mit Vögeln redet. Jetzt in der Dürre und Hungersnot ist sie die Kraft, die den Lammhirten Jude dazu anstiftet, mit ihr das „Fieber des Kannibalismus“ zu erleben.
In der Figur Ina konzentriert Moshfegh den ganzen bittersüßen Gegensatz von Leben und Tod, Gnade und Grausamkeit, der das wehrlose Dorf in seinen Krallen hält. Trotzdem verkommt der Roman nie zum dumpfen Gewaltritual. Erst inmitten der überbordenden Grausamkeit entfalten die Momente der Gnade ihre berauschende, ätherische Wirkung.
In der Erzählung „Der Beach Boy“, die 2016 im New Yorker erschienen ist, schilderte Moshfegh den plötzlichen Tod einer Frau im mittleren Alter so: „Sie versuchte, nach John zu rufen. ,Schatz? John?’ Er kam nur ein Ächzen heraus. Es gurgelte in ihrer Kehle, ihre Hände zitterten, dann starb sie. So einfach war das. Sie war tot.“ Erst im übernächsten Abschnitt, nachdem er eine Nacht neben ihr auf der Fernsehcouch geschlafen hatte, entdeckt der Ehemann ihren Tod. In dieser unscheinbaren Szene liegt ein Schlüssel zu Moshfeghs literarischer Metaphysik, in der das Geschehen der Dinge ihrem Bemerken immer um mindestens zwei Schritte voraus ist. Der Geist ist träge, während die Körper, immer am Abgrund stehend, den Takt der Dinge vorgeben.
In „Lapvona“ führen das Überschießen und Überfließen der Körpersäfte in letzter Konsequenz dazu, dass sich dieses völlig verrückte Buch letztlich nicht auf eine Allegorie der Gegenwart herunterbrechen lässt, so verlockend es auch ist, in den feudalen Strukturen von Lapvona eine Parabel auf den globalen Kapitalismus der Gegenwart zu sehen: nicht auf den Klimawandel, nicht auf die Pandemie, nicht einmal auf den Verlust der Bindungskräfte in vom Untergehen bedrohten Gemeinschaften.
Moshfegh ist zwar die Klassenbeste, aber auch das Gegenteil einer diskursgetriebenen Streberin. Wenn am Ende nach all der Finsternis wieder ein Frühling kommt, ist eine gesamte Welt einmal fast vollständig unter- und einmal fast ganz wieder aufgegangen. Lapvona aber beschließt schweigend, so zu tun, als hätte es das alles niemals gegeben.
Sie zelebriert das Abstoßende,
Kreatürliche, Würdelose
am menschlichen Dasein
Erst in der Grausamkeit entfalten
die Momente der Gnade
ihre berauschende Wirkung
Geradezu kultisch verehrt: die kalifornische Autorin Ottessa Moshfegh.
Foto: Jake Belcher
Ottessa Moshfegh:
Lapvona.
Roman. Aus dem
Englischen von Anke
Caroline Burger.
Hanser Berlin, Berlin 2023.
336 Seiten, 26 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de