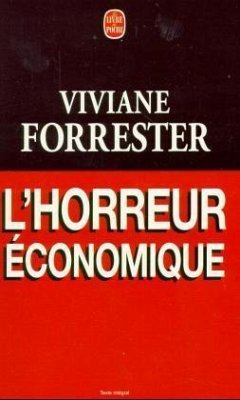Binnen kürzester Zeit wurden von dieser Streitschrift in Frankreich mehr als 300 000 Exemplare verkauft. Die Autorin protestiert darin gegen ein System, "das bis auf die Knochen aus den Menschen heraussaugt, was ihnen noch an Menschlichkeit geblieben ist". Empört vor allen Dingen wendet sie sich gegen den Skandal der Massenarbeitslosigkeit und die Lethargie und Ohnmacht der Politiker wie Betroffenen.

Viviane Forrester sieht den Rest der Welt im Vormarsch auf Paris
Man kommt nicht umhin zu erwähnen, daß von Viviane Forresters Buch in Frankreich binnen eines Jahres mehr als 300000 Exemplare abgesetzt werden konnten. Die Polemik der streitwütigen alten Dame traf den Nerv einer Nation, die sich durch die Anpassung an die Euro-Kriterien gerade einem sozialen Umbruch ausgesetzt sah. Noch vor Forrester war es dem Filmregisseur Matthieu Kassowitz gelungen, mit seinem Film "Haß" die Aufmerksamkeit der Franzosen auf die brisante Lage in den vernachlässigten Vorstädten der Metropolen zu lenken. Auch für Forrester sind die sozialen Brenn- die Bezugspunkte ihrer Analyse. Nur daß sie endlich den Grund für den Haß der Unterprivilegierten ausgemacht hat: Es ist "Der Terror der Ökonomie", der die industrielle Revolution beschließt. Eine Französin kennt nun einmal den Verlauf der Geschichte.
Gleichfalls muß man feststellen, daß Forresters Erfolgsbuch Licht und Schatten vereint. In ihren kurzen Anmerkungen zum Verlust des traditionellen Verständnisses von Arbeit leuchtet die intellektuelle Kraft am hellsten. Was seit den Utopien der frühen Neuzeit, seit Morus und Campanella also, zum Traum der Menschheit stilisiert worden ist: die Überwindung des Gottesfluchs, im Schweiße seines Angesichts sein Brot verdienen zu müssen, das ist mittlerweile möglich geworden. Die Mechanisierung hat die Mühsal beseitigt, nun frißt sie die Arbeitsplätze selbst. Wir wissen heute mit dem Geschenk der Muße nicht mehr umzugehen, weil sie uns allein Armut verheißt.
Doch Forrester gibt sich gar nicht erst mit den Banalitäten der Ökonomie ab - von denen sie wenig genug versteht -, sondern verlagert ihre Erörterungen ins Spirituelle. Hier werden die Schatten des Buches länger und länger. Das entscheidende Defizit erkennt sie in der metaphysischen Anerkennung der Arbeitslosen als Menschen, nicht im Mangel an materieller Unterstützung. Ihr Buch schließt mit der emphatischen Frage: "Wäre es nicht sinnvoller statt Mitleid . . . ein kühnes, kompromißlos strenges Gefühl ihnen gegenüber zu erhoffen, nämlich Respekt?" Die Dämmerung ist erreicht, um den Leser wird es Nacht. Alles ist nur noch Schatten.
Natürlich wäre es sinnvoller, lautet die Antwort auf ihre Frage, aber kann Respekt allein genügen? Auf den zweihundert vorhergegangenen Seiten hat Forrester nicht weniger als eine Apokalypse beschworen: den Untergang des Intellekts, die Verrohung des Menschen, die Anarchie des Marktes. Sie verfügt nur über ein einziges rhetorisches Stilmittel - die Übertreibung. Ihr Feind steht - wie für viele französische Intellektuelle - jenseits des Ozeans. Nach der Anpassung an das amerikanische Modell drohe den jetzigen Wohlfahrtsstaaten Europas der Sturz auf das Niveau der Entwicklungsländer.
Alle Euroskeptiker werden diese Philippika frohgemut unterschreiben, und Forrester bemerkt gar nicht, wie sie im Bemühen um eine Solidarität über die Klassen hinweg die Solidarität über Grenzen hinweg zerstört. Das Schreckgespenst der Neuen Armut soll dadurch gebannt werden, daß man die Billiglohnländer zum bösen Geist der Weltwirtschaft erklärt. Dort finden sich wohlfeile Buhmänner, denen der französische Arbeitslose sein Los verdankt. Das Elend der Dritten Welt sieht Forrester bereits im Vorfeld von Paris. Sie vergleicht die Jugendlichen der banlieue mit Madame Bovary, die sich in romantischen Erwartungen ergeht, die niemals eintreffen. Der Selbstmord der Gesellschaft dräut, doch die Forderung nach Respekt bleibt das Äußerste an Konsequenz, zu dem Forrester sich durchringen kann.
So wird die Lust an der Polemik mehr und mehr zum einzigen Gewinn bei der Lektüre. Wenn man dauernd gewinnt, macht's viel mehr Spaß - diese Maxime kritisiert Forrester im Bereich der Ökonomie und folgt ihr willig beim eigenen Schreiben. Kein Einwand soll das grelle Zerrbild trüben, kein Lichtblick den diagnostizierten Kerker der Arbeitslosigkeit erhellen. Forrester ist als Autorin permanent in der Offensive. Sie mag ihr Buch als Präventivschlag verstehen, es ist aber nur - man kommt um dieses Wortspiel ebenfalls nicht herum - ein Tiefschlag. ANDREAS PLATTHAUS
Viviane Forrester: "Der Terror der Ökonomie". Aus dem Französischen von Tobias Scheffel. Paul Zsolnay Verlag, Wien 1997. 215 S., geb., 34,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main