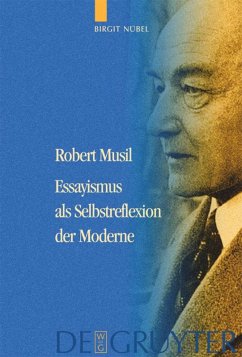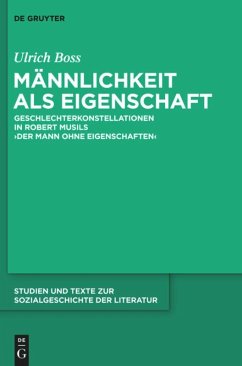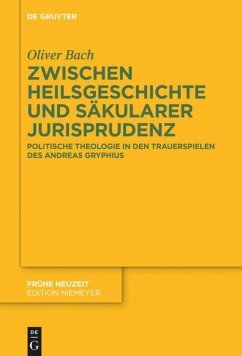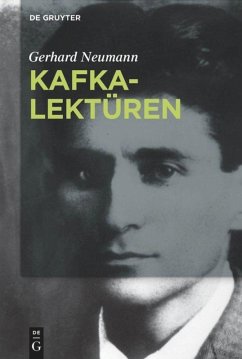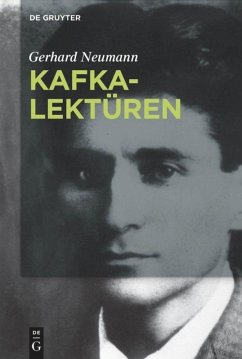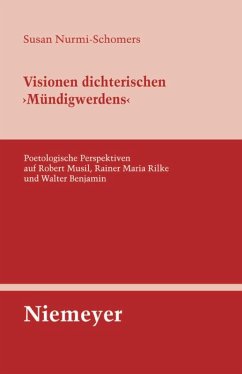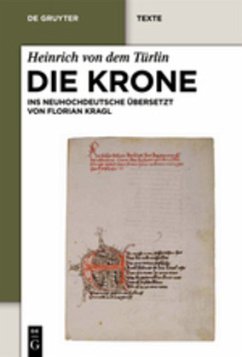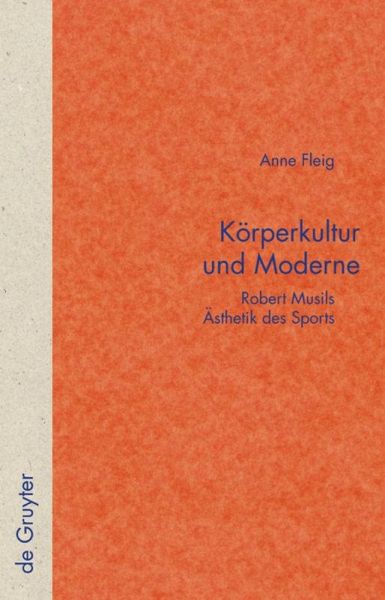
Körperkultur und Moderne
Robert Musils Ästhetik des Sports

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die produktive Verbindung von ästhetischer und technischer Modernität machte den Sport am Beginn des 20. Jahrhunderts zu einem Paradigma der kulturellen Moderne, dessen Bedeutung Robert Musil als einer der ersten reflektierte. Vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Diskurse über die Techniken des bewegten Körpers in Arbeit, Wettkampf und Kultur, die den Sport als Lebensform des modernen Menschen propagierten, untersucht die Verfasserin 'Sport' als Gegenstand der Kulturkritik und als poetologisches Konzept in Musils Werk. An der Schnittstelle von Naturwissenschaft, Technik und moderner �...
Die produktive Verbindung von ästhetischer und technischer Modernität machte den Sport am Beginn des 20. Jahrhunderts zu einem Paradigma der kulturellen Moderne, dessen Bedeutung Robert Musil als einer der ersten reflektierte. Vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Diskurse über die Techniken des bewegten Körpers in Arbeit, Wettkampf und Kultur, die den Sport als Lebensform des modernen Menschen propagierten, untersucht die Verfasserin 'Sport' als Gegenstand der Kulturkritik und als poetologisches Konzept in Musils Werk. An der Schnittstelle von Naturwissenschaft, Technik und moderner Ästhetik leistet die Studie einen wesentlichen Beitrag zur Kulturgeschichte des Sports, zu Theorie und Ästhetik der Moderne sowie zur Musil-Forschung.