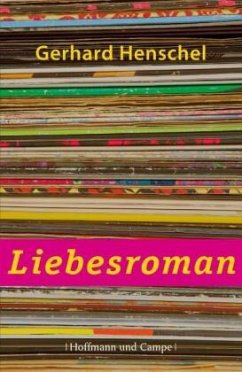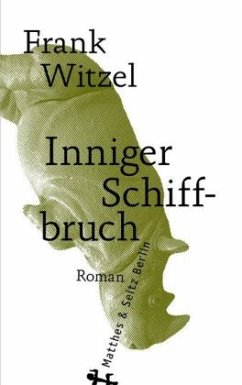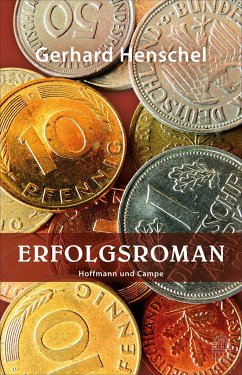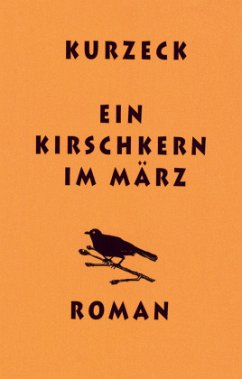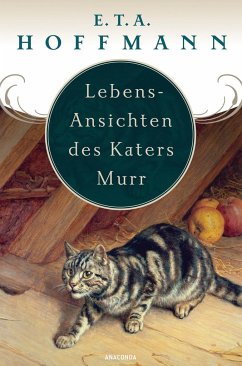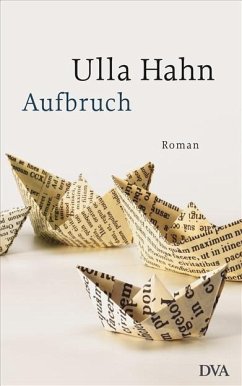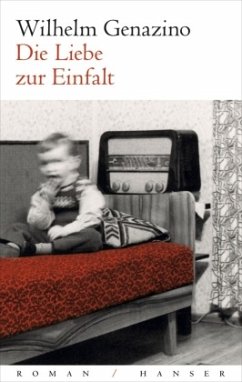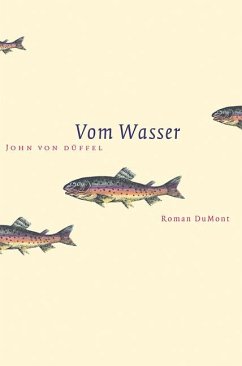weiteres Mal mit der Familie Schlosser und widmet sich Martin, dem dritten der vier Kinder. Der Roman endet 1974, als Martin zwölf Jahre alt ist, und auch wenn der ebenfalls 1962 geborene Gerhard Henschel bisher nicht bestätigt hat, daß sich hinter dem Ehepaar Schlosser seine eigenen Eltern verbergen, darf man in dem Erzähler wohl den Autor selbst vermuten.
Zunächst sind es nur einige verstreute Erinnerungen. Ein Blick aus dem Fenster in den fallenden Schnee, ein Kinderreim und eine Szene am Küchentisch. "Ein Löffel für Martin. Das war ich selbst. Martin Schlosser." Weiter kommt er erst einmal nicht: "Nicht träumen!" ermahnt ihn die Mutter bereits auf den ersten Zeilen des fast fünfhundert Seiten umfassenden Romans, und bald fällt auf, daß die Eltern, deren stilvolle Briefe man in "Die Liebenden" lesen konnte, hier fast ausschließlich formelhafte Ermahnungen und Binsenweisheiten von sich geben. Gerhard Henschel, der 1997 noch mit Eckhard Henscheid und Brigitte Kronauer in der "Kulturgeschichte der Mißverständnisse" mit beißendem Spott über die Gemeinplätze der Gegenwart hergefallen ist, widmet sich jetzt geradezu zärtlich den elterlichen Redensarten: "Bist du im Zirkus groß geworden?" kommentiert die Mutter eine von Martins "Schnapsideen" und schickt ihn "ab ins Bett, aber dalli".
Zunächst wirken diese Platitüden fast zeitlos. Doch wenn Martins Mutter an einem frostigen Wintertag "raus aus der sibirischen Kälte" will oder der Vater seinen Kinder den Linseneintopf mit der Bemerkung schmackhaft zu machen versucht, daß "sie im nächsten Krieg noch Baumrinde nagen würden", erzählen sie plötzlich vom Schicksal einer ganzen Generation. Martins Eltern haben den Zweiten Weltkrieg miterlebt, und wie viele andere Paare suchen sie jetzt ihren Frieden in einer warenförmigen Familienwelt, in der sich glückliche Gesichter im blitzenden Kotflügel eines Volkswagens oder im metallischen Grün des neuen Fonduesets spiegeln. Akribisch führt Martin Buch über die vermeintlich schönen und nützlichen Dingen, die seine Eltern anschaffen: einen neuer Staubsauger, einen Römertopf oder das gläserne Milchkännchen mit Schraubverschluß, das die kleckernden "B&B"-Dosen vom Tisch verbannen soll. Das Scheitern der familiären Nachkriegsutopie, das Henschel in "Die Liebenden" beschrieben hat, tritt nun durch den unschuldigen Blick des kindlichen Erzählers noch schärfer hervor.
Doch eigentlich geht es im "Kindheitsroman" um die nächste Generation. Das Leben von Martin und seinen drei Geschwister wird nicht mehr von der großen Erzählung des Zweiten Weltkriegs geprägt, sondern von kleinen und banalen Geschichten. Eine Prügelei auf dem Spielplatz und eine "Sechs" in Biologie, ein Ladendiebstahl, eine unverdiente Ohrfeige und Fernsehverbot, davon berichten die kurzen, in sich geschlossenen Absätze. Während Martin die Grundschule in Vallendar am Rhein und die ersten Klassen des Gymnasiums in Koblenz besucht, regieren in Bonn erst Ludwig Erhard und Kurt Georg Kiesinger und dann Willy Brandt. Die Auschwitz-Prozesse werden geführt und die Ostverträge ratifiziert, Benno Ohnesorg stirbt, und Kaufhäuser brennen, aber für Martin zählen andere historische Einschnitte: die unverhoffte Erhöhung des Taschengeldes um zwanzig statt um zehn Pfennig oder ein vereinzeltes Tor von Jupp Heynckes in der 13. Minute in einem Spiel gegen den 1. FC Köln.
Gerhard Henschel ist ein detailversessener Autor. Er weiß, daß ein "Duplo" Mitte der sechziger Jahre zwanzig und ein "Mars" fünfunddreißig Pfennig gekostet hat, er rezitiert das alte Greuelmärchen von den Kindern, die an einem verschluckten Kaugummi erstickt sind, und ruft sich Schlagertexte, Werbesprüche und Plakatparolen in Erinnerung: "Schluckimpfung ist süß", und "Neckermann macht's möglich". Nichts, aber auch rein gar nichts scheint ihm zu entgehen. Sogar eine Tonbandaufnahme, die an Heiligabend 1972 während der Bescherung im Wohnzimmer der "Schlossers" entstanden ist, hat Gerhard Henschel in seinem Archiv aufgespürt und abgeschrieben, und in einem zerlesenen Comic hat er das Motto für seinen Roman gefunden. Zwei Bilder aus einem alten Lustigen Taschenbuch zeigen, wie Mickymaus - "bip! bip!" - mit Hilfe von geheimnisvollen "Gedächtnisstrahlen" auf eine Reise in die eigene Kindheit geschickt wird.
Es ist ein ironischer Kommentar. Gerhard Henschel weiß, daß die Literatur nur ein unvollkommener Ersatz für diese Gedächtnisstrahlen ist. Anstatt die Vergangenheit zurückzuholen, erzählt sie doch nur von den Dingen, die auf ewig dahin sind. Vielleicht verliert Martin darum in diesem Roman ständig etwas. Bei einer Fahrt in einem Sessellift fällt ihm eine seiner neuen "Romika"-Sandalen vom Fuß, und seine geliebte Winnetou-Figur verschwindet für immer im Abflußrohr, er verbummelt die Uhr, die er Weihnachten bekommen hat, und der Schal, den seine Mutter ihm am Morgen um den Hals bindet, ist am Abend bereits verschwunden. Leider findet er das Buch mit den "schweinischen Zeichnungen", das er mit einem Freund sorgsam im Wald versteckt hat, zuletzt selbst nicht wieder, und dann verliert er auch noch den Freund an andere Spielkameraden.
Der einzige Verlust jedoch, über den man nie hinwegkommt, ist der Verlust der Kindheit. Genau davon erzählt dieser schrecklich schöne Roman. Ganz zum Schluß, als am Silvesterabend 1974 gerade das neue Fondueset eingeweiht wird, bemerkt Martin, daß es nur noch ein Vierteljahrhundert bis zum Jahr 2000 sind. "Ich wäre dann 37 Jahre alt", teilt er den anderen begeistert mit. "Hör bloß auf", sagt seine Mutter.
KOLJA MENSING
Gerhard Henschel: "Kindheitsroman". Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg 2004. 493 S., geb., 22,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
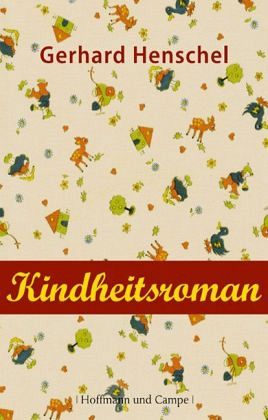





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.07.2004
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.07.2004