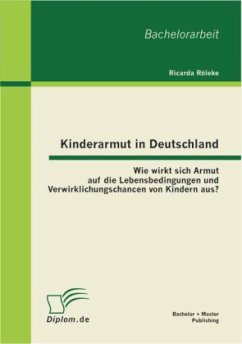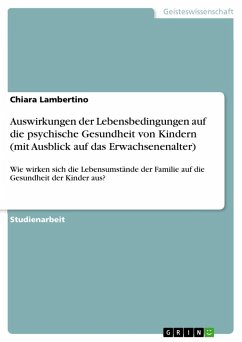Kinderarmut galt in Deutschland lange Zeit als unbedeutendes Randphänomen. Im Zuge des Wandels von Arbeitsmarkt- und Familienstrukturen lässt sich jedoch seit Beginn der 90er Jahre ein Auseinanderdriften der Gesellschaft beobachten, in dessen Verlauf breite Teile der heranwachsenden Bevölkerung als Modernisierungsverlierer zurückbleiben. Auch immer mehr Kinder aus der traditionellen Mittelschicht wachsen in Armutslagen auf.
Diese Entwicklung hat den öffentlichen und wissenschaftlichen Diskurs um Chancengerechtigkeit erneut entfacht. Innerhalb der letzten Jahre erschienene Studien liefern eine detaillierte Analyse der Auswirkungen von Armutslagen auf Lebensbedingungen und Verwirklichungschancen von Kindern. Wenig beachtet blieb jedoch bisher, in welchem Maße sich Armutsstrukturen über Generationen hinweg verfestigen.
Die vorliegende Arbeit widmet sich der Frage, inwieweit Kinderarmut in Deutschland als spezifische Reproduktionsform sozialer Lagen verstanden werden kann. Unter Rückgriff auf Pierre Bourdieus Theorien von Habitus und Kapital werden individuelle und institutionelle Mechanismen aufgezeigt, die eine sogenannte Vererbung von Lebenschancen begünstigen.
In der Kindheit erfahrene Mangelzustände beeinflussen nicht nur die aktuelle Lebenslage von Kindern, sondern auch ihre Entwicklungs- und Lebenschancen. Als zentrale Einflussfaktoren auf die langfristige Verfestigung erlebter Benachteiligungen werden die familiäre Ausstattung mit Kapitalressourcen, die habituelle Disposition der Eltern sowie die Verfügbarkeit externer Unterstützung identifiziert.
Kinder, die in armen Familien aufwachsen, haben, so das Fazit, ein erhöhtes Risiko, später selbst in Armut zu leben. Eine Beschränkung der Ursachensuche von Armutskarrieren auf die individuelle Ebene greift jedoch zu kurz. Vielmehr führt erst die Interaktion mit gesellschaftlichen Institutionen, wie dem Bildungs- oder Sozialsystem, zur Entstehung von Bedingungen, welche eine Verfestigung multipler Deprivationen hervorrufen können. An dieser Stelle finden sich entscheidende Ansatzpunkte für eine armutsvermeidende Sozial- und Familienpolitik.
Diese Entwicklung hat den öffentlichen und wissenschaftlichen Diskurs um Chancengerechtigkeit erneut entfacht. Innerhalb der letzten Jahre erschienene Studien liefern eine detaillierte Analyse der Auswirkungen von Armutslagen auf Lebensbedingungen und Verwirklichungschancen von Kindern. Wenig beachtet blieb jedoch bisher, in welchem Maße sich Armutsstrukturen über Generationen hinweg verfestigen.
Die vorliegende Arbeit widmet sich der Frage, inwieweit Kinderarmut in Deutschland als spezifische Reproduktionsform sozialer Lagen verstanden werden kann. Unter Rückgriff auf Pierre Bourdieus Theorien von Habitus und Kapital werden individuelle und institutionelle Mechanismen aufgezeigt, die eine sogenannte Vererbung von Lebenschancen begünstigen.
In der Kindheit erfahrene Mangelzustände beeinflussen nicht nur die aktuelle Lebenslage von Kindern, sondern auch ihre Entwicklungs- und Lebenschancen. Als zentrale Einflussfaktoren auf die langfristige Verfestigung erlebter Benachteiligungen werden die familiäre Ausstattung mit Kapitalressourcen, die habituelle Disposition der Eltern sowie die Verfügbarkeit externer Unterstützung identifiziert.
Kinder, die in armen Familien aufwachsen, haben, so das Fazit, ein erhöhtes Risiko, später selbst in Armut zu leben. Eine Beschränkung der Ursachensuche von Armutskarrieren auf die individuelle Ebene greift jedoch zu kurz. Vielmehr führt erst die Interaktion mit gesellschaftlichen Institutionen, wie dem Bildungs- oder Sozialsystem, zur Entstehung von Bedingungen, welche eine Verfestigung multipler Deprivationen hervorrufen können. An dieser Stelle finden sich entscheidende Ansatzpunkte für eine armutsvermeidende Sozial- und Familienpolitik.