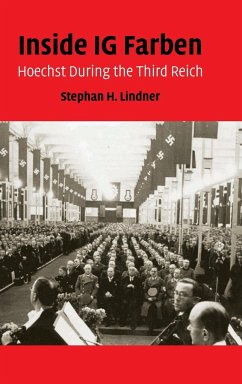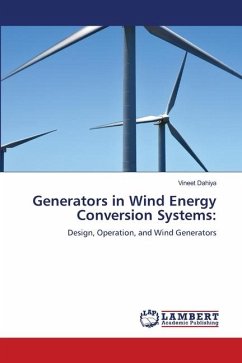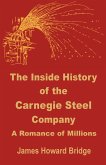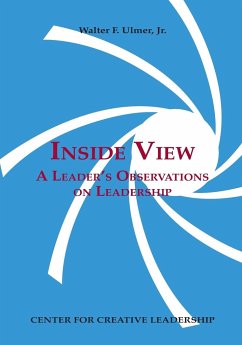Die Kooperation des IG-Farben-Werks Hoechst mit den Nazis
Wie kein anderer Konzern wird die IG Farben – die 1926 gegründete Interessengemeinschaft der großen deutschen Chemieunternehmen – mit dem nationalsozialistischen Programm der Aufrüstung, Autarkie, Aggression und Ausrottung in Verbindung gebracht. Einmal im Jahr treffen sich die Aktionäre der „IG Farben in Abwicklung“ zur Hauptversammlung – und auf wütende Demonstranten, die die Auflösung des Fossils und eine Auszahlung des Restvermögens an die Opfer fordern.
Schon seit 1955 befindet sich der ehemalige Konzern „in Abwicklung“. Das Weiterbestehen erlaubte es den Nachfolgeunternehmen wie BASF, Bayer oder Hoechst, sich der Verantwortung für die NS-Verbrechen zu entziehen und etwaige Rechtsansprüche oder Klagen auf die IG Farben i.A. zu verweisen. Den Beitrag zum Fonds für die Entschädigung der Zwangsarbeiter 1999 leisteten die Nachfolgeunternehmen somit „freiwillig“.
Diese Debatte um Entschädigung für Zwangsarbeiter infolge von Sammelklagen in den USA sorgte für den Druck und die Bereitschaft einer Reihe deutscher Unternehmen, die eigene Firmengeschichte durch unabhängige Historiker aufarbeiten zu lassen. Für die Allianz oder die Deutsche Bank liegen solche Studien vor. Nun hat auch die ehemalige Hoechst AG ein Buch über das IG-Farben-Werk im Dritten Reich durch den Wirtschaftshistoriker Stephan H. Lindner finanziert.
Entstanden ist eine beeindruckende Studie: Quellennah und detailliert schildert Lindner die skrupellose Komplizenschaft von Hoechst in nationalsozialistische Verbrechen, und er belegt auch, wie tief die NS-Ideologie das Management des Werks durchdrungen hatte. Darüber hinaus zeigt er das weitgehend erfolgreiche Bemühen der leitenden Direktoren nach dem Krieg auf, den „Opfern“ der Entnazifizierung, nicht etwa den Opfern des NS-Regimes, zu helfen. Lindners Urteil in der Frage, ob die Werksleitung während des Dritten Reiches opportunistisch oder ideologisch eifernd war, ist deutlich: Sie war beides.
Ein Schwerpunkt des Buches liegt in der Nazifizierung des Werkes in den 30er Jahren. Dieser Prozess wird vor allem an Personen festgemacht, etwa anhand der Werksleiter Ludwig Hermann, Carl Ludwig Lautenschläger und Karl Winnacker, aber auch anhand der Ausgrenzung und Verfolgung, die vor allem jüdische und als Juden geltende Mitarbeiter erleben mussten. Lindner versteht es, die Fassungslosigkeit der auch später niemals Rehabilitierten angesichts der beschämenden Werkspolitik einzufangen. „Niemand hat einen Grund, sich meinetwegen zu schämen“, schrieb etwa der entlassene Chemiker Max Sorkin. Doch für den Leiter der organischen Abteilung, Kränzlein, hatte Sorkin „weder für mich als Mitarbeiter noch für das Werk als Angestellter“ je existiert.
Verstärkte Aufmerksamkeit im Prozess der moralischen Korrumpierung und ideologisch getragenen Anpassung schenkt Lindners Studie den „Fremdarbeitern“. Diese waren bei Hoechst nie Teil der „Gefolgschaft, sondern immer Mitarbeiter zweiter oder noch niedrigerer Klasse“. Das Werk war keineswegs nur passiver Empfänger zugeteilter Arbeiter, sondern engagierte sich für eine stetige Versorgung mit diesen ausgebeuteten Menschen, darunter Kinder und KZ-Häftlinge, ohne sich um deren Schicksal nach dem Krieg zu interessieren.
Ein weiter Abgrund öffnet sich beim Kapitel Medikamente und Menschenversuche. In Auschwitz und Buchenwald wurde mit Wissen des Unternehmens ein Präparat zur Bekämpfung von Fleckfieber als Wirkstoff klinisch getestet – mit katastrophalen Ergebnissen. Für diese Verbrechen wurde von Hoechst niemand juristisch zur Verantwortung gezogen. Auch für andere Delikte waren die Urteile der Nürnberger Richter nach Dafürhalten Lindners zu milde.
Das Buch hat ein bemerkenswertes Vorwort. Es stammt von Peter Hayes, dem führenden Historiker der IG-Farben-Geschichte, der bislang für die These stand, die IG Farben habe sich gegenüber dem Aufstieg und der Herrschaft Hitlers weitgehend reaktiv verhalten. Der Konzern sei zwar in die Plünderung von Eigentum und die Ausbeutung von Menschen eingebunden gewesen, dies spiegele aber eher Mechanismen wirtschaftlicher Überlegungen in einem
pervertierten Umfeld wider als eine Identität der Ziele des Großkonzerns mit
denen der NSDAP. Nach Lektüre von Lindners Untersuchung des Innenlebens der Hoechst AG hat Hayes nun angekündigt, seine Interpretation zu überdenken. So widerlegt dieses akribisch recherchierte Buch die geläufige Meinung, der Nationalsozialismus sei doch längst erforscht.
JÖRG SPÄTER
STEPHAN H. LINDNER: Hoechst. Ein I.G. Farben Werk im Dritten Reich. C.H. Beck, München 2005. 460 Seiten, 39,90 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de