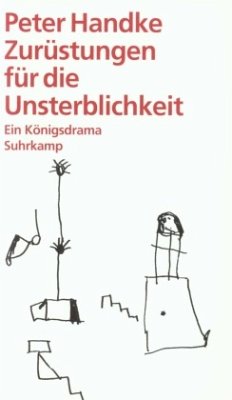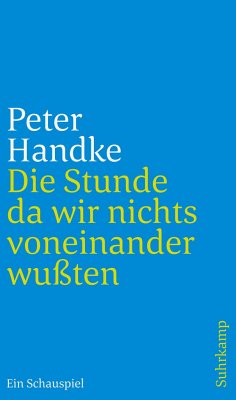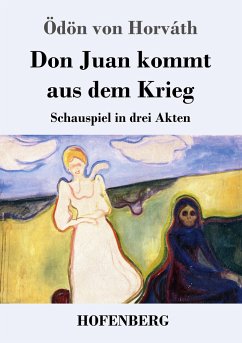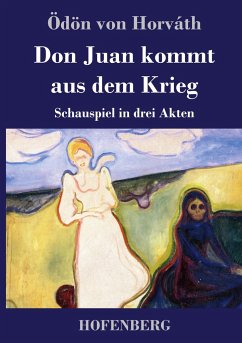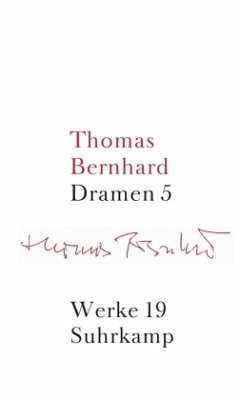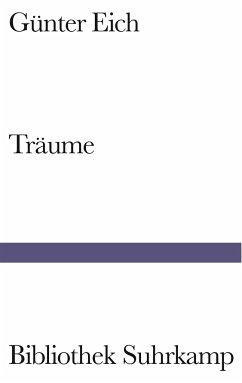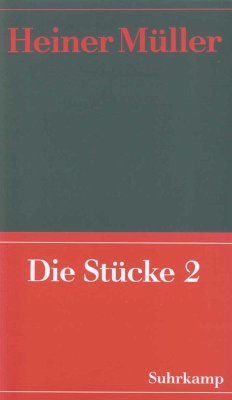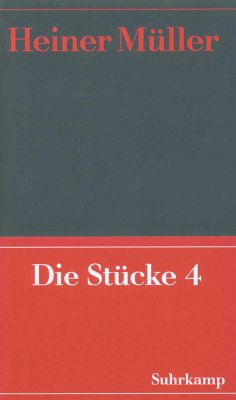bevorstehenden Untergang bereits deutlich gezeichnete Naturidyll, in dessen Untergrund das zerstörerische Feuer in trügerischer Ruhe auf seine Stunde wartet - das lässt an Ernst Jüngers "Kriegstagebücher" denken, die jetzt bei Klett-Cotta erschienen sind. Aber Jünger beginnt seine Aufzeichnungen aus dem Ersten Weltkrieg unter dem Datum vom 30. Dezember 1914 ganz anders, nämlich nüchtern, soldatisch, knapp: "Nachmittags, Empfang von Patronen und eiserner Ration. Untersuchung auf Geschlechtskrankheiten. Als wir antraten, nahmen einige Mütter Abschied, was doch trübe stimmte. 6.44 Abfahrt. Wir bekamen Stroh in die Wagen. Furchtbar gedrängte Pennerei in und unter den Bänken."
So also erlebte der Kriegsfreiwillige Ernst Jünger, zum fraglichen Zeitpunkt neunzehn Jahre alt, seinen ersten Tag als Soldat eines Krieges, zu dessen wichtigstem und umstrittenstem literarischem Zeitzeugen er werden sollte. Mit den Kriegstagebüchern liegt jetzt, mehr als neunzig Jahre nach ihrer Niederschrift, erstmals dieses persönliche Dokument des Diaristen Jünger vor: der Steinbruch, aus dem 1920 "In Stahlgewittern" hervorging.
Knapp vier Jahre nach seinem ersten Eintrag, zahllose Tote, etliche Verwundungen, Beförderungen und Auszeichnungen später, beschließt Jünger seine Aufzeichnungen am 10. September 1918 mit dem heute geradezu kurios anmutenden Bekenntnis, er sei "kein Mann der Feder". Dennoch hoffe er, "dass mancher, der dieses Buch aus der Hand legt, eine Ahnung bekommen hat, von dem, was von uns Infanteristen geleistet wurde".
Helmuth Kiesel, der Herausgeber der Tagebücher, legt in seinem Vorwort mit sicheren Federstrichen dar, zu welcher Leistung Jünger und seine Kameraden von der Infanterie ihr Scherflein beigetragen hatten: Europa lag in Schutt und Asche, beklagte zehn Millionen Tote und weitere achtzehn Millionen Versehrte. Die Weltkarte musste neu gezeichnet werden, und die unbewältigten Folgen des Krieges trugen zwanzig Jahre später ihren Teil zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges bei. Dieser Krieg hat die Welt verändert, aber hat er auch den Menschen Ernst Jünger verändert?
"Der Krieg hat mich zum Tenor gemacht! ... der Krieg mich zum Dichter hat gemacht! Unsere Jaunfeldgegend hat endlich den, der ihr seit der letzten Eiszeit gefehlt hat, auch wenn sein Fehlen allgemein unbemerkt ist geblieben - den Dichter, mich!" Es ist Peter Handke, der hier spricht oder vielmehr in ironischer Färbung sprechen lässt. Auf dem Jaunfeld, gelegen im Grenzgebiet zwischen Kärnten und Slowenien, ist Handkes neues Buch angesiedelt: "Immer noch Sturm" (Suhrkamp). Der Titel nimmt eine Regieanweisung von Shakespeares "König Lear" auf. Handke hat das Stück vom alten König, der Reich und Krone an seine drei Töchter verteilt und damit das eigene Elend heraufbeschworen, offenbar als Kriegsdrama gelesen: als Familienkriegsdrama. Bei Shakespeare irrt der wahnsinnig gewordene Lear nackt und allein durch die stürmische Heide, bei Handke ist der namenlose Erzähler, schlicht "Ich" genannt, der jüngste Spross der Sippe, deren Schicksal hier erzählt wird: Enkel Lear. Ein König ist er nur im Reich seiner die Vergangenheit imaginierenden Träume.
Bei Shakespeare wütet der Krieg in der Familie, bei Handke überrennt er die kleine Trutzburg der Sippe. Es ist der Zweite Weltkrieg, in den drei Onkel des Erzählers im Namen eines Deutschen Reiches ziehen müssen, mit dem sie nichts zu schaffen haben. Aber wenn Handke Krieg sagt, meint er alle Kriege, und wenn er Zeit sagt, meint er alle Zeiten. So weitet sich das deutlich autobiographisch geprägte Familientableau zuweilen aus zu einer universellen Gemeinschaft des Leids: "Im Fernsehen oder wo ein junges Kriegsopfer aus einem arabischen oder sonst einem Land: der jüngste unserer Sippe."
Auch Toni Heinemann ist in diesem Clan ein entfernter Verwandter. Der junge Bundeswehrveteran wurde in Afghanistan verwundet und ist mit achtundzwanzig Jahren ein Wrack. Ingo Niermann und Alexander Wallasch gehen in ihrem gemeinsam verfassten Roman "Deutscher Sohn" (Blumenbar) ebenso wie der Franzose Mathias Énard in "Zone" (Berlin Verlag) der Frage nach, was Kriegserlebnisse aus einem Menschen machen, ohne indes überzeugende Antworten darauf geben zu können. Beide Romane scheitern - Énard auf hohem, Niermann und Wallasch auf niedrigem Niveau. Der Krieg bringt eben manchmal auch literarische Kollateralschäden mit sich. Das ist unvermeidlich in einem Herbst, in dem sich dieses Thema durch erstaunlich viele Neuerscheinungen zieht, von Barbara Conrads Neuübersetzung von Tolstois "Krieg und Frieden" (Hanser) über Michael Kleebergs Roman "Das amerikanische Hospital" (DVA) und Thomas Lehrs "September. Fata Morgana" (Hanser) bis zu Mariam Kühsel-Hussainis erstaunlichem Debüt "Gott im Reiskorn" (Berlin University Press).
Kleeberg lässt einen amerikanischen Veteranen mit posttraumatischer Belastungsstörung in einem Pariser Krankenhaus einer jungen Französin begegnen, die sich ihren Kinderwunsch durch künstliche Befruchtung erfüllen will und dadurch in einen zermürbenden Feldzug gegen den eigenen Körper gerät. Thomas Lehr entfesselt einen packenden Bewusstseinsstrom, der vom Anschlag auf das World Trade Center in den Krieg im Irak und zurück ins Terrorregime Saddam Husseins führt. Und die junge Mariam Kühsel-Hussaini, 1987 in Kabul als Enkelin des Kalligraphen Sayed Da'ud Hussaini geboren, entwirft ein afghanisches Familienporträt, in dessen Zentrum die Begegnung von Orient und Okzident im Zeichen der Kunst, aber auch des Krieges steht. Was diese drei Bücher bei allen Unterschieden vereint und gemeinsam auszeichnet, sind der hohe Anspruch und der auch formale Wagemut ihrer Autoren. Den behaglich schnurrenden Erzählton wird man hier vergeblich suchen.
Das gilt auch für Dorothee Elmigers Roman "Einladung an die Waghalsigen" (Dumont). Die junge Schweizerin, Jahrgang 1985 und soeben mit dem "aspekte"Preis für das beste deutschsprachige Prosadebüt des Jahres ausgezeichnet, ist zusammen mit Mariam Kühsel-Hussaini die interessanteste Debütantin dieses Jahres. Das Eingangszitat vom unterirdischen Feuer, das in den Stollen und Schächten glimmt, hat sie in Goethes "Dichtung und Wahrheit" gefunden und ihrem Roman vorangestellt. Er entfaltet ein eigentümliches Endzeitszenario, betörend in seinem spröden Charme, verrätselt, gespickt mit literarischen Anspielungen und getragen von einer Sprache, die sich selbst Anleihen beim kantigen Stil von Nachschlagewerken und schweizerischen Amtsstuben anmutig anverwandelt.
Worin liegt der literarische Reiz von Krieg, Gewalt, Zerstörung und Untergang? Peter-André Alt, Literaturwissenschaftler, Schiller- und Kafka-Biograph, zitiert in seiner neuen Studie "Ästhetik des Bösen" (C. H. Beck) eine nachgelassene Notiz Nietzsches: "Was ist das Böse? Dreierlei: der Zufall, das Ungewisse, das Plötzliche." Der Kulturwissenschaftler Helmut Lethen hat Jüngers Kriegstagebücher als Dokument einer umfassenden seelischen "Panzerung" gelesen und sich fasziniert über einen Satz gebeugt, in dem Nietzsches Moment des Unvorhersehbaren anklingt: "Der Mensch ist unberechenbar. Im Umgang mit ihm muss man auf alles gefasst sein." Keine Gewissheit, nirgends? Doch. Rainer Wieland hat für sein "Buch der Tagebücher" (Piper) über tausend Fundstücke der verschiedensten Diaristen versammelt, von Adorno und Hans Christian Andersen bis zu Stefan Zweig und Marina Zwetajewa. Ernst Jünger wird darin mit der festen Überzeugung zitiert, dass "jeder Wechsel, ob von rechts oder links, von oben oder unten, von West oder Ost, näher zum Abgrund führt. Es gibt viele Meinungen, viele Parteien, doch nur eine schiefe Ebene." Man muss sie nur hinaufklettern. Dann kommt man gut durchs ganze Jahr.
HUBERT SPIEGEL
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
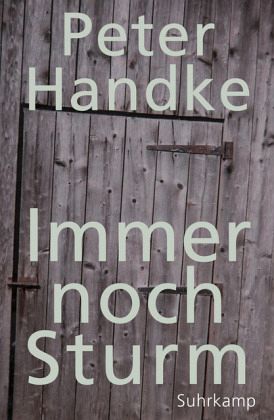





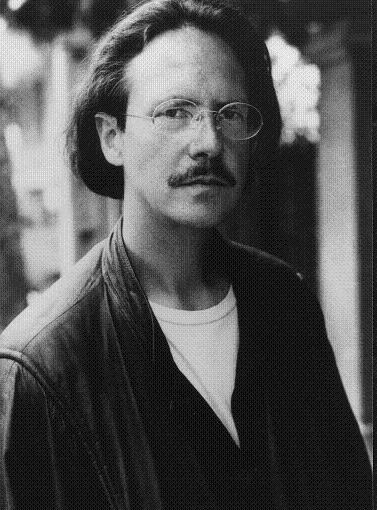
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.10.2010
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.10.2010