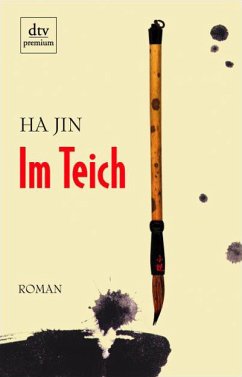Aus dem Englischen von Susanne Hornfeck
Shao Bin, Künstler, Kalligraph und Arbeiter der Düngerfabrik »Ernteglück« in Endstadt, gehört nicht zu denen, die Ungerechtigkeit und Korruption von seiten der Führungskader einfach so hinnehmen. Als er und seine kleine Familie zum wiederholten Male bei der Wohnungszuteilung übergangen werden, glaubt er sich im Recht, die Machenschaften »dieser Banditen« endlich aufzudecken.
»So kann der Pinsel eines wahren Gelehrten das Gute befördern und dem Übel vorbeugen«, liest er in einem Buch über altchinesische Weisheit, und inspiriert von solchem Streben nach Gerechtigkeit fertigt er eine Karikatur an, die die ortsansässige Zeitung auch tatsächlich druckt. Einmal in Gang gesetzt, ist die Schraube fortan nicht mehr zurückzudrehen: Shao Bin wird mehrfach verwarnt und bestraft, doch er gibt nicht auf. Im Gegenteil: In immer größere Gewässer wagt Shao Bin sich vor, sogar bis in die Hauptstadt Beijing.
Shao Bin, Künstler, Kalligraph und Arbeiter der Düngerfabrik »Ernteglück« in Endstadt, gehört nicht zu denen, die Ungerechtigkeit und Korruption von seiten der Führungskader einfach so hinnehmen. Als er und seine kleine Familie zum wiederholten Male bei der Wohnungszuteilung übergangen werden, glaubt er sich im Recht, die Machenschaften »dieser Banditen« endlich aufzudecken.
»So kann der Pinsel eines wahren Gelehrten das Gute befördern und dem Übel vorbeugen«, liest er in einem Buch über altchinesische Weisheit, und inspiriert von solchem Streben nach Gerechtigkeit fertigt er eine Karikatur an, die die ortsansässige Zeitung auch tatsächlich druckt. Einmal in Gang gesetzt, ist die Schraube fortan nicht mehr zurückzudrehen: Shao Bin wird mehrfach verwarnt und bestraft, doch er gibt nicht auf. Im Gegenteil: In immer größere Gewässer wagt Shao Bin sich vor, sogar bis in die Hauptstadt Beijing.

Das Warten hat sich gelohnt: Ha Jins Novelle „Im Teich” setzt auf die poetische Gerechtigkeit
Der Marsch durch die Institutionen endet in der Propagandaabteilung. Angetreten hat ihn ein armer Hund. Der Fabrikarbeiter Shao Bin ist nicht nur von schlauer Einfältigkeit, sondern besitzt auch cholerisches Temperament. Anders als seine Kollegen lehnt er sich gegen seine Vorgesetzten auf, die ihn bei der Wohnungszuteilung übergangen haben. Weil er künstlerisches Talent hat, macht er die Direktion in einer Karikatur lächerlich. Er sät Wind und erntet Sturm. Er hält das Fähnchen seiner Gerechtigkeit aufrecht, pinselt in Schönschrift beharrlich Beschwerdebriefe und marschiert trotz aller Schikanen als Propagandist in eigener Sache von einem Publicity-Coup zum nächsten, bis die Pekinger Zeitschrift „Recht und Demokratie” über seinen Fall berichtet. Auf diesen publizistischen Höhen angelangt, kann er der Direktion endlich auf den Kopf spucken. Die Fabrikleitung wird gerügt.
Dem begabten Bin aber macht der Vorgesetzte das Angebot, künftig als „Kunstkader” in der Propagandaabteilung zu arbeiten. Der kleine Mann nimmt an. Doch eine neue Wohnung zu fordern, die seine Familie so dringend benötigt, fällt ihm nicht ein. Abwarten, sagt er sich, frühe Forderungen sind schlechte Forderungen. Auf dem Weg zu seiner neuen Arbeitsstelle, wo er die „Kampagne gegen bürgerlichen Liberalismus” propagieren soll, kann er sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. So endet die Revolte des Kalligraphen, wie sie der chinesische US-Emigrant Ha Jin in seiner Novelle „Im Teich” erzählt.
Jin ist in Deutschland mit seinem Roman „Warten”, in dem ein Mann achtzehn Jahre lang darauf wartet, sich scheiden lassen zu dürfen, zu einiger Bekanntheit gelangt. Das Motiv des Wartens ist auch in diesem Werk zentral: als Alternative zum blindwütigen Angriff. Bin schreckt in seinem Zorn, der meist komisch, aber immer wieder auch unheimlich wirkt, nicht vor einer poetischen Gerechtigkeit zurück, die den Gegner anhand erfundener Vergehen kompromittiert. Selbst Todesdrohungen, die ihm der Affekt abringt, nimmt er nicht zurück.
Weil Bins Zorn maßlos ist, hält man ihn für unzurechnungsfähig. Immer dann, wenn er sich mit seinen Angriffen alle Chancen verbaut zu haben meint, erscheint Bin das Warten als die bessere Option. Immer wieder verwirft sie, um sie am Ende doch zu wählen.
„Im Teich” handelt vom Kampf von Talent und Berufung gegen die Zwänge der Gesellschaft, fragt nach ihrem Recht und danach, wo dessen Grenzen liegen; von einem Kampf, der aus der Perspektive eines Underdogs geführt wird, für den das kommunistische Dogma die Welt ist, außerhalb derer er sich nicht stellen kann. Dabei verbindet Jins Geschichte den Kampf, der ständig zu Ellbogenstößen eines Karrieristen zu verkommen droht, mit Komik. Direktor und Sekretär erinnern an „Dick und Doof”, und der heitere Grundton relativiert die Grausamkeiten der Kader ebenso wie den Opportunismus Bins.
Der Erzähler enthält sich des Urteils und sagt, was ist. Dadurch hält er den Raum zwischen Schuld- und Freispruch offen. Die wohl größte Stärke des Textes besteht jedoch darin, dass er trotz der Novellenform, die mit unerhörten Begebenheiten Dramatik erzeugt, das treffende Bild eines armen Hundes malt, der nur dadurch ungewöhnlich ist, dass er seine Gewöhnlichkeit kläffend zur Schau stellt.
KAI MARTIN WIEGANDT
HA JIN: Im Teich. Novelle. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2001. 179 Seiten, 12 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de
"David gegen Goliath auf Chinesisch - eine sehr fremde, aber höchst vergnügliche Gesellschaftssatire."'Max'
"Eine kleine Erzählung über kleine Leute, eine Komödie im eigentlichen Sinn: gemein und auf deftig-derbe Weise wahrhaft komisch." The New York Times Book Review
"Der Autor ist ebenso einfallsreich wie sein Held, und die einfache Sprache dieser Novelle täuscht!" The New Yorker
"Eine äußerst weise und zutiefst komische Novelle, die genau beobachtete Bilder zu einer brodelnden und dennoch maßvollen Erzählung über soziale Ungerechtigkeit im modernen China zusammenfügt. Durch Ha Jins elegant-komischen Stil geht der Kampf des Arbeiters Shao Bin, sowohl mehr Einfluß innerhalb seiner Gemeinschaft zu bekommen als auch seine Menschenwürde zu erhalten, allerdings weit über seinen Schauplatz im kommunistischen China hinaus und illustriert mit hohem Erkenntnisgewinn ein universelles Rätsel." Publishers Weekly
"Das Anderssein dieser vornehmlich fremden Nation verflüchtigt sich in dem Maße, wie jede einzelne der lebendig gezeichneten Figuren Gestalt auf dem Papier annimmt. Seine Charaktere sind wie immer universell und haben einen hohen Wiedererkennungswert." The Boston Globe
"Ha Jin, dieser Meister der Miniatur, weiß: Es sind die kleinen Dinge im Leben, die uns zerstören." amazon.com (USA)
"Stilistisch brillant serviert Ha Jin einen Text, dem der Leser keinen "China-Bonus" zumessen muss. Scharf gezeichnete Charaktere, treffsichere Pointen und eine distanzierte Eleganz lassen die oftmals ermüdende Lektüre chinesischer Gegenwartsliteratur vergessen."'Lübecker Nachrichten'
"Eine kleine Erzählung über kleine Leute, eine Komödie im eigentlichen Sinn: gemein und auf deftig-derbe Weise wahrhaft komisch." The New York Times Book Review
"Der Autor ist ebenso einfallsreich wie sein Held, und die einfache Sprache dieser Novelle täuscht!" The New Yorker
"Eine äußerst weise und zutiefst komische Novelle, die genau beobachtete Bilder zu einer brodelnden und dennoch maßvollen Erzählung über soziale Ungerechtigkeit im modernen China zusammenfügt. Durch Ha Jins elegant-komischen Stil geht der Kampf des Arbeiters Shao Bin, sowohl mehr Einfluß innerhalb seiner Gemeinschaft zu bekommen als auch seine Menschenwürde zu erhalten, allerdings weit über seinen Schauplatz im kommunistischen China hinaus und illustriert mit hohem Erkenntnisgewinn ein universelles Rätsel." Publishers Weekly
"Das Anderssein dieser vornehmlich fremden Nation verflüchtigt sich in dem Maße, wie jede einzelne der lebendig gezeichneten Figuren Gestalt auf dem Papier annimmt. Seine Charaktere sind wie immer universell und haben einen hohen Wiedererkennungswert." The Boston Globe
"Ha Jin, dieser Meister der Miniatur, weiß: Es sind die kleinen Dinge im Leben, die uns zerstören." amazon.com (USA)
"Stilistisch brillant serviert Ha Jin einen Text, dem der Leser keinen "China-Bonus" zumessen muss. Scharf gezeichnete Charaktere, treffsichere Pointen und eine distanzierte Eleganz lassen die oftmals ermüdende Lektüre chinesischer Gegenwartsliteratur vergessen."'Lübecker Nachrichten'
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Ha Jins vorhergehender Roman hieß "Warten" und hat es laut Kai Martin Wiegandt selbst hierzulande zu einiger Popularität gebracht. Auch diesmal sei das Warten eine zentrale Metapher, meint er - als Alternative zum cholerischen Charakter von Jins Protagonisten, einem Underdog und Fabrikarbeiter, der sich gegen eine Schikane in der Wohnungszuweisung auflehnt, weil er nun mal nicht anders kann. Er macht damit ungeahnt Furore und am Ende als Kunstkader in der Propagandaabteilung seines Betriebes Karriere. Das hört sich fast an wie eine Satire, und in der Tat hat die Novelle ihre komischen Seiten, aber durchaus auch dramatische Seiten, betont Wiegandt. Eine für den Rezensenten rundum gelungene Erzählung, die es schafft, das Bild eines Mannes zu zeichnen, der "nur dadurch ungewöhnlich ist, dass er seine Gewöhnlichkeit kläffend zur Schau stellt", schreibt er.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH