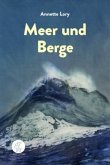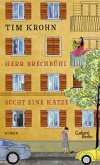Man hat ihn, halb erfroren, im Wald gefunden: Matthias Schwitter. Jetzt liegt er in der Klinik, und durch seinen Kopf jagen Erinnerungen, Bilder, Schatten eines Lebens, das nicht weit zurückliegt. Und noch lange nicht gelebt ist. Was hat er tagaus, tagein in der Bank zu tun gehabt? Auf welchen Wegen ist er durch Zürich geirrt? Warum hat sich eine Liebe nicht verwirklicht? »Schnee und Regen ließen sich nieder, und Schwitter saß da und schaute. Jede Flocke vermochte er wahrzunehmen und jeden Tropfen, so langsam ging das vor sich. Das Wetter ließ ihm Zeit. Wie ungleich sie doch waren, verspielt der Schnee, geradlinig und atemlos der Regen, und doch in einer Art Tanz vereinigt, harmonisch und, ja, von einer Leichtigkeit, die sich festsetzte im Gedächtnis. Nicht einmal die Hände brauchte er auszustrecken, um das Glück zu befühlen.«

Thomas Schenk geht ans Limit: "Im Schneeregen"
Wer Schneeregen als Metapher für die Liebe wählt, deutet an, dass etwas im Argen liegt. Matthias Schwitter liegt im Krankenhaus und erholt sich von seinen Erfrierungen. Auf einer Wanderung durch die Schweizer Voralpen ist der Bankangestellte aus Zürich zuvor beinahe gestorben. Was aber anfangs wie ein Unfall aussieht, entpuppt sich bald als gezielter Grenzgang. Die bevorstehende Arztvisite bringt Schwitter in Erklärungsnot. Nach und nach rekonstruiert er seinen Ausflug und dessen Hintergründe.
Matthias Schwitter ist ein Mensch, der aus Furcht vor Veränderung sein Leben mit profanen Zwangsneurosen stabil hält. Mit ihm entwirft der Schweizer Autor Thomas Schenk den Prototyp einer in sich gefangenen Existenz. Jede Form von Spontaneität ist für Schwitter ein Ärgernis, der Zufall eine Plage, Unsicherheit ein nicht zu ertragender Zustand. Ein kurzfristig abgesagter Friseurtermin wirft ihn vollkommen aus der Bahn. Ein Cafébesuch wird zur quälenden Entscheidungsfindung. Selbst seine Beziehung zu Beatrice findet ein jähes Ende, als die Freundin ihn mit Zugtickets nach Rom überrascht.
Dennoch macht sich Schwitter irgendwann gezielt auf die Suche nach einer Grenzerfahrung. Was folgt, ist ein kalkulierter Kontrollverlust, eine "Exkursion" mit wissenschaftlicher Zielsetzung. So bezeichnet Schwitter seinen Gang in den Schneeregen. Präzise bestimmt er die ideale Temperaturgrenze, an der ein "Schreiten im Schneeregen" möglich sein soll. Er schwadroniert über die Vereinigung von Aggregatzuständen: "Wenn Schnee und Regen genau gleichviel Raum einnehmen, dann stellt sich, einem Naturgesetz gleich, das alles durchdringende Harmoniegefühl ein." Dieses Gemisch aus Schnee und Regen hat die Wissenschaft noch nicht erschlossen. Deshalb sieht Schwitter darin eine Gelegenheit zu erproben, mit dem Unbestimmten umzugehen und das Vage zu ertragen. Schließlich avanciert der Schneeregen vom Sinnbild für Harmonie sogar zur großen Metapher für gelingende und vergängliche Zweisamkeit: Die Art und Weise, wie Schnee und Regen sich vereinigen, gleiche "zwei Menschen, die nur zögerlich zueinanderfinden".
Hinweise, die Zweifel an Schwitters Zurechnungsfähigkeit wecken, sind sehr subtil gesetzt. Paranoides Misstrauen, selbstverletzendes Verhalten und Wahnvorstellungen reihen sich wie selbstverständlich in seine Schilderungen. Empfindungen bleiben zu jedem Zeitpunkt physischer Art. Spät ahnt man, dass der Zimmergenosse im Krankenhaus nicht nur Schwitters abhandengekommener Gesprächspartner, sondern auch ein medikamentös betäubter Teil seiner Persönlichkeit ist.
Dem Autor der Geschichte "Im Schneeregen" mangelnde sprachliche Umsetzung der Grenzerfahrung vorzuwerfen wäre angesichts der Perspektive eines in sich gefangenen Ich-Erzählers verfehlt. Denn die Stärke des Buches besteht gerade in der Figur Schwitters, eines Mannes, der die eigene Entgrenzung erklärt, ohne zu bemerken, dass er noch im Moment der Selbstaufgabe ein Gefangener der eigenen Zwänge ist. Thomas Schenk könnte nur dann glaubwürdig zu einer vielseitigen Sprache finden, wenn seiner Hauptperson ein Ausbruch tatsächlich gelänge. Dass Schwitter sich am Ende bemüht, der verschiedenen Aggregatzustände des Schneeregens mit lateinischen Termini Herr zu werden, macht seine Not allzu deutlich. Zwangsläufig bleibt die Sprache des Autors steif und künstlich. Obschon es kein Gütesiegel sein kann, eine uniforme Geschichte eintönig zu erzählen, muss man Thomas Schenk die Konsequenz zugutehalten, mit der er seine Figur bis zum Ende verfolgt.
NADJA WÜNSCHE.
Thomas Schenk: "Im Schneeregen". Eine Geschichte.
Weissbooks Verlag, Frankfurt am Main 2010, 104 S., 16,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Eher enttäuscht hat Rezensentin Dorothea Dieckmann dieses Buch über beiseite gelegt. Dabei verkraftet sie noch am besten, dass diese Erzählung aus dem "Hohlraum einer blutleeren Existenz" bereits ähnliche Vorläufer hat. Schlimmer findet sie, dass die Geschichte der "Dissoziation eines unglücklichen Bewusstseins" konventionell gestaltet ist. Die literarische Technik dieses Autors sei, schreibt sie, sehe man einmal von der "sorgfältig gearbeiteten" Schlüsselsituation und ihren Variationen ab, ebenso "fade wie der unscheinbare Erzähler-Protagonist selbst" . Die Grenzerfahrung, die er erleide als "sprachliche Grenzerfahrung fühlbar zu machen", das hätte dieser Text ihrer Ansicht nach mindestens leisten müssen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH