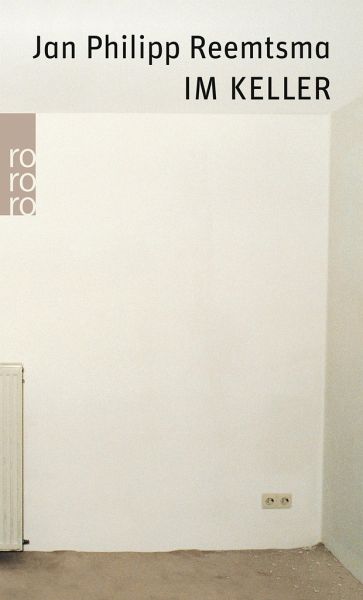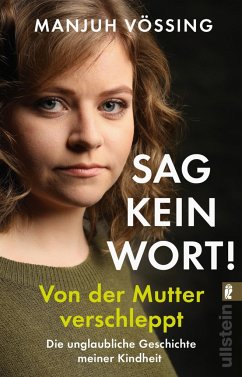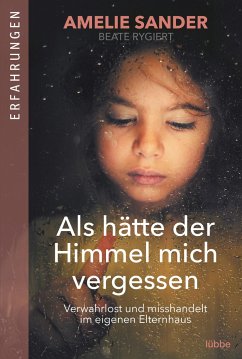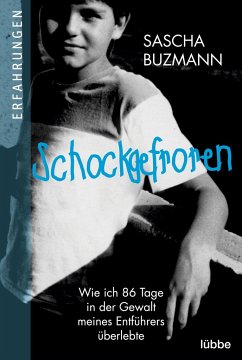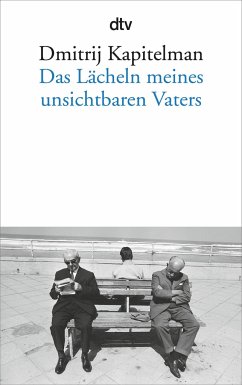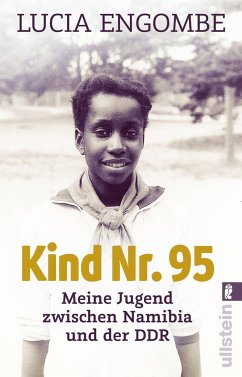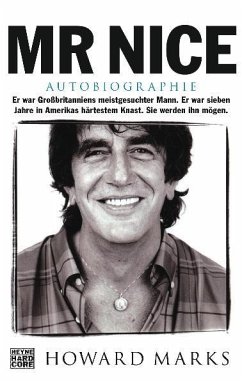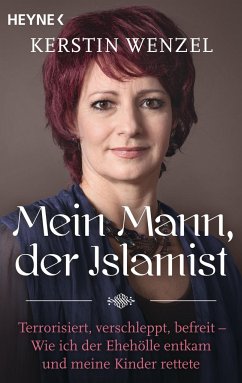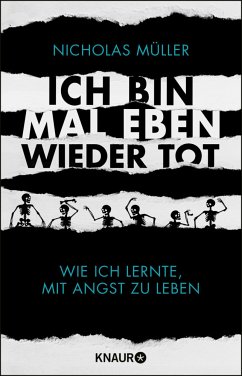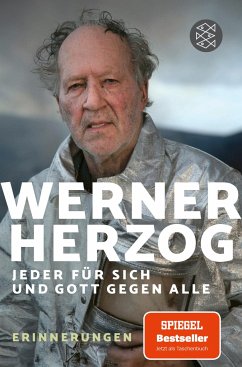Jan Philipp Reemtsma
Broschiertes Buch
Im Keller

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Am 25. März 1996 wurde Jan Philipp Reemtsma entführt. Erst nach Zahlung eines Lösegeldes von 30 Millionen Mark kam er frei. Dies ist sein aufregender Bericht über seine Gefangenschaft.
Jan Philipp Reemtsma, geboren 1952, ist Vorstand des Hamburger Instituts für Sozialforschung und der Arno Schmidt Stiftung, Mitherausgeber der Bargfelder Ausgabe der Werke Arno Schmidts, der 'Politischen Schriften' von Christoph Martin Wieland und hat einen Lehrauftrag an der Universität Hamburg. Der promovierte Philologe veröffentlichte 'Falun. Reden und Aufsätze' (1992), 'Das Buch vom Ich. Christoph MartinWielands ¿Aristipp und einige seiner Zeitgenossen¿' (1993) und 'Mehr als ein Champion. Über den Stil des BoxersMuhammad Ali' (1997).
Produktdetails
- rororo Taschenbücher 22221
- Verlag: Rowohlt TB.
- Artikelnr. des Verlages: 10393
- 11. Aufl.
- Seitenzahl: 224
- Erscheinungstermin: 1. Oktober 1998
- Deutsch
- Abmessung: 188mm x 113mm x 22mm
- Gewicht: 183g
- ISBN-13: 9783499222214
- ISBN-10: 3499222213
- Artikelnr.: 07364663
Herstellerkennzeichnung
Rowohlt Taschenbuch
Kirchenallee 19
20099 Hamburg
produktsicherheit@rowohlt.de
Was er erlebte und erlitt, ist in der Tat ein geballter Filmstoff. Wann hat es das je gegeben, daß das Opfer einer Entführung derart reflexionsfähig gewesen wäre wie Jan Philipp Reemtsma? Der Spiegel
Ein Mann wird entführt und nach Zahlung von unglaublichen 30 Millionen DM nach 33 Tagen wieder freigelassen. Das hört sich nach einem Thema für eine spannende und actionreiche Räuberpistole an, doch 'Im Keller' ist eher ein psychologisches Kammerspiel als ein packender …
Mehr
Ein Mann wird entführt und nach Zahlung von unglaublichen 30 Millionen DM nach 33 Tagen wieder freigelassen. Das hört sich nach einem Thema für eine spannende und actionreiche Räuberpistole an, doch 'Im Keller' ist eher ein psychologisches Kammerspiel als ein packender Kriminalroman. Jan Philipp Reemtsma, der im Jahre 1996 entführt wurde, berichtet des Geschehene aus drei Perspektiven: Zum einen die Außenseite (wie er es mit eigenen Worten bezeichnet) wie sie seine Frau und sein Sohn durchlebten. Dann folgen seine eigenen Erlebnisse soweit er sich daran erinnern kann, während er im dritten und letzten Teil zusammenzufassen versucht, was das ihm Widerfahrene in ihm auslöste.
Schon die gerade mal ersten 40 Seiten lösen beim Lesen eine anhaltende Erschrockenheit aus, obwohl es sich im Grunde genommen um nichts anderes als eine sachliche, chronologische Darstellung dieser 33 Tage und der Zeit danach handelt. Doch insbesondere das Verhalten der Presse war selbst damals (fast 20 Jahre liegt das Ganze zurück) so rücksichts- und respektlos, dass man nur ungläubig den Kopf schütteln kann ('Wenn man nicht will, dass einem ins Fenster hineinphotographiert wird (und man will nicht), muss man die Vorhänge vorziehen. ...man bleibt im Haus - das dann eben kein Zuhause mehr ist, sondern ein Versteck, das man abdichten muss gegen unbefugten Einblick.').
Die nächsten 100 Seiten beschreiben die Entführung selbst aus der Sicht des Opfers in der dritten Person Singular. Es ist der Versuch des Autors, das Ganze mit Abstand zu berichten um so auch zu zeigen, '...dass es keine Ich-Kontinuität von meinem Schreibtisch zu dem Keller gibt...'. Mir fiel es hier teilweise schwer, dem Ganzen zu folgen, da immer wieder ein Wechsel von der ersten zur dritten Person Singular eintritt, sobald der Autor aus seiner Perspektive den Geschehnissen etwas hinzuzufügen hat. Dennoch wird überdeutlich, welcher Druck in dieser Zeit herrschte: Würde er lebend den Keller verlassen, seine Familie wiedersehen? Wie würde er sterben? Würden sie ihn zuvor verstümmeln? Dennoch versucht er seine Würde zu bewahren so weit dies, gefesselt an eine Fußkette, möglich ist. Selbst sein Humor verlässt ihn nicht ganz.
Im letzten Teil mit knapp 70 Seiten analysiert Jan Philipp Reemtsma, was in diesem Keller mit ihm geschehen ist. Dies ist wohl der erschreckenste Teil des Buches, denn es wird überdeutlich klar, dass von dem Mensch der in solch eine Situation gerät, nicht mehr viel bleibt. Die Ohnmacht ist absolut und diese entsetzliche Erfahrung wird man wohl nie wieder los.
Ein bedrückendes aber auch lehrreiches Buch, das nicht immer ganz einfach zu lesen ist.
Weniger
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Die Doku eines Entführungsdramas *****
Am 25. März ist es 30 Jahre her, dass Jan Philipp Reemtsma entführt wurde. Sein Buch stammt von 1997. Und dass ich es endlich gelesen haben, liegt an dem Film „Wir sind dann mal die Angehörigen“, der die Entführung aus …
Mehr
Die Doku eines Entführungsdramas *****
Am 25. März ist es 30 Jahre her, dass Jan Philipp Reemtsma entführt wurde. Sein Buch stammt von 1997. Und dass ich es endlich gelesen haben, liegt an dem Film „Wir sind dann mal die Angehörigen“, der die Entführung aus der Sicht seines Sohnes Johannes Scheerer schildert. *****
Anfangs, und das ist schon packend, beschreibt der Autor den Ablauf der Entführung, die Arbeit der Polizei, wie die Geldübergabe scheitert und wie man ohne Polizei die Geldübergabe hinbekommt. 33 Tage nach der Entführung wird er in einem einsamen Wald freigelassen. *****
Doch das Hauptanliegen des Buches ist die Sicht des Gefangenen, der in einem fensterlosen Keller angekettet 33 Tage verbringen muss und nur morgens und abends mit Essen versorgt wird. *****
Reemtsma schildert, wie er sich freute, als er nach den gescheiterten Übergaben mitüberlegen musste, welche Personen noch für die Geldübergabe in Frage kommen. Letztlich machte es ein Pastor, den er noch von der Hafenstraße kannte. *****
Selbst nach seiner Freilassung ist sein Leben massiv beeinträchtigt. Er verträgt kein Klopfen an der Tür mehr und auch in einem Hotel haben ihn Schritte im Flur bereits geweckt. *****
5 Sterne für ein Buch, das einem Einblicke in eine Welt bietet, die du nie erleben willst.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für