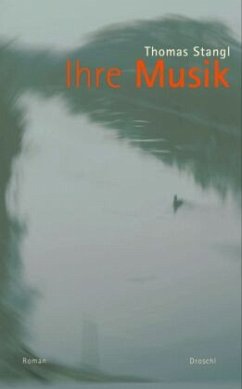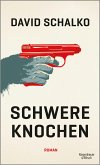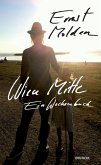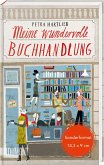In einer überwältigenden Sprach- und Bilderflut, in der sich die Wirklichkeit ständig aufzulösen droht, beschwört Stangl einerseits eine bestimmte Topographie, ein Wien, das so überwältigend kaum je zu lesen war, andererseits die Zeit, das Vergehen der Zeit. Wie in einem Taumel stürzt der Leser in die Erinnerungen und Vorstellungen zweier Frauen, Mutter und Tochter, und droht in ihnen verloren zu gehen. Ein überwältigendes Leseerlebnis, das unsere Wahrnehmung in eine andere Dimension hebt. Thomas Stangl ist ein einzigartiger Erforscher des Bewußtseins, ein Reisender in Bereichen, in denen nur die Literatur Ergebnisse zutage bringt.

Thomas Stangls „Ihre Musik”
Der jüngst verstorbene Lyriker Oskar Pastior wusste, wo seine Leser zu finden sind: in der versprengten Schar der „Wörtlichnehmer”. Gemeint sind jene, die nicht hinter jedem Satz schon die Verfilmung ahnen, sondern, so emotional aufgewühlt sie auch sind, der Sprache lauschen, den Worten, den Sätzen, dem Rhythmus, und dann erst Bilder sehen und sich Drehbücher ausmalen. Die Sprache selbst erzählt unendlich viele Geschichten.
Thomas Stangl ist solch ein Wörtlichnehmer. Schon sein erstes, zum Teil hymnisch besprochene Buch „Der einzige Ort” – ein Afrikaroman über zwei Entdecker und die Vergeblichkeit, auf die Erlösung durch das Fremde zu hoffen – insistiert auf dem Primat der Erkenntnis durch die Sprache. Sein Wohnviertel, die Wiener Leopoldstadt, hat er, so bekannte er in Interviews, für den Roman jedenfalls nicht verlassen.
So verwundert es nicht, dass sich in seinem zweiten Buch „Ihre Musik” fast die gesamte Biographie der beiden Hauptfiguren in diesem Stadtteil abspielt. Wie der Hilfsbuchhalter in Fernando Pessoas „Buch der Unruhe” die Lissabonner Unterstadt durcheilt, so kreuzen auch Emilia und Dora, jede für sich, wieder und wieder die gleichen Plätze, Straßen und Häuser, immer dem Nachhall der eigenen Sätze lauschend, dem Wiedererkennen eines Gedankens auf der Spur, den Erinnerungen auf den Fersen.
Thomas Stangl glaubt nicht an Geschichten, sondern an Situationen, die er mit seiner Sprache auslotet. Das kann nur gelingen, wenn diese Situationen prinzipiell für die Sprache offen bleiben, sich nicht zu Bild und Plot verfestigen, denn nur dann wächst die Situation wie die Sprache fort: „Ganz langsam dehnen sich unter der Erde die Wurzelgeflechte der Bäume (vor kaum mehr als zwanzig Jahren gepflanzt) aus, eine Handfläche, eine Wange an der rauen Haut der Stämme, dunkles vom Wind bewegtes Laub, gleichgültige Körper, in die das Sonnenlicht einsickert, verwandelt wird, für die Atmenden, Körper, die keinen Blick verlangen und keinen Blick erwidern.” Die beiden Frauen bleiben einsam, die Stadt öffnet sich ihnen nicht, die Passanten schauen sie nicht an, und nur sie beide scheinen die Wohltat der Bäume, den Trost der verwandelnden Sprache zu kennen – ein Dazwischen, in dem manchmal ein Art Singen zu vernehmen ist: „Ihre Musik”.
Sie leben in derselben Wohnung, arbeiten beide mit der Sprache, die Mutter als engagierte Journalistin, die Tochter promoviert über spanische Lyrik, sie teilen Bad und Küche, bleiben aber trotzdem getrennt: Unterhaltungen gibt es nur als imaginierte Zwiegespräche beim Spazieren oder als simulierte Dialoge, als die Tochter erkrankt und die Mutter sie pflegt. Zwei Leben lagern sich in Schichten wechselseitig übereinander, ohne einander wirklich zu berühren.
Der Eindruck, den eine solche dramaturgische Raffung erzeugt, ist missverständlich. Der Zugwind der Sprache, in dessen Sog die einsamen Frauen manchmal schlafwandlerisch zu fliegen scheinen, könnte an Marguerite Duras erinnern, doch Stangls Buch liest sich fast wie ein Gegenentwurf dazu. Es geht ihm nicht darum, eine psychologische Spannung zwischen den beiden Figuren aufzubauen, die in zeitlich versetzten Loops die gleichen Stationen passieren, sondern er will ein Dazwischen einkreisen, den ungreifbaren Moment Gegenwart, in dem sich Vergangenheit und Zukunft scheiden.
Dieses Dazwischen ist kein Zeitraum, sondern ein Vorüberstreifen, das Thomas Stangl mit dem Sprachzoom seiner schwingenden Perioden einzufangen versucht. Die Bilder, die dabei entstehen, springen wie bei einem digitalen Videorekorder unentwegt zwischen dem unspektakulären Vordergrund und dem leeren, sehr oft verschwommenen Hintergrund hin und her, finden ihren Fokus einmal im Innern der Figuren, dann im Äußern ihrer Wahrnehmung. Das Geheimnis, das dabei entsteht, ist ihre Geheimnislosigkeit.
Am Ende ist es die Tochter, die vor der Mutter stirbt: „Was fehlt”, lauten die letzten Worte des Buches. Prinzipiell unabschließbar hält es am Ende einer Schleife inne und hallt im Leser lange nach. HANS JÜRGEN BALMES
„Thomas Stangl glaubt an Sprache, nicht an Geschichten.”
Thomas Stangl
Ihre Musik
Roman. Droschl Verlag, Graz 2006. 192 Seiten, 18,50 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

Verstörung als Formprinzip: Thomas Stangls zweiter Roman
"Wie in einem Taumel stürzen wir in die Erinnerungen und Vorstellungen der beiden Frauen hinein und drohen in ihnen verloren zu gehen": Was der Verlag in enthusiastischem Ton zum neuen Roman des österreichischen Schriftstellers Thomas Stangl annonciert, ist auf gespenstische Weise wahr. Der Text ergießt eine Bilder- und Sprachflut - und wir gehen beinahe darin unter. Ob dieser Umstand allerdings für das Buch spricht, bleibt erst noch zu klären. Ein vertrackter Fall ist dieser Zweitling des 1966 in Wien geborenen Schriftstellers auf jeden Fall, der vor zwei Jahren für "Der einzige Ort" mit dem Aspekte-Preis ausgezeichnet wurde. Wie schwierig der Zugang zum hermetischen Sprachgebilde ist, davon zeugen auch die positiven Kritiken, die bislang diese Geschichte einer Mutter-Tochter-Beziehung würdigten - denn selbst das Lob wird oft weniger am Text als an der Person und der elitären Haltung des Autors entwickelt.
Stangl macht es dem Leser nicht leicht. Man wird den Eindruck nicht los, hier wolle einer nicht erzählen, sondern sich in der Sprache verbarrikadieren, keinen Ausschnitt des Lebens zeigen, sondern sich gegen dieses Leben mit einer undurchdringlichen Sprachhülle panzern. Der erste Texteindruck ist ein visueller, und er ist durchaus symptomatisch. Der Roman drängt atemlos voran, meist über viele Seiten ohne Abschnitte, ohne Kapitel, ohne optisch wahrnehmbare Gedankenzäsuren - ein einziges gigantisches Textgeschiebe, das sich seinen Weg bahnt. Dieses Muster wiederholt sich auf der Mikroebene: Wenig ordnende Strukturen sind auszumachen, ebenso wenig Hierarchien des Erzählten oder eine Fokussierung auf Handlungszentren. Stattdessen wird man mit einer manisch detaillierten Beschreibung von Kulissen, Figuren und Aktionen konfrontiert. Jede Beobachtung erscheint gleich wichtig, mit dem Effekt, dass sich alles gegenseitig neutralisiert.
Trotzdem gibt es eine Art Handlung. Emilia Degen, eine Universitätsdozentin, und ihre Tochter, die eben vor dem Abschluss ihres juristischen Studiums steht, leben zusammen in einer Wohnung im Wiener Stadtteil Leopoldstadt. Beide sind Verlorene. Die Tochter, die unter multipler Sklerose leidet, lebt durch die existentielle Erfahrung der latenten Todesbedrohung in einer Zwischenwelt. Die Mutter ist der Tochter fremd, ihre Sätze erreichen sie nicht, ihre Gefühle berühren sie ebenso wenig. "Jede Annäherung (so unvermittelt sie erscheinen mag) hat etwas von einem Wiedererkennen und zugleich von einem immerfort Verlieren." Auf diese paradoxe Formel bringt der Text das Verhältnis der beiden Frauen. Die Mutter, eine Frau über fünfzig, erscheint der Tochter eingeschlossen in ihr Denken und in ihre Texte, die sie für Zeitschriften schreibt, die niemand liest. Die Tochter aber, lebenssüchtig und wirklichkeitsgierig, fühlt sich im Mutterleben eingekerkert wie in einem Verlies, aus dem es kein Entkommen gibt. Ohne Vertrauen und ohne Trost erschafft sie in ihrem Denken ständig eine Gegenwelt, in dem sie sich selber ein "Gegenvertrauen" und einen "Gegentrost" gibt.
Um dieses inhaltliche Zentrum dreht sich die Erzählmaschine ohne Anfang und ohne Ende. Die Irritation über die formale Entwicklungslosigkeit überwiegt schließlich doch, da sie in keiner Funktion zum Geschehen des Romans steht. Stangl erreicht mit seiner Erzählstrategie weniger ein mit Sinn aufgeladenes Oszillieren zwischen der Realität und dem Abgründigen, eine Erweiterung des Konkreten in das Imaginäre als eine Zersplitterung in Einzelteile, welche die Erzähllandschaft seltsam verstellen.
PIA REINACHER
Thomas Stangl: "Ihre Musik". Roman. Droschl Literaturverlag, Graz 2006. 192 S., geb., 19,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Auch in seinem zweiten Buch "Ihre Musik" geht es Thomas Stangl nicht um Plots und Geschichten, sondern um Momente, erklärt Hans Jürgen Balmes. Stangl schildert Momente aus dem Leben von Mutter und Tochter, die zwar eine Wohnung teilen, aber dennoch ganz in getrennten Welten leben. Was der Rezensent nun erwartet, nämlich der Versuch, die Psychologie zwischen den beiden Figuren auszuloten, trifft nicht ein: Stangl verlasse sich vielmehr ganz auf die Erkenntnis stiftende Kraft der Sprache und spüre dem "ungreifbaren Moment Gegenwart" in den einsamen Spaziergängen der beiden Protagonistinnen durch Wien nach, so Balmes fasziniert, und lässt wissen, dass der offene Schluss des Romans noch länger in ihm nachschwingt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH