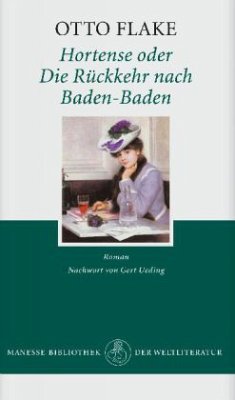Vitalität, frecher Eigensinn und ein gewinnendes Wesen - das sind die Waffen, mit denen Hortense von Wierssen die Welt des 19. Jahrhunderts erobert. Vor einer standesgemäßen Vermählung läuft sie davon und ihr Weg führt sie auch nach New York, Brüssel, London und Paris. Sie durchlebt eine Reihe von Beziehungen, Entführungen sowie Irrungen und Wirrungen. Als Zeitzeugin der europäischen Geschichte empört sie sich u. a. mit Kaiserin Sisi über die Zwänge des österreichischen Hofes und findet Aufnahme in den Kreis um Iwan Turgenjew.
In ihrer Lebensmitte kehrt sie in die alte Heimat zurück - als kritische Einzelgängerin, die nun Weltbürgertum und Lebensklugheit zu vereinen weiß.
In ihrer Lebensmitte kehrt sie in die alte Heimat zurück - als kritische Einzelgängerin, die nun Weltbürgertum und Lebensklugheit zu vereinen weiß.

Ein Plädoyer für Otto Flake anlässlich der Neuausgabe seines Romans „Hortense” (1933)
Schon lange wurde nichts mehr für Otto Flake (1880 bis 1963) getan. Eine fünfbändige Auswahlausgabe, die von 1973 bis 1976 bei S. Fischer herauskam, war die letzte verlegerische Anstrengung für diesen Autor. Inzwischen wuchs eine neue Generation von Lesern heran, die seinen Namen noch nie gehört haben mag. Dabei ist Flake ein bedeutender Schriftsteller mit einem Ouevre von überbordender Fülle. Es besteht zu etwa gleichen Teilen aus Essayistik, Romanen und Erzählungen sowie Geschichtsschreibung. Zu Flakes Lebzeiten erschienen annähernd hundert Bücher von ihm, einige waren zu ihrer Zeit Bestseller, und mehr als das: große Erfolge bei der Kritik. Für Flake haben sich seit den frühen zwanziger Jahren Tucholsky, Sieburg, Rychner, später Golo Mann, Peter Härtling und Rolf Hochhuth eingesetzt. Tucholsky nannte ihn schon 1922 „unseren bedeutendsten Essayisten neben Heinrich Mann”. Friedrich Sieburg schloss eine warmherzige Würdigung 1960 mit dem pathetischen Satz: „Der Strahl fällt auf das, was über uns hinausragt.”
Der Manesse Verlag hat nun mit einer Neuausgabe den Roman „Hortense oder Die Rückkehr nach Baden-Baden” zur Weltliteratur erklärt. „Hortense” gilt als Flakes bestes Werk, seine pièce de resistance. Wirklich beurteilen könnte man das nur, wenn man die Dutzenden anderen Erzählwerke gelesen hätte, die oft nicht einmal den Weg in die von Rolf Hochhuth betreute Werkausgabe von 1973ff. gefunden haben; diese nämlich gewährte selbst der „Hortense” keine Heimstatt – denn damals war das Buch noch lieferbar. Eine Ausgabe, die sich damit abgibt, Lücken des nicht Lieferbaren zu schließen und dafür ein höchstgeschätztes Hauptwerk ausschließt: Man darf wahrlich mit Sieburg sagen, Flake habe „die ganze Problematik einer schriftstellerischen Existenz in Deutschland auskosten dürfen”.
Ein verdächtiger Freigeist
„Hortense” erschien 1933, an einem Wendepunkt im Leben ihres Verfassers. Er stammte aus dem Elsass, war in Colmar aufgewachsen. Als junger Mann stand er dem Expressionismus nahe, war mit Benn bekannt und wirkte in Berlin und Paris. Im Ersten Weltkrieg war der perfekt Frankophone als Militärverwalter in Brüssel. Unmittelbar nach dem Krieg schloss er sich den Dadaisten in Zürich an, lebte später eine Zeit lang im soeben von Italien übernommenen Südtirol hoch über Bozen. Dort fiel er einem faschistischen Journalisten unangenehm auf, der dafür sorgte, dass die italienische Polizei ihn samt Gepäck und Familie an die Schweizer Grenze expedierte.
Seit 1928 hatte Flake seinen Wohnsitz in Baden-Baden, in der mild-eleganten Landschaft am Fuß des Schwarzwalds, die für ihn das rechtsrheinische Pendant zu seiner verlorenen elsässischen Heimat bedeutete. Diese Gegend mit ihren landschaftlichen Reizen und ihrer teils fürstlich-barocken, teils europäisch-großbürgerlichen Geschichte machte er sich vollkommen zu eigen, als Historiker wie als Romancier; hier blieb er bis zu seinem Tod. Das provinziell gewordene Nest hat es ihm nicht gedankt: Als die örtliche SPD im Jahre 1960 einen Antrag auf Erteilung der Ehrenbürgerwürde stellte, lehnten CDU und FDP ab – ihnen war Flake zu freigeistig.
1933 hat Flake einen Fehler begangen. Er unterschrieb einen Wisch der Nazis, der wie eine Formsache aussah, dann aber als Treueerklärung der daheimgebliebenen Schriftsteller groß herausgestellt wurde. Die emigrierten Kollegen haben ihm das nie verziehen, obwohl sein Fall wahrhaftig anders lag als der Gottfried Benns. Flake ist nie Nationalist oder gar Rassist gewesen; neben Ernst Robert Curtius und Heinrich Mann hatte schon in den zwanziger Jahren kaum jemand so viel für die Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich getan wie der bikulturelle Flake. 1932 publizierte er eine meisterhafte, spürbar von zeitgenössischen Chaoserfahrungen belebte Geschichte der Französischen Revolution; sie setzt sich ganz frei mit den damals neuesten marxistischen Deutungen auseinander, ist glühend farbig und kühl gerecht. Wie alle Geschichtswerke Flakes – seine Biographie Huttens, seine „Großen Damen des Barock”, sein „Türkenlouis” (dahinter verbirgt sich ein badischer Fürst, der 1683 gegen die Osmanen kämpfte) – zählt sie zu der von ihm erfundenen Gattung „der zwanglos klugen Werke, die amüsant und menschlich sind”.
Wie wenig (nämlich nichts) Flake mit den Nazis zu schaffen hatte, zeigt eben die „Hortense” aus dem Unheilsjahr 1933. Der Roman erzählt die Geschichte einer adligen Frau, die von 1828 bis 1908 lebte. Der Fall ist nicht völlig frei erfunden, sondern badischen Nachlässen entnommen. Mit achtzehn flüchtet die junge Hortense von Wierssen aus ihrem Lebensumkreis, weil sie keine Lust auf das eingesperrte Krinolinenleben einer Aristokratin hat. Sie lebt mit wechselnden Männern in Brüssel, Paris, New York, Genf, an der Ostsee und in Italien, führt ein elegantes und zugleich prekäres Wanderleben in den Zentren der historischen Entwicklung ihrer Zeit.
Erst lernt sie die Welt des aufsteigenden Kapitals in Belgien (damals ein Zentrum der Schwerindustrie) und Amerika kennen; dann durch weitere Freundschaften den Adel und die Arbeiterbewegung. Zuletzt gilt ihre Liebe einem deutschen Gelehrten, der Züge Nietzsches trägt. Flake legt einen Fluch über sie: Ihre Männer und Geliebten sterben einer nach dem anderen durch Krankheit oder Unfall. Das erlaubt es, die Handlung bewegt zu halten und ein düsteres Schicksalskolorit (das er aufs Klügste wieder dämpft) über diese Biographie zu legen.
Die „Heimkehr”, die der Titel des Romans ankündigt, besteht darin, dass die immer noch schöne, aber nicht mehr ganz junge Hortense sich in Baden-Baden niederlässt (und dort eine letzte Ehe eingeht). Inzwischen hat der Roman die sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts erreicht, die Zeit unmittelbar vor der deutschen Einigung durch Bismarck.
„Hortense” ist ein Wunderwerk des historischen Kolorits. Schon das Wanderleben der Heldin durch das Europa und Amerika der Zeit nach 1848 ist sowohl in der allgemeinhistorischen wie der frauengeschichtlichen Seite mit größter Feinheit gezeichnet (in London kann eine Dame allein ausgehen, ohne belästigt zu werden, in Paris nicht). Der Baden-Badener Teil wird zu einem Panorama der kosmopolitischen europäischen Gesellschaft unmittelbar vor dem endgültigen Sieg des Nationalismus. Zwischen Kasino, Musikpavillon, Lichtenthaler Allee, Ausflügen an der Oos, nächtlichen Schwarzwaldfahrten bewegt sich eine sowohl gesellschaftliche wie künstlerische Aristokratie, in der empfindsame Damen das Heft in der Hand haben. Turgenjew, Dostojewski, König Wilhelm von Preußen, die Sängerin Viardot erhalten Haupt- und Nebenrollen.
Flakes Ton ist eine gefühlvolle Lakonie, die er Stendhal, seinem bewunderten Vorbild, abgeschaut hat. Er hält sich streng an die Chronologie und entwickelt aus Bericht, Dialog und Landschaftsausblick einen immer gleichen Rhythmus, der das verfließende Leben mit geheimer Trauer wiedergibt. Eine sentimentale Nüchternheit ist die Atmosphäre dieses Buches. Es ist ein Bildungsroman nach französischem Verständnis: einer, der nicht der deutschen Illusion nachhängt, in der brausenden Jugend lerne man das Leben für die spätere Zeit; sondern der weiß, dass jede Lebensstufe schmerzlich neu erlernt werden muss. Für diese skeptische Einstellung hat Flake in seinem Stendhal-Essay einen schönen Begriff gefunden: einen „Unoptimisten” nennt er diesen – und zeichnet so auch ein Selbstbildnis, als jemand, der zwar kein Pessimist ist, aber doch nichts für einfach hält. Solche kühle Melancholie wird umfangen von der Ruhe tröstender Natur: „Über der Wasserlandschaft ging der Mond auf, es fehlte ihm nur ein Federstrich zur vollen Rundung. Vertraulich, ohne auf Abstand bedacht zu sein, kam er hinter den Wäldern herauf; man hätte ihn zurechtrücken mögen, er war ja viel zu groß.”
Flakes Hortense-Roman feiert die Freiheit der Frau und den Reichtum der europäischen Gesellschaft; er verwebt Geschichte in eine Nervenprosa eigenster Art. Am Ende, beim Zuschlagen, fragt man sich betroffen: Warum hat man uns von diesem Autor nie etwas erzählt? Vor vierzig Jahren ist Otto Flake gestorben. Sein Werk wartet auf seine Wiederauferstehung.
GUSTAV SEIBT
OTTO FLAKE: Hortense oder Die Rückkehr nach Baden-Baden. Roman. Nachwort von Gert Ueding. Manesse Verlag, Zürich 2003. 509 Seiten, 24,90 Euro.
Die Wandelhalle im Kurhaus Baden-Baden im Jahre 1909
Foto: SZ-Archiv
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de