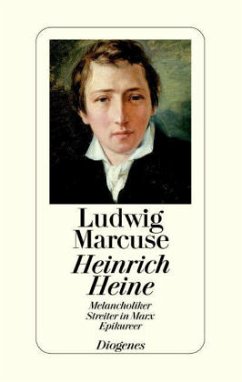Zwischen Matratzengruft und Makulatur: Neue und nicht ganz so neue Bücher zum Heine-Jahr
Wenn ein angesehener Philologe wie Joseph A. Kruse, der Direktor des Düsseldorfer Heinrich-Heine-Instituts, seinen Lesern versichert, es gäbe „Bildbeweise” dafür, dass Marilyn Monroe ihren Heine „auch tatsächlich las”, dann wollen wir ihm das glauben. Alle Zweifel, wonach der Fotograf auch einen trivialen Schmöker in einen fremden Buchumschlag hätte packen können, stellen wir da zurück: Denn zu schön ist die Aufnahme, auf der die Monroe zu sehen ist, wie sie, halb ausgestreckt auf einem Schlafsofa in nachdenklicher Haltung und mit verträumter Miene in die Lektüre einer amerikanischen Heine-Ausgabe vertieft ist, obgleich der Abstand zwischen ihren Augen und dem geöffneten Buch dafür eigentlich etwas zu groß ist.
Als Dokument zu Heines Wirkungsgeschichte ist das Foto in einem in der Kompaktreihe „BasisBiographien” des Suhrkamp Verlags erschienenen Bändchen enthalten. Es gibt auch Auskünfte über Gedächtnisfeiern und Gedenkjahre, ohne die, wie Kruse schreibt, „die Wogen der Rezeptionsgeschichte offenbar gerade in der jüngsten Vergangenheit überhaupt nicht mehr zu steuern sind”. Fragt sich nur, wer hier wen wohin steuert: Nicht annähernd so glaubwürdig und dezent wie die Haltung, die die Monroe gegenüber Heine einnahm, ist die Papierwut eines sich immer fieberhafter von runden Geburtsjahren zu runden Todesjahren fressenden Buchmarkts - von Adorno zu Schiller und Thomas Mann, von Mozart zu Heine, von Sigmund Freud zu Hannah Arendt und so fort.
Alles, alles wird zu Ende geführt
An der „Umschlaggeschwindigkeit” - wie der Branchenbegriff für die stetig kürzer werdenden Wege von der Druckerpresse zur Makulatur heißt - der großen Masse der Bücher von und über Heine gemessen, war dem Dichter auf dem Buchmarkt ohnehin nur eine Halbwertszeit von neun Jahren beschieden, seit dem letzten Heine-Jahr von 1997, als man den 200. Geburtstag feierte. Im Vergleich zu anderen großen Editionsprojekten war es damals ein kleines Wunder, dass die Düsseldorfer Kritische Gesamtausgabe seiner Werke nach nur 33 Jahren Querelen erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Ihr Herausgeber Manfred Windfuhr gedenkt dieser Tat mit einem Erfahrungsbericht und erinnert an eine Heinesche Prophezeiung aus dem Jahr 1832, die nur in ihrem zweiten Teil ganz in Erfüllung ging: „Ueber lang oder kurz wird in Deutschland die Revolution beginnen, sie ist da in der Idee, und die Deutschen haben nie eine Idee aufgegeben, nicht einmal eine Lesart; in diesem Land der Gründlichkeit wird Alles, und daure es noch solange, zu Ende geführt.”
In diesem Jahr steht zu befürchten, dass die Deutschen ihren Heine so lieb gewonnen haben, dass von seinem Stachel bald nichts mehr übrig bleiben wird. Die Bücher zum Heine-Jahr sind fast durchweg Biedermeier. Genau genommen ist das Heine-Jahr für die Verlage auch schon vorüber, denn sämtliche Neuerscheinungen wurden bereits im vergangenen Herbst ausgeliefert. Seitdem jeder Verlag vor dem anderen da sein will, kommen alle auf einmal, nur immer früher. Heines 150. Todestag steht bereits für das Verfallsdatum dieser Produktion. Danach wird Kasse gemacht und darf verramscht werden.
Man darf sich nur von den Klappentexten der Bücher nicht irre machen lassen: Wenn die verdienstvolle Biographie von Jan-Christoph Hauschild und Michael Werner beispielsweise mit dem Zitat aus einer deutschen Wochenzeitung „Die nützlichste Frucht dieses nützlichen Heine-Jahres” angepriesen wird, so ist damit nicht das Jahr 2006, sondern war das Jahr 1997 gemeint: Der Verlag hat das Buch als Lizenzausgabe nachgedruckt, doch um dies herauszufinden, müssen ahnungslose Leser das Kleingedruckte im Impressum studieren.
Merkwürdigerweise sieht die bei Propyläen tatsächlich neu erschienene Heine-Biographie der Berliner Journalistin Kerstin Decker dem Band von Hauschild und Werner nicht nur zum Verwechseln ähnlich - nur schweift Heines verträumter Blick vom gleichen Porträt auf dem einen Buch nach links, auf dem anderen nach rechts -, sondern ist mit dieser auch auf Euro und Cent preisidentisch. Dafür schlägt die Autorin einen kurzatmigen, ziemlich frechen Ton an, über den man sich anfangs freut: Hoppla, endlich lockert da jemand der Sprache das Korsett, so wie Heine es uns vormachte. Doch schon bald dümpelt der Erzählgestus der Autorin, die aus Heines Biographie einen Schelmenroman macht, allzu einsilbig vor sich hin.
Wo Dichter gefeiert werden, ist Jörg Aufenanger nicht weit: Bei Grabbes 200. Geburtstag war er dabei, gleich zwei Bücher schrieb er zum Schillerjahr, und Heine begleitet er nach Paris, in die „Hauptstadt der Liebe”. Auch wenn ihm dort nicht viel Neues einfällt, schreibt er als ein charmanter Parleur, der sich die geistige Erbauung reiferer Damen zur Aufgabe gemacht hat. Apropos Damen, die kommen - Mozart hat es vorgemacht - auch im Heine-Jahr nicht zu kurz: Die Germanistin Edda Ziegler reitet ein Steckenpferd aller Heine-Biographen, das große „M” im Leben und Werk des Dichters, „M wie Mutter, Mausel, Mére, Maman; M wie Molly... wie Mathilde... wie Mouche...”. Mit solchen M-Namen hatte Heine seit seiner unglücklichen Jugendliebe, die einer von ihm selbst poetisierten Legende zufolge der Urgrund auch aller künftigen Liebesleiden war, beinahe alle Frauen bedacht, die eine wichtige Rolle in seinem Leben oder in seinem Werk spielten. Am Ende hat er vielleicht sogar Marilyn Monroe erfunden. Edda Ziegler führt die ganze Galerie auf ein ödipales Mutterdrama zurück. Doch erfahren wir tatsächlich etwas über Heine und die tieferen Gründe seiner Traurigkeit, der wir doch die schönste Poesie verdanken, wenn der Befund über den Dichter lautet: „Frau und Sphinx verschmelzen zu einem Wesen, dessen Charakter rätselhaft bleibt”? Dann soll es doch, bitteschön, auch rätselhaft bleiben, Hauptsache erotisch.
Vielleicht hat Edda Ziegler aber auch nur die tieferen Gründe von Heines Humor, Ironie und Spottlust unterschätzt. Wäre es nicht auch denkbar, dass Heine das so deutsche „W” wie „Weh”, „Werther” oder„Wetzlar” vom schwermütigen Kopf auf zarte und mollige Füßchen stellen wollte - „M” wie „Mignon”, „Madeleine” oder „Marzipan”. Um der „Zudringlichkeit eines müßigen Publikums” zu begegnen, hatte Heine noch auf dem Sterbebett begonnen, seiner letzten großen Liebe, genannt „Mouche”, seine Memoiren als „das Märchen meines Lebens” zu diktieren. Mit hübschen Illustrationen von Volker Kriegel, der nun leider auch nicht mehr unter den Lebenden ist, hat der Eichborn Verlag dieses Kleinod herausgebracht. Wenn man es liest, möchte man alle Heine-Philologie für eine Weile vergessen und darüber hinaus zur schönsten aller Heine-Biographien greifen, die einem die Lust, Heine zu lesen, auch weder ersetzen noch vergällen will: Der deutsche Jude Ludwig Marcuse hat sie 1932, ein Jahr vor seiner Flucht, verfasst. In Marcuses Überarbeitung der Nachkriegszeit erschien die letzte Auflage 1980 im Diogenes Verlag. Sie ist noch immer lieferbar, und im Heine-Jahr hat der Verlag auch kein „aktualisiertes” Impressum vorgetäuscht. Dafür hält man ein Buch in der Hand, das auch ein haptisches Vergnügen bietet, anders als die meisten Produktionen unserer Tage.
Der Weg zur weißen Insel
Das einzige Buch dieser Saison, darin von Heine tatsächlich noch etwas nachglüht, stammt von dem deutsch-israelischen Literaturwissenschaftler Jakob Hessing, der es zeitgleich in seiner früheren und seiner neuen Heimat erscheinen ließ. Seine akribische Studie über die Verwandtschaft von Traum- und Todesmotiven in Heines Werk - die in einem kleinen ostfriesischen Verlag erschienene, schön illustrierte Legende von der „Überfahrt zur Weißen Insel” liefert ihrerseits Anschauungsmaterial - artikuliert ein deutliches Unbehagen gegenüber einer biographisch orientierten Heineforschung. In zwei Sprachen geschrieben und im Hinblick auf den zweifachen Adressatenkreis als ein doppeltes Experiment an „Heines gespaltener Identität” als Deutscher und als Jude riskiert, beharrt Hessings Buch auf der Unlösbarkeit wie Unerlöstheit solchen Auseinanderklaffens. Obwohl es nicht ganz leicht lesbar ist, möchte man ihm viele Leser wünschen, sei es auch nur der bloßen Irritation wegen - und um Heines andauernder Verharmlosung zu begegnen. Der Dichter meinte es nämlich ernst, mit allem Spaß, allem Spott, aller Ironie - und auch, wenn er am Ende eines Briefes schrieb: „Das Papier geht zu Ende und ich kann Ihnen nur noch sagen, daß ich Sie liebe.” VOLKER BREIDECKER
JOSEPH A. KRUSE: Heinrich Heine. Leben - Werk - Wirkung. Suhrkamp Verlag, Frankfurt 2005. 160 Seiten, 7,90 Euro.
MANFRED WINDFUHR: Die Düsseldorfer Heine-Ausgabe. Ein Erfahrungsbericht. Grupello Verlag, Düsseldorf 2005. 101 S., 14,90 Euro.
JAN-CHRISTOPH HAUSCHILD / MICHAEL WERNER: „Der Zweck des Lebens ist das Leben selbst.” Heinrich Heine - eine Biographie. Zweitausendeins Verlag, Frankfurt 2005. 763 S., 22 Euro.
KERSTIN DECKER: Heinrich Heine - Narr des Glücks. Biographie. Propyläen Verlag, Berlin 2005, 448 S., 22 Euro.
JÖRG AUFENANGER: Heinrich Heine in Paris. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2005. 159 S. , 12 Euro.
EDDA ZIEGLER: Heinrich Heine. Der Dichter und die Frauen. Artemis & Winkler Verlag, München 2005. 207 S., 19,90 Euro.
HEINRICH HEINE: Memoiren. Illustriert von Volker Kriegel. Eichborn Berlin Verlag, Frankfurt 2005. 87 S., 14,90 Euro.
LUDWIG MARCUSE: Heinrich Heine. Melancholiker - Streiter in Marx - Epikureer. Diogenes Verlag, Zürich 1980. 366 S., 24,90 Euro.
JAKOB HESSING: Der Traum und der Tod. Heinrich Heines Poetik des Scheiterns. Wallstein Verlag, Göttingen 2005. 294 S., 29,90 Euro.
HEINRICH HEINE UND ANDERE: Die Überfahrt zur Weißen Insel. Illustriert von Jochen Stücke. Schuster Verlag, Leer 2003. 84 S., 19,90 Euro.
HEINRICH HEINE: „...und grüßen Sie mir die Welt”. Ein Leben in Briefen, herausgegeben von Bernd Füllner und Christian Liedtke. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2005, 559 S., 25 Euro.
„Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, ich kenn auch die Herren Verfasser”: Heine kämpft mit der Feder gegen die Reaktion. Titelblatt der Zeitschrift „Jugend” von 1906.
Foto: akg-images
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

Heine und ein Ende: Eine Übersicht über neuere Bücher
Die Heine-Philologie erhielt 1997, zum zweihundertsten Geburtstag, einen mächtigen Schub. Wie steht es damit beim neuen Jubiläum, dem hundertfünfzigsten Todestag? Der Ertrag ist geringer. Die umfassende Biographie aus dem Jahr 1997 von Jan-Christoph Hauschild und Michael Werner ist von Kiepenheuer & Witsch zu Zweitausendeins gewandert und im Text unverändert geblieben, aber mit fünfzig Abbildungen versehen worden. Was damals gesagt wurde, kann wiederholt werden: "Diese fundierte Biographie wird wohl fürs erste nicht zu überbieten sein" (F.A.Z. vom 9. Dezember 1997). Worin allerdings die "Aktualisierung" bestehen soll, die der Verlag verspricht, bleibt unerfindlich.
Der Diogenes Verlag legt Ludwig Marcuses erstmals 1932 erschienene, 1951 von den Exilerfahrungen her ergänzte und 1970 noch einmal erweiterte Darstellung "Heinrich Heine. Melancholiker, Streiter in Marx, Epikureer" wieder vor. Auch bei erneuter Lektüre erscheint das Buch nicht veraltet. Die teils erzählende, teils analytische Verfahrensweise gibt der Gestalt Heines, seinen geistigen Kämpfen und seiner dichterischen Individualität vor dem Hintergrund der politischen, der Sozial- und Wirtschafts-, auch der Alltagsgeschichte klares Profil. Immer erkennbar bleibt das Modell vom "großen romantischen Aufklärer". Glücklich verbunden sind wissenschaftlicher und schriftstellerischer Stil.
Weit entfernt davon ist die Biographie "Heinrich Heine. Narr des Glücks" von Kerstin Decker, die in die Falle Heinescher Ironie und Heineschen Witzes läuft, die sie beide noch übertrumpfen zu können glaubt. Die promovierte Philosophin versucht krampfhaft, unter ihr Niveau zu gehen. Gewiß, sie hat sich gründlich kundig gemacht und sucht Nähe zum Gegenstand mit vielen Zitaten aus den Werken und Briefen. Aber ihr Hauptinteresse gilt den knalligen, delikaten Situationen. Sie gefällt sich in Flapsigkeit. Eine Blütenlese aus Kapitelüberschriften: "Der Achtzehnjährige entscheidet sich für den Beruf des Millionärs, fährt nach Hamburg und geht pleite", "Künftiger Advokat hat eine Wasserseele und schreibt Wellenstrophen", "Als Liberalenhäuptling in Bayern", "Er legt sich ins Bett, steht nie wieder auf, spekuliert an der Börse und beschwert sich bei Gott". Hier wird Gegenwartsnähe durch Schnoddrigkeit vorgetäuscht (Heine "als Spezialist für Kleinstkinderheilkunde"), hier wird Heine hergerichtet für unsere Spaßgesellschaft. Munter purzeln die Sensationshistörchen.
Da ist Jakob Hessings Untersuchung "Der Traum und der Tod. Heinrich Heines Poetik des Scheiterns" aus einem anderen Holz. Der Professor an der Hebräischen Universität in Jerusalem, den Lesern dieser Zeitung durch seine sachkundigen Rezensionen jüdischer Literatur bekannt, hat sein Buch für zwei Leserkreise konzipiert. Da Heine für lange Zeit nicht nur unter Deutschen, sondern auch unter traditionsgebundenen Juden umstritten war, übernimmt das Buch Aufgaben einer Einführung mit. Hessing liest die Texte zunächst in einem deutschen und dann in einem jüdischen "Kontext" und kommt zu dem Schluß, daß die Lücke zwischen den "beiden Hälften der deutsch-jüdischen Existenz Heines" nicht zu schließen ist und daß Heine erst in den letzten Lebensjahren seine jüdische Identität vollends "aus der Verdrängung" holt.
Hessings Essayband "Der Fluch des Propheten" (1989) faßte "drei Abhandlungen zu Sigmund Freud" zusammen. Von einem gemäßigten psychoanalytischen Ansatz her verstehen sich auch die Kopplung der Begriffe "Traum" und "Tod" und die Deutung der Texte als Projektionen des Ich, als Heines "Verwandlung" seines eigenen Lebens in Dichtung. Totenbilder in Heines Werk seien tief mit seinem jüdischen Selbstverständnis verknüpft; immer wieder versuche er eine Erlösung zu erträumen, und immer wieder neu müsse er dabei scheitern. Seine melancholische Tiefe gewinne Heines Werk aus solcher Enttäuschung. Am Ende bedauert man, daß der Autor zwei bedeutende Versuche einer Zusammenschau der religiösen Perspektiven in Heines Werk nicht mehr zur Kenntnis hat nehmen können - Karl-Josef Kuschel: "Gottes grausamer Spaß? Heinrich Heines Leben mit der Katastrophe" (2002); Christoph Bartscherer: "Heinrich Heines religiöse Revolte" (2005).
Was immer auch Heine von Goethe trennte - in einem war er Goetheaner: in der Wahl seiner Ehepartnerin. Seine französische Frau, die er Mathilde nannte, verstand nicht eine einzige Zeile seiner deutschen Gedichte. Gewiß, er schätzte die Freundschaft gebildeter oder schöner Frauen wie Rahel Varnhagen, George Sand oder der Principessa di Belgiojoso, aber das berührte nicht die sinnliche Anziehungskraft Mathildes. Sie war ihm das, was Christiane für Goethe war. Dieser Anhänglichkeit konnte auch die "letzte Blume" seines "larmoyanten Lebens" in den letzten Monaten, Elise Krinitz, die er seine "Mouche" nannte, nichts anhaben.
Ganz unaufgeregt geht Edda Ziegler, Autorin einer illustrierten Heine-Biographie in dritter Auflage, das Thema "Der Dichter und die Frauen" an. Ihre Untersuchung, fundiert und gut lesbar, entwirft die Beziehungsmodelle: das rührende Verhältnis zur Mutter oder das leidenschaftliche zum "Hausvesuv" Mathilde, die Rolle der "Salonièren und Gönnerinnen" in Berlin und Hamburg oder die Tändeleien mit den Pariser Grisetten und die kultivierten Freundschaften im "Foyer der europäischen Gesellschaft". Den Band beschließt eine Typologie der "Kunstfiguren" in Heines Werk, etwa des naiven Mädchens (auch der frommen Naiven), der femme fatale oder der Sphinxfrau, der sinnenfrohen Hellenin oder der Grisetten und, am Ende des Lebens, der Allegorien "Frau Sorge" und "Schwarze Frau".
Der Band zu Heine in der "Suhrkamp Basis-Biographie" ist Joseph Anton Kruse anvertraut worden, dessen schnörkelloser Stil sich schon früher in einem Insel-Taschenbuch bewährt hatte. Die Einleitung stellt Heine als "Grenzgänger der Moderne" vor. In drei Kapiteln skizziert Kruse, ein breites Wissen auf den Punkt bringend, Leben, Werk und Wirkung Heines. Als Einführung zu empfehlen! Otto A. Böhmer erzählt das Leben Heines, indem er es mit seitenfüllenden Zitaten von Gedichten und Prosatexten durch Heine selbst erzählen läßt: für ein breites Lesepublikum, das im Jubiläumsjahr auf Heine neugierig geworden ist.
Als Dauerzweikampf zieht sich durch das Leben Heines sein Verhältnis zum Hamburger Verleger Julius Campe, ein freundschaftliches Duell, das manchmal ernst zu werden drohte, aber auf jeden Fall mit dem Florett ausgefochten wurde. Eine Auswahl aus dem Briefwechsel beider, versehen mit einem geschliffenen Vorwort, haben Gerhard Höhn und Christian Liedtke herausgegeben. An witziger Schlagfertigkeit zeigt sich der Verleger oft seinem Autor durchaus gewachsen. Der Leser erlebt die Geburt eines Dioskurenpaares: des modernen Schriftstellers und des modernen Verlegers. Den Band hat der Hoffmann und Campe Verlag als "Freundesgabe" herausgebracht, man wünschte ihm aber eine weitere Verbreitung.
Eine kleine Guckkastenbühne, auf der das Schauspiel der Familien- und Freundesbeziehungen Heines gespielt wird, öffnet sich in der Auswahl von 199 (aus insgesamt etwa 1800) Briefen Heines, die Bernd Füllner und Christian Liedtke getroffen haben. Wie seine Lyrik sind Heines Briefe meistens "Thermometer" seiner "Gemütsstimmung", manchmal auch im "Negligee-Gewand" geschriebene Prosa, oft Ventil für Konfessionen. Schon früh schließt der Mollton der Melancholie Zwischenrufe der Ironie nicht aus. Insgeheim entwerfen die Briefe ein Bild des Partners mit. (Eine Fundgrube ist das "Personenlexikon" des Bandes.) Zu den bitter-anklägerischen Zeugnissen des Familienstreits um das Erbe des Hamburger Onkels in Gegensatz stehen die zärtlichen Briefe an die "liebe gute Pracht-Mutter" und die intimen an Mathilde, die er während des Hamburg-Aufenthaltes im November 1843 gern mit ihrem "dicken Popo (gros derrière) herumwirbeln" gesehen hätte. So entsteht vor den Augen des Publikums farbig "ein Leben in Briefen". Der letzte Brief, aus dem Februar 1856, gerichtet an Alexander von Humboldt, ist auch der kürzeste: "Dem großen Alexandros sendet seinen letzten Gruß der sterbende H. Heine."
WALTER HINCK
Jan-Christoph Hauschild/Michael Werner: "Heinrich Heine". Aktualisierte und um einen Bildteil erweiterte Neuausgabe. Zweitausendeins Verlag, Frankfurt am Main 2005. 763 S., geb., 22,- [Euro].
Ludwig Marcuse: "Heinrich Heine. Melancholiker, Streiter in Marx, Epikureer". Diogenes Verlag, Zürich 2005. 368 S., geb., 24,90 [Euro].
Kerstin Decker: "Heinrich Heine. Narr des Glücks". Biographie. Propyläen Verlag, Berlin 2005. 448 S., geb., 22,- [Euro].
Jakob Hessing: "Der Traum und der Tod. Heinrich Heines Poetik des Scheiterns". Wallstein Verlag, Göttingen 2005. 294 S., geb., 29,90 [Euro].
Edda Ziegler: "Heinrich Heine. Der Dichter und die Frauen". Artemis & Winkler Verlag, Düsseldorf/Zürich 2005. 207 S., geb., 19,90 [Euro].
Joseph Anton Kruse: "Heinrich Heine". Suhrkamp BasisBiographie 7, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2005. 160 S., br., 7,90 [Euro].
Otto A. Böhmer: "Heinrich Heine. Sein Leben erzählt". Diogenes Verlag, Zürich 2005. 171 S., br., 8,90 [Euro].
Gerhard Höhn/Christian Liedtke (Herausgeber): "Der Weg von Ihrem Herzen zu Ihrer Tasche ist sehr weit". Aus dem Briefwechsel zwischen Heinrich Heine und seinem Verleger Julius Campe. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2005. 127 S., br., Freundesgabe des Verlags.
Heinrich Heine: ". ..und grüßen Sie mir die Welt". Ein Leben in Briefen. Herausgegeben von Bernd Füllner und Christian Liedtke. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2005. 559 S., geb., 25,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main