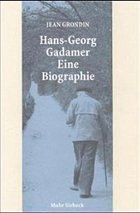"Daß der philosophisch Interessierte ein aufwendig recherchiertes und ... im Detail verläßliches Werk vor sich hat, attestiert man gern, wobei die Benutzerfreundlichkeit unter anderem durch die ausführliche Chronik im Anhang gewährleistet ist. ... der Verfasser [stellt] sein sicheres Gespür für das Eigenartige und Markante sowie die ungewöhnliche Rhythmik des nachgezeichneten Lebens unter Beweis."
Ulrich Horstmann in Süddeutsche Zeitung vom 19./20.6.1999, S. V
"Die gründliche Gadamer-Biographie von Jean Grondin ist im wesentlichen frei von hagiographischen Zügen. Um so überzeugender entwirft sie das Porträt eines zunächst zögernden und unsicheren, eines unpolitischen und anpassungsfähigen, aber stets liberalen und selbstkritischen, vom gutbürgerlichen Elternhaus mit Klugheit, Sensibilität und sicherem Blick ausgestatteten, humanistisch gebildeten und unabhängig urteilenden Geistes."
Jürgen Habermas in Neue Zürcher Zeitung vom 12./13.2.2000, S. 49
Ulrich Horstmann in Süddeutsche Zeitung vom 19./20.6.1999, S. V
"Die gründliche Gadamer-Biographie von Jean Grondin ist im wesentlichen frei von hagiographischen Zügen. Um so überzeugender entwirft sie das Porträt eines zunächst zögernden und unsicheren, eines unpolitischen und anpassungsfähigen, aber stets liberalen und selbstkritischen, vom gutbürgerlichen Elternhaus mit Klugheit, Sensibilität und sicherem Blick ausgestatteten, humanistisch gebildeten und unabhängig urteilenden Geistes."
Jürgen Habermas in Neue Zürcher Zeitung vom 12./13.2.2000, S. 49

Der Tag des Marburger Stammtischs ist fern: Gadamers Kampf mit Heidegger / Von Henning Ritter
Es gibt einen philosophischen Vorbehalt gegen Biographien. Seine nachdrücklichste Formulierung stammt von Martin Heidegger, der 1924 in einer Vorlesung gesagt hat: "Bei der Persönlichkeit eines Philosophen hat nur das Interesse: er war dann und dann geboren, er arbeitete und starb." Es war also nicht wichtig, daß Aristoteles der Erzieher Alexanders war oder Descartes Soldat, als ihm die Idee der Methode aufging; vielmehr sollte nur die Tatsache der Endlichkeit des Lebens ausgesprochen und bedacht werden. So können nur junge Genies befinden. Ein solches war Heidegger gewiß, wie seine lange, immer noch nicht erschöpfte Nachwirkung belegt.
George Steiner hat unlängst darauf hingewiesen, daß Heidegger, gemessen an der Fülle der ihm gewidmeten Untersuchungen und Deutungen, längst in die Reihe der Großen der Philosophiegeschichte, an die Seite von Aristoteles, Descartes, Kant, aufgerückt sei. Während aber deren Lebensgeschichte im allgemeinen Bewußtsein kaum mehr als oberflächlich bekannt ist, wurde die Biographie Heideggers zu einem wahren Schlachtfeld, auf dem manche die Entscheidung über den Sinn seiner Philosophie suchen. Sogar das Leben seiner Schüler der ersten Stunde wird in den Sog der Fragen hineingezogen, die durch die Zeit des kurzfristigen nationalsozialistischen Engagements ihres Lehrers aufgeworfen werden.
Wenn jetzt eine vierhundert Seiten starke Biographie von Hans-Georg Gadamer erscheint, so ist diese Tatsache wohl zunächst im Zuammenhang der durch Martin Heidegger ungewollt angestifteten philosophischen Biographik zu sehen. Drei Kapitel der Biographie von Jean Grondin (Jahrgang 1955), mehr als 120 Seiten, gehen der Frage nach, wie sich Gadamer in den Jahren nach 1933 und unmittelbar nach 1945 als Rektor der Leipziger Universität verhalten hat. In letzterem Fall ist eine Antwort nicht schwer. Wacker, wenn auch am Ende erfolglos, hat Gadamer damals um die Erhaltung der Universität gekämpft und sich, nach eigenem Bekunden, am ehesten noch mit der sowjetischen Militärbehörde verständigen können. Hilfreich für diese Episode war gewiß, daß Gadamer die Erfahrungen aus einem anderen totalitären Regime mitbrachte und daß das neue Regime zumindest rhetorisch an den "Humanismus" zu appellieren erlaubte, auch wenn dies auf einem Mißverständnis beruhte.
Schwieriger ist die Antwort für die Jahre zwischen 1933 und 1945. Der im Jahre 1900 in Breslau geborene, aus einem nationalliberalen Elternhaus stammende Philosoph teilte mit vielen, ja den meisten seiner akademischen Generationsgenossen die Unterschätzung jener Bewegung, die sie in den zwanziger Jahren bedrohlich anwachsen sahen und die auf eine verhängnisvolle Weise radikale Impulse aus dem Erlebnis des Ersten Weltkriegs und seiner Folgen zu bündeln und in eine politische Richtung zu wenden verstand. Man könnte am Beispiel des jungen Philosophen Gadamer die Geschichte eines unpolitischen Menschen im Deutschland jener Jahre schreiben. Grondin sagt darüber das Nötige. Es zeigt sich, daß die Entscheidung dazubleiben, unausweichlich eine Kette politischer Verwicklungen mit dem Regime nach sich zog. Wer, wie Gadamer, seine Karriere an der Universität nicht opfern wollte, wurde zu Stellungnahmen genötigt oder verführt, die bedrückend bleiben.
Diese Teile von Grondins Biographie hätten nicht so ausführlich ausfallen müssen, wenn Gadamer in den vergangenen Jahren nicht mit Fragen über sein Verhältnis zum Nationalsozialismus konfrontiert worden wäre, denen er sich mit Geduld gestellt hat. Das Ergebnis der Bemühungen von Jean Grondin, der sich um eine gut dokumentierte und faire Beurteilung bemüht, führt allerdings nicht über die Äußerung von Karl Löwith hinaus, Gadamer habe sich keine "politischen Verdienste" im Sinne der Nazis erworben. Grondin berichtet auch, daß beide Heideggerschüler 1933 der Nachricht nicht Glauben schenken wollten, daß ihr Lehrer sich bei den Nazis engagierte. Gadamer nahm die Verbindung zu Heidegger erst wieder auf, nachdem bei diesem eine Ernüchterung eingetreten war. 1937 fuhren einige der in Deutschland gebliebenen Heideggerschüler zu einem Besuch in den Schwarzwald, Briefe wurden zwischen Gadamer und Heidegger erst 1944 wieder gewechselt.
Ein Blick in das Verzeichnis der Vorlesungen und Seminare, die Gadamer in jenen Jahren hielt, zeigt, wie fern er der politischen Aktualität stand. Man würde sich aber täuschen, wollte man dies nur als einen Rückzug von politisch besetzbaren Themen halten. Der Traditionalismus, den Gadamer gelegentlich mit der hochfahrenden Bemerkung unterstrich, er lese grundsätzlich nur Bücher, die mehr als zweitausend Jahre alt seien, hat nur in zweiter Linie mit dem geistigen Überleben zwischen 1933 und 1945 zu tun, sondern ist in dem eigentümlichen Lehrer-Schüler-Verhältnis angelegt, das Gadamer mit seinem Lehrer Martin Heidegger verband.
Diese Geschichte muß der Kern einer Gadamerbiographie sein. Als der dreiundzwanzigjährige bereits (bei Richard Hönigswald) promovierte und gerade von einer Kinderlähmung genesende Philosoph das Manuskript eines jungen Freiburger Privatdozenten las, das dieser unter dem Titel "Anzeige der hermeneutischen Situation" für Paul Natorp in Marburg verfaßt hatte, war ihm nach eigenem Bekunden sofort deutlich, daß er seinen Lehrer gefunden hatte. Gadamer fing noch einmal von vorne an, ging nach Freiburg, um bei Heidegger zu hören, folgte ihm, als er nach Marburg berufen wurde, als Mitglied des engsten Schülerkreises nach und war doch alles andere als seines Weges sicher.
"Sein Lehrer, der eine magische Wirkung auf seine Schüler ausübte - Hannah Arendt hat ihn als "heimlichen König" tituliert setzte ihn einem Wechselbad von Anerkennung und Geringschätzung aus. Grondin zitiert manches Beispiel dafür, etwa aus einem Brief von Heidegger an Karl Löwith: "Ursprünglich Hönigswald-Natorp-, jetzt begeisterter Hartmannanhänger - in diesem Semester bei mir angeschlossen - sein Vater Ordinarius in Marburg - er will sich bei Hartmann habilitieren - dazu über Aristoteles arbeiten - vorläufig sehe ich gar nichts Positives bei ihm. Redet Begriffe und Sätze nach - ist aber genau so hilflos wie sein ,Meister'." Unübersehbar sind die Züge eines antibürgerlichen Affekts, der den Radikalismus Heideggers trug und sicherlich ein latent politischer Zug seiner philosophischen Wirkung in einer Situation allgemeiner Auflösung war. Gadamer reagierte auf solche Vorbehalte des von ihm maßlos bewunderten Lehrers, indem er das Studium der Klassischen Philologie aufnahm. Erst als er sich in diesem Fach habilitieren will, fordert Heidegger ihn zu seiner großen Überraschung auf, es bei ihm zu tun. Doch den in Zurückweisung und Selbstzweifel begonnenen Weg ist Gadamer unbeirrt weitergegangen.
Von seiner Habilitationsschrift über "Platos dialektische Ethik" (1928) bis zu seiner Abhandlung über die "Idee des Guten" von 1978 läßt sich in seinen Schriften die Linie eines anhaltenden philologischen und philosophischen Gesprächs mit der Philosophie der Griechen, mit Platon und Aristoteles, ziehen - Ausdruck einer Option für die "Alten" als die immer lebendigsten Gesprächspartner. Während Heidegger durch seine bahnbrechenden Aristoteles-Interpretationen den Weg in gewaltsamer Zurückweisung der Philologie freigemacht hatte, beschritt ihn sein Schüler auf seine eigene moderate Weise, konsequent und ohne Polemik gegen den Lehrer. Man tut ihm wohl nicht unrecht, wenn man diesen Weg als ein Umleiten der explosiven Impulse des Anfangs in akademische Bahnen bezeichnet. Über sein Verhältnis zu Heidegger hat Gadamer später berichtet, es habe Leute gegeben, die mit Heidegger gut reden konnten, aber zu ihnen habe er nicht gehört; er habe nur von ihm lernen können. Man darf ergänzen, daß er das Gelernte in den Dienst eines vielleicht verwandten, aber im Ergebnis doch anderen Verständnisses gestellt hat.
Es ist das eigentliche Lebenswerk von Gadamer, dieses vielschichtige Verhältnis zu Heidegger durch die Zeit hindurch festgehalten und entwickelt zu haben. Dazu gehören auch später noch fühlbare Hemmungen: Erst mit sechzig Jahren, als seine akademische Laufbahn fast schon zuende schien, hat Gadamer sein Buch "Wahrheit und Methode" veröffentlicht, auf das Heidegger nur zögernd reagierte. Und erst nach Heideggers Tod hat Gadamer weitläufiger über ihn zu schreiben begonnen. Der Schatten des Lehrers muß groß gewesen sein, Grondin schildert eine Szene, die nicht ohne Komik ist. Als Heidegger 1969 zu Gadamers Abschiedsvorlesung nach Heidelberg kommt, spricht dieser über "Hegel und Heidegger", während jener in einer kleinen Ansprache Fühlung mit dem linken Zeitgeist sucht, indem er auf die Feuerbach-These von Marx eingeht und sie mit der Bemerkung glossiert, man müsse die Welt ja erst einmal interpretieren, um sie zu verändern.
Bis zu Heideggers Tod und darüber hinaus meint man einem Ringen zwischen Lehrer und Schüler beizuwohnen. Jean Grondin zeichnet diesen Weg nach, ohne freilich der Dramatik des Geschehens gerecht zu werden. Er gibt eine lesbare und in vielen Details zum ersten Mal gut dokumentierte Schilderung der deutschen philosophischen Verhältnisse, soweit sie im Einzugsbereich der Biographie Gadamers darzustellen waren. Aber die tief ins Persönliche reichenden Wirkungen der scheinbar auf die Sache bezogenen Auseinandersetzungen werden nicht plastisch genug, um das tragische und auch tragikomische Geschick der antiakademischen und zugleich akademischen deutschen Philosophie des Jahrhunderts fühlbar zu machen.
Zieht man Gadamers eigene, 1977 erschienene Darstellung "Philosophische Lehrjahre" heran, die sich auf einige Episoden des eigenen Lebensweges, vor allem die frühen Marburger Jahre, beschränkte, so wird der Grund des Ungenügens deutlich. Gadamer hatte unter dem für ein Autobiographicum befremdlichen Motto "De nobis ipsis silemus", "von uns selbst schweigen wir", einige eindrucksvolle Porträts von Lehrern und Freunden der frühen Jahre gegeben. Man ahnte, daß die Wahrheit über die Geniezeit des philosophischen und geisteswissenschaftlichen Aufbruchs nur durch solcherlei Charakterzeichnung zu gewinnen sein würde.
Bedauerlicherweise hat der Autor der großen Biographie die Konkurrenz mit seinem Helden gescheut und den Weg einer eher dokumentarischen Darstellung eingeschlagen: So ist es mehr Zeitgeschichte und geläufig geschriebene Philosophiegeschichte geworden als eine echte Biographie. Offenbar unter dem Einfluß der Nachforschungen über die Jahre zwischen 1933 und 1945 hat sich die biographische Schilderung einer aktenmäßigen Darstellung angenähert. Aus Besorgnis um unwidersprechliche Belege und Beweise nimmt das Belegbare überhand. Der spätgeborene Biograph klammert sich an das Unstrittige und scheut vor Wagnissen in der Charakterisierung von Personen zurück. Vom schildernden Wagemut lebt aber jede gute Biographie, sie darf sich nicht damit begnügen, bloß zeitgeschichtlichen und wissenschaftlichen Ansprüchen zu genügen.
Unübersehbar sind Grondins Respekt und Sympathie für den Porträtierten. Aber fast alles, was über die Hauptperson und die anderen Figuren gesagt wird, ist schon andernorts gesehen und gesagt worden. Das eine oder andere gelungene Porträt, wie etwa von Gadamers erstem Lehrer Richard Hönigswald, oder die Schilderung einer späten Episode, wie der Begegnung mit Jacques Derrida, ändern daran nichts. Der aus dem Angelsächsischen entlehnte Begriff der "intellektuellen Biographie" trägt mehr zur Verwirrung der Genres als zu einer Klärung bei. Leben und Werk - "Life and letters" , wie es ehedem hieß - parallel darzustellen, ist dann ein fruchtbares Unternehmen, wenn Nachlässe und Briefwechsel ausgiebig herangezogen werden können. Hierl geschieht dies vorzugsweise in Fußnoten und als Beleg.
Als Vorbild hat sich vielmehr die Zeitgeschichte durchgesetzt. Gewiß, es war reizvoll dieses nun nahezu hundertjährige Leben als ein Stück Philosophiegeschichte, eingebettet in die Zeit, zu schildern. Auch diese Möglichkeit gehört zu den fraglosen Triumphen Hans-Georg Gadamers: Seine philosophische Hermeneutik ist in den letzten Jahrzehnten zu einer Art Weltphilosophie geworden. Unter dem Titel "Verspätete Jugend" berichtet Grondin darüber, und hier gelingt es ihm auch, die menschlich beeindruckenden Züge des abgeklärten Improvisators hervortreten zu lassen, der im hohen Alter seine Zuhörer stark zu beeindrucken verstand.
Die Urszene dieses Lebens bleibt freilich jene Situation in den späten zwanziger Jahren, als sich um Martin Heidegger viele philosophische Begabungen von unterschiedlicher Prägung scharten, wie es dies seit den Zeiten des deutschen Idealismus nicht gegeben hatte. Eine Schilderung dieser Konstellation steht noch aus.
Jean Grondin: "Hans-Georg Gadamer". Eine Biographie. Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 1999. 437 S., Abb., geb., 98,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main