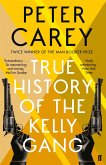Post- und strafkolonial: Richard Flanagans magischer Realismus
Blutende Herzen, eingepökelte Köpfe, menschenfressende Schweine; Kastration, Folter und Mord, und über allem die Miasmen von schwärendem Eiter, Exkrementen und Verwesung: Dieser Roman schwimmt in monströsen Greueln und gräßlichen Gerüchen. Um so ästhetischer ist er anzuschauen: Mehrfarbig gedruckt, mit je einem aquarellierten Fisch für jedes Kapitel, ist er Kleinod zartbunter Schönheit. Die Druckfarben - Blutrot, Seeigelpurpur, Kackbraun - erinnern freilich an die unerquicklichen Situationen und Substanzen, aus denen der Autor seine Tinten gewann, die Rochen, Koffer- und Drückerfische an den Ort seiner Verbannung: Sarah Island, die Gefängnisinsel vor der Küste Tasmaniens.
Hier, in seiner Todeszelle, malte der Mörder William Buelow Gould zu Beginn des 19. Jahrhunderts sein "Buch der Fische". Es gibt dieses Werk wirklich; Gould ist eine historische Figur. Aber Flanagans Roman ist so wenig ein Buch über Fische wie "Moby Dick" eines über den Wal. Es ist vielmehr ein großes Epos über die Geburt der australischen Nation aus dem Geist einer kafkaesken Strafkolonie, eine ehrgeizige Reflexion über Aufgaben und Grenzen postkolonialer Literatur und eine durchaus lebendige "Naturgeschichte des Toten".
Flanagan lebt in Tasmanien, dem Hinterwald Australiens, und hat in Oxford Geschichte studiert. Er weiß also, wovon er spricht, wenn er am Angelhaken einer Fischenzyklopädie dunkle Mythen und Wunder, schaurige Foltertechniken und phantastische Visionen aus dem stehenden Wasser der Vergangenheit fischt: von den Exzessen kolonialer Landnahme (und ihrer Verdrängung heute), vom Leiden der Zuchthäusler und Ureinwohner, denen sich alle farbenprächtigen Verheißungen der Aufklärung - Humanität, Fortschritt, Vernunft, Freiheit - zu schwarzweißen Karikaturen verzerrten.
Gould, der zur Kunst erpreßte Zuchthäusler und Opportunist aus Notwehr, sucht wie Voltaires Candide die beste aller Welten und findet ausgerechnet im Südseeparadies die Hölle: eine Insel, auf der Menschen im Namen von Wissenschaft, Recht und Handel klassifiziert, gefoltert und getötet werden, ein Naturgefängnis, halb Disneyland, halb KZ, in dem Gefangene und Schließer, Täter und Opfer in stumpfsinniger Symbiose leben. Wie in den Romanen von García Márquez brütet dieser üppige Dschungel Monster und Mißgeburten aus, absolutistische Patriarchen und skurrile Hofschranzen, Untertanen und Rebellen.
Der Kommandant, ein Diktator mit Visionen, will aus der Gefängnisinsel ein neues Venedig machen. Er erbaut Paläste, Bahnhöfe und Straßen; aber es gibt keine Züge und keine freien Bürger, nur Kettensträflinge und schwarze Sklaven, siamesische Huren und japanische Holzfäller, und so versinken die Wunderwerke der Zivilisation bald wieder in Schimmel und Vogelmist, "ein trauriger Haufen in Scheiße gehülltes Europa" und am Ende ein Raub der Flammen. Der utopische Versuch dieses Nero, aus einer Strafkolonie eine Handels- und Kulturnation zu machen, scheitert, und es bleibt seinem Archivar, einem dänischen Bibliothekar, vorbehalten, eine Geschichte voller Grausamkeit und Häßlichkeit in die Chronik einer Idealgesellschaft umzulügen.
Auch Gould, der im Auftrag des Gefängnisarztes Fische malt, muß erkennen, daß seine Kunst weder Privileg noch Mittel der Erkenntnis, sondern Strafe und Lüge war: "Koloniale Kunst ist die komische Fertigkeit, dem Neuen den Schein des Alten zu verleihen, dem Unbekannten den des Bekannten, dem Antipodischen den des Europäischen, dem Verächtlichen den des Respektablen." Alle sind Betrüger: Der große Diktator ist ein entflohener Sträfling, der wie ein Messias erwartete Befreier ein Phantom, der Künstler ein Hochstapler und Fälscher, der, statt "nach der Natur" zu malen, seine Fische als Karikaturen seiner Peiniger, Geliebten und Mithäftlinge anlegt; selbst der sinistre Herausgeber des Fischbuchs verkauft nebenbei gefälschte Antiquitäten an Touristen.
Es gehört zur Logik der Kunst und zur Tragödie des Malers, daß er seine Fische sterben lassen muß, um sie als Modelle und Kronzeugen seiner Lebensphilosophie benutzen zu können. So verwandelt sich auch Gould, der pikareske Held, in einer Art "umgekehrter Evolution" im Tod wieder in einen Fisch, der stumm und ungerührt seine Bahn zieht. Die Geschichte fällt, wie in Ransmayrs "Letzter Welt", an die Natur und den Mythos, der lineare Fortschritt in den ewigen Kreislauf Ovidischer Metamorphosen zurück. "Es gibt kein Europa mehr, das es wert wäre, imitiert zu werden, nur dieses Leben, das wir kennen, in all seiner staunenswerten Verkommenheit und Pracht."
"Goulds Buch der Fische" ist als Fälschung getarnte Wahrheit, aus Abschaum destillierte barocke Schönheit: ein Triumph aufgeklärter Kunst. Flanagans dritter Roman wurde von enthusiastischen Kritikern mit Dante, Sterne, Fielding, Blake, Hugo, Faulkner, Dostojewski, Conrad und etlichen mehr verglichen und zu Recht mit dem Commonwealth-Preis ausgezeichnet: Es ist einer jener Flaschenpostbriefe von den Antipoden des Empire, aus denen die angelsächsische Literatur immer wieder neue Impulse zieht. Das "erste Meisterwerk des 21. Jahrhunderts" ist es freilich nicht. Dafür bleiben die Figuren in ihrer Bizarrerie zu flach, die Piranesi-Kerker, Walfängerspelunken und aboriginalen Zauberwälder zu kulissenhaft, die moralischen Allegorien zu aufdringlich, und das postmoderne Brimborium der Herausgeberfiktionen, Zitate, Anspielungen, selbstreflexiven Schleifen, in Körper geritzten Schriftzeichen und verrückten Bibliothekare - Jorgen Jorgensen erinnert nicht zufällig an Borges und seinen Wiedergänger in Ecos "Name der Rose" - ist oft nur ermüdend.
Flanagan kann sinnlich, hymnisch-pathetisch und dann wieder ironisch erzählen, als sei er der Statthalter des magischen Realismus in Australien. Aber wie sehr er auch mit dem Image des Naturburschen kokettiert, der tabula rasa mit abendländischen Exotismusprojektionen macht und nur in seinem Element ist, wenn er durch Blut, Schmutz und Scheiße watet: In Wahrheit ist er mit allen Wassern der Alten Welt gewaschen.
MARTIN HALTER
Richard Flanagan: "Goulds Buch der Fische". Ein Roman in zwölf Fischen. Aus dem Englischen übersetzt von Peter Knecht. Berlin Verlag, Berlin 2002. 462 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main