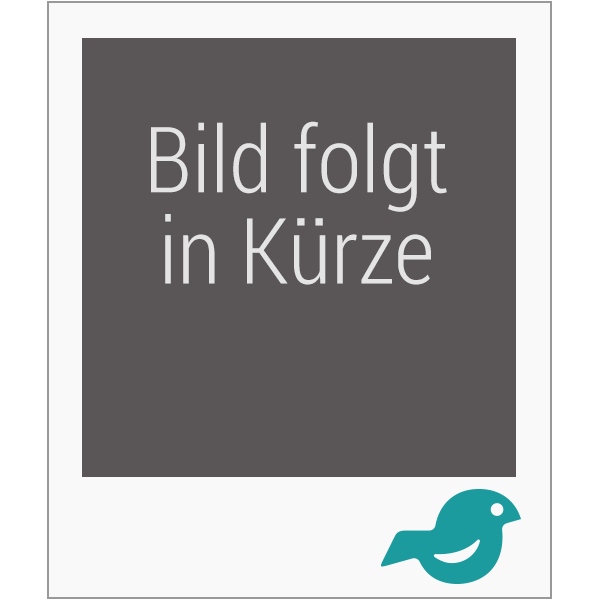Das Buch bietet eine umfassende Darstellung der Magie bei den Griechen und Römern vom 6./5. Jahrhundert v. Chr. bis in die Spätantike. Magie, so zeigt sich, war nicht nur ein Schadenzauber, mit dem man Rivalen ausschalten oder andere egoistische Ziele verwirklichen wollte, sie war hauptsächlich in der Spätantike ein ernsthafter Weg der Gottsuche.

Einschreiben aus dem Jenseits: Fritz Graf über den Schadenzauber in der Antike
Was man Magie nennt, ist eine Frage der Definition. Fritz Graf hat sich entschieden, seiner Darstellung der Magie in der griechisch-römischen Antike keinen modernen oder eigenen Begriff zugrunde zu legen, sondern von der antiken Terminologie auszugehen. Damit ist klar, daß der Staatskult außer Betracht bleibt, denn die Identifizierung magischer Elemente in der offiziellen Religionsausübung beruht auf moderner Sichtweise. Die Intention des Ausübenden entscheidet also, ob Magie vorliegt, nicht die Form des Rituals.
Indem er sich vom antiken Wortgebrauch leiten läßt, nimmt Graf allein Aspekte persönlicher Religiosität wie private Mysterienkulte, Divination und Schadenzauber in den Blick. Dazu gehört nicht nur die Beschreibung der magischen Praktiken, sondern auch ihre Einbettung in die jeweilige religiöse und soziale Umwelt sowie die Diskussion ethnologischer, anthropologischer und psychologischer Erklärungsmodelle.
"Magie" war von Anfang an ein polemischer Begriff. Der Name steht ursprünglich für die Tätigkeit persischer Priester, "der Magoi", und kam im Gefolge der Auseinandersetzungen mit dem Perserreich auf. Im fünften und vierten Jahrhundert wurde er von griechischen Philosophen und Ärzten dazu benutzt, bestimmte religiöse Techniken als fremd und "barbarisch" zu diskreditieren. Nun sind viele magische Praktiken wohl tatsächlich orientalischer Herkunft, wobei Beziehungen allerdings eher nach Mesopotamien als nach Persien deuten. Im Kontext der griechischen Gesellschaft gewinnen diese Praktiken allerdings eine ganz andere Bedeutung und Dynamik.
Das zeigen besonders eindrucksvoll die sogenannten Tabulae defixionum, die zu Hunderten vor allem in attischen, aber auch in anderen griechischen Gräbern gefunden wurden. Dabei handelt es sich um dünne Bleitäfelchen, auf denen Texte eingeritzt sind, die einen Gegner durch Schadenzauber binden sollten. Anwendung fanden solche Mittel meist in agonalen Situationen, wenn es galt, Gegner vor Gericht, in der Liebe, im sportlichen Wettkampf oder im Geschäftsleben auszuschalten. Defixionen waren bis in die römische Kaiserzeit allerdings nicht mit einer Tötungsabsicht verbunden, sondern dienten in aller Regel dazu, wie Graf es formuliert, "einen anderen Menschen dem eigenen Willen zu unterwerfen und ihn unfähig zu eigenem Handeln zu machen".
Was in Mesopotamien den Schutz vor dämonischen Einflüssen und Hilfe in vielen Lebenslagen bezweckte, wurde bei den Griechen zum Instrument im Konkurrenzkampf. Dieser Ritualtransfer ist mit einer entscheidenden Umwandlung verbunden: Die Griechen schmiedeten aus dem Schild eine Angriffswaffe. Daß sie deren Erfindung dann ihren östlichen Nachbarn in die Schuhe schoben, erscheint im Rückblick besonders perfide.
Grafs Darstellung zeichnet sich nicht nur durch solche Pointen aus, sondern auch durch viele anschauliche Beispiele. Der Autor zeigt, wie die magische Attacke funktionierte und wie sie abgewehrt oder zur Not auch als Argument für das eigene Versagen gebraucht werden konnte. So wurde die Magie tatsächlich zum "Mittel, um die Kontingenz menschlicher Existenz zu erklären und handhabbar zu machen" - und zwar sowohl aus der Täter- als auch aus der Opferperspektive.
Die Botschaft der Defixionen richtete sich an Dämonen und Unterweltsgötter. Dementsprechend wurden die beschrifteten Bleitäfelchen an Orten niedergelegt, die der Unterwelt nahe sind: in der Erde, im Meer, in einem Fluß, in einem Brunnen oder - am besten - in einem Grab. Der Tote galt als eine Art "jenseitiger Briefträger", wobei die Gruppe der unzeitig und gewaltsam Umgekommenen vom Magier bevorzugt wurde. Solchen Toten unterstellte man einen starken Neid auf die Lebenden, was sie zu besonders bereitwilligen Medien für Unglücksbotschaften machte. Oft vergleichen sich die Texte mit dem Opfer, wie in etwa der folgenden attischen Defixion: "Wie dieses kalt und verkehrt ist, so sollen die Worte des Krates kalt und verkehrt sein, die seinen ebenso wie die der Ankläger und der Anwälte, die ihn begleiten." Kalt ist das Bleitäfelchen und verkehrt die Beschriftung, die von rechts nach links verläuft. Graf versteht das als symbolische, nicht als sympathetische Aussage.
Selbst bei den Zauberpuppen mit durchstochenen Gliedern, die in zahlreichen Gräbern zum Vorschein kamen, kann von Voodoo-Zauber, von mystischer Teilhabe zwischen Dingen und Menschen nicht die Rede sein. Außerdem waren die magischen Handlungen durch Inversionen gekennzeichnet: Das Ritual fand bei Nacht unter Ausschluß der Öffentlichkeit statt. Es richtete sich nach unten, an die Dämonen und Gottheiten der Unterwelt. Es wurden nicht die üblichen Tiere geopfert, es wurde still gebetet. Die Personen, denen der Schadenzauber gelten sollte, wurden mit dem Namen ihrer Mutter bezeichnet.
Neben den Defixionen bilden die ägyptischen Zauberpapyri aus der mittleren Kaiserzeit die zweite für die antike Magie spezifische Dokumentengattung. Graf interpretiert diese Schriften, die uns der Wüstensand aufbewahrt hat, als Zeugnisse für das Streben nach Gottesnähe. Wie die Mysterienkulte verlangte auch die magische Beschwörung Geheimhaltung. Sie besaß ein komplexes Initiationsritual und suchte den direkten Kontakt mit dem Göttlichen. Dabei versuchte der Magier sich einen Parhedros, einen übermenschlichen Helfer, zu erwerben oder sich rituell Zugang zu einer übermächtigen Gottheit zu verschaffen.
Anders als die Mysterienkulte vermittelte die Magie jedoch kein Gemeinschaftserlebnis und verfolgte auch kein eschatologisches Ziel. Dennoch liegen die Parallelen zu zeitgenössischen Tendenzen auf der Hand: Man denke nur an die Theurgie der neuplatonischen Philosophen, an die Gnosis oder an die christliche Heiligenverehrung. Die Magie, so das Resümee, "fügt sich mithin in die Religion der Kaiserzeit bruchlos ein".
Eine interessante Beobachtung betrifft die Umkehrung des Verhältnisses von Männern und Frauen. Während in der Wirklichkeit der Überreste fast nur Männer als Auftraggeber und Akteure der Magie erscheinen, zaubern in der Literatur meistens Frauen. Graf erklärt den Widerspruch als Normenkonflikt: Ein wirklicher Mann zaubert eben nicht.
Ein besonders aufschlußreiches Kapitel hat der Autor der Frage gewidmet, was einen Menschen zum Magier machte. Ausgehend von Überlegungen des französischen Soziologen Marcel Mauss, analysiert Graf zwei Prozesse, in denen die Anklage auf Magie lautete. Es handelt sich um das Verfahren gegen einen gewissen C. Furius Cresimus (um 190 vor Christus in Rom), von dem der ältere Plinius berichtet, sowie um den Prozeß gegen den Rhetoren und Philosophen Apuleius (um 160 nach Christus in Sabratha, Provinz Africa), dessen Verteidigungsschrift erhalten ist. Solche Verfahren, so zeigt sich, bringen eine soziale Asymmetrie zwischen den Anklägern und dem Angeklagten zum Vorschein, die als unerträglich empfunden wird. Nach Mauss ist nicht nur jeder Zauberer eine marginale Gestalt, sondern jede marginale Gestalt ist auch ein potentieller Zauberer. Der Prozeß löst das Problem: entweder durch Integration oder durch Vernichtung des Außenseiters.
Fritz Graf hat ein gelehrtes und anregendes Buch geschrieben, das zuverlässig über die verschiedenen Aspekte der Schwarzen Magie in der griechisch-römischen Antike informiert. Zu kritisieren ist allenfalls, daß die historische Entwicklung des Gegenstandes keine Berücksichtigung findet. Es fehlt eine überzeugende Periodisierung, die den Zeitraum von tausend Jahren überbrücken könnte. KAI TRAMPEDACH
Fritz Graf: "Gottesnähe und Schadenzauber". Die Magie in der griechisch-römischen Antike. Verlag C. H. Beck, München 1996. 273 S., geb., 78,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main