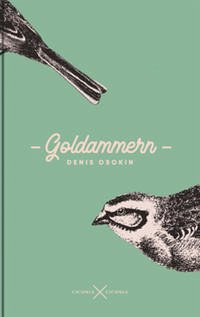Dieses Buch ist ein seltenes Beispiel dafür, wie umfangreich, überdimensional und poetisch russisch-sprachige Kurzprosa heute sein kann. Die hier enthaltenen Bücher, so nennt Osokin alle seine Texte, stellen das semantische Kristall der Kunst dar, das sich oft im Bereich der hohen Literatur herausbildet. Von besonderer Bedeutung für Osokins Sprache sind geographische Koordinaten mit nur ihnen innewohnenden Farben, die sich von Buch zu Buch ändern, während eine identische Autorenfigur durch die Landschaften führt.

Lob einer unterdrückten Kulturschicht: Der Dichter Denis Osokin entführt seine Leser in die Untiefen der russischen Provinz.
Von Kerstin Holm
Postkoloniale Selbstbesinnung führt auch in Russland dazu, dass Schriftsteller sich für früher unterdrückte Kulturschichten begeistern. Eine hierzulande noch wenig bekannte Kultfigur für diese Strömung ist der Kasaner Lyriker und Prosaautor Denis Osokin, den die russisch-tatarisch-finnougrische Vielstimmigkeit seiner depressiven Heimatregion inspiriert, in der die heidnischen Bräuche und Geister verschwundener Ethnien postsowjetische Zivilisationsniederungen überwuchern wie Heilkräuter den zerbröckelnden Asphalt. Osokin sieht sich als Patriot seiner Stadt Kasan, wo er, wie er sagt, in sämtliche Zeiten blicken könne und in der er das "Zentrum für russische Folklore" geleitet hat; seine besondere Liebe gilt den im Wolga-Gebiet indogenen Finnougren, deren Sprachen keine Worte für "Krieg", "Abschied" oder "Wollen" besitzen, weshalb ihn diese Kulturen in ihrer wehrlosen Pflanzenhaftigkeit bezaubern.
Der philologisch beschlagene Osokin betreibt freilich keine ethnographische Rekonstruktion. Vielmehr findet er Vokabeln, Rituale, die Naturfrömmigkeit der Jersjanen, Mokscha oder Mari in der Jetztzeit und flicht sie poetisch in das moderne Leben ein. Darin fühlt er sich dem russischen Avantgardedichter Welemir Chlebnikow verwandt, der aus Wortetymologien Rückschlüsse zog auf grundsätzliche Energieströme. Mit Chlebnikow verbindet ihn auch das Selbstverständnis des Dichters als idealerweise mittelloser Wanderderwisch.
Osokin, dessen Texte mehrfach verfilmt wurden, versetzt in äußerlich traurige Alltagswelten, wo erotische Urkräfte umso nachdrücklicher regieren. Verdienstvollerweise hat jetzt der Berliner Ciconia ciconia Verlag eine Sammlung Prosatexte sowie einige Gedichte Osokins in kongenialer Übersetzung von Christiane Körner herausgebracht, nur leider ohne einführendes Vor- oder Nachwort, was bei diesem Autor angezeigt gewesen wäre. Die schön gestaltete Ausgabe reproduziert auch Osokins durchgehende Kleinschreibung und die auf das seiner Ansicht nach absolut Notwendige reduzierte Interpunktion, die Satzglieder vorzugsweise durch Bindestriche aneinanderreiht.
Gleich die erste Erzählung "Wetluga", die die Kleinstadt im Landkreis Nischni Nowgorod, aber auch den gleichnamigen Fluss besingt, schildert eine Adventszeit in freiwilliger Selbstisolation, wie sie für den Ausklang unseres Corona-Jahres ein Beispiel geben könnte. Der Ich-Held begrüßt den Dezember als eine Art privaten Ramadan, eine Zeit des Rückzugs, der Selbstbesinnung und des Fastens, in der er, sich weitgehend von Sauerkraut und Kräutertee ernährend, geradezu physisch spürt, wie er ein besserer Mensch wird. Ohne aus dem Haus zu gehen, schweift er umher, lässt sich vom zärtlichen Klang der Ortsnamen forttragen, singt Lieder in Sprachen, die er nicht kennt. Der Text ist aber auch eine Hymne an die Silberweide (russisch: wetla), die als verzeihendes weibliches Naturprinzip das Wappen von Wetluga ziert. Und so mündet er in einer Liebesvereinigung. Das Paar besiegelt sie durch Opfergaben an den Wetluga-Flussgott, woraufhin dieser sich prompt durch ein Gegengeschenk revanchiert.
Osokin charakterisiert die späten Nachkommen der Wolga-Finnen als Leute mit tiefen, stillen Seelen, ausdruckslosen Gesichtern und ekstatisch-willkürlichen sexuellen Beziehungen. Seine berühmte Geschichte "Goldammern", die dem Sammelband den Titel gab, ist auch eine Hommage an die elementare Sehnsucht und zugleich an das Einander-Nichtverstehen von Mann und Frau. Osokins Erzähler, der aus einer Laune ein Goldammer-Pärchen gekauft hat, vollzieht mit seinem Fabrikchef ein uraltes Feuerbestattungsritual an dessen jung verstorbener Frau. Wie die beiden Männer in die spirituelle Welt der vor vierhundert Jahren in den slawischen Nachbarstämmen aufgegangenen Ethnie der Merja ein- und untertauchen - buchstäblich -, daraus hat der Regisseur Alexej Fedortschenko schon 2010 den Film "Silent Souls" gemacht.
Die halb vergessenen Bräuche der Merja erschließen die Magie dieser ärmlichen Landschaft. Die Tote wird einem umgekehrten Brautmysterium unterzogen, man schmückt ihr die Scham, bringt sie an den Flusslauf ihrer Hochzeitsferien und äschert sie dort ein. Auf der Fahrt durch Orte mit finnischen Namen weiht der Witwer seinen Gehilfen in intimste Details des Verkehrs mit der passiv ihm ergebenen Gattin ein. Selbst die Hotelnacht mit zwei Zufallsbekanntschaften gehört zur Trauerarbeit - weibliche Körper seien ja auch Flüsse, die Kummer forttrügen, sagt der Erzähler, bevor er verrät, dass er und sein Chef infolge eines Autounfalls ertrunken, damit aber in die lebendige Unterwasserwelt der Merja eingegangen seien.
Osokin lässt gefährliche Naturgeister auftreten, worin auch die Beiläufigkeit von Gewalt in Russland ihren Widerhall findet. So wird in den durch die Folklore des hohen Nordens inspirierten Miniaturen "Aus dem Volk der Komi" eine Mutter zur Möchtegernmörderin an ihren Kindern und kann nur durch einen speziellen Kräuterzauber wieder "enthext" werden. Und eine Dorfbibliothekarin erscheint als von Walddämonen geschulte, dadurch aber auch mit dunklen Mächten verbündete Heilkundige.
Umso heiterer gerät dafür die Geschichte von den "Neuen Schuhen", die ein alter Priester des Volkes der Mari El im Frühjahr kauft und damit andere Geisterseher und sogar eine örtliche Gottheit in Aufruhr versetzt. Wie skurrile Opferaktionen diesen Erwerb fördern und nebenbei auch anderen Familien praktisch helfen, das ergibt das humoristische Bild eines feinabgestimmten Gemeinwesens.
Die am ehesten psychologisch-realistische Erzählung der Sammlung, "Die Klassenbeste", enthält auch ein wahrhaft finnougrisches Bekenntnis zur Unmöglichkeit des Abschiednehmens. Ein junger Vater holt seine kleine Tochter von der Schuljahrsabschlussfeier ab, um mit ihr in die langen Sommerferien zu fahren. Der Text wirkt wie ein Drehbuch für ein Roadmovie, die beiden reisen mit dem Zug nach Astrachan, ins aserbaidschanische Baku, nach Tschimkent in Kasachstan, wobei sie immer wieder ins heimatliche Kasan zurückkehren, aber nur, um wieder aufzubrechen. In seiner zarten Verliebtheit in das Kind erinnert der Erzähler an einen unschuldigen Humbert Humbert. Er liest dem Mädchen die Wünsche von den Augen ab, trocknet seine Tränen, kauft ihm Spielzeug, erneuert die bunte Schminke, die lustige Clowns allen Klassenkameraden verpasst hatten. Erst gegen Ende wird klar, dass er und die Mutter des Kindes sich haben scheiden lassen, weshalb er manisch mit der Tochter umherfährt, um diese Wirklichkeit auszublenden. Das Buch endet mit einem Versepos über einen Plastikschlitten, den der Dichter aus der Wohnung seiner Ex holt, einer Winterreise zu verlorenen Träumen: "liebe? fasse ich dich wohl? / wird mir schönes winken?", heißt es darin. Doch das Zeichen zeigt: "neujahrstanne weigert sich / festlich mir zu blinken."
Denis Osokin: "Goldammern".
Aus dem Russischen von Christiane Körner. Ciconia ciconia Verlag, Berlin 2020. 200 S., Abb., geb., 25,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Dlf Kultur-Rezension
Großen Spaß gemacht hat Rezensent Carsten Hueck der Erzählband des russischen Schriftstellers und Mythenforschers. Ganz offensichtlich habe der sich in die Welt seiner Forschung hineinbegeben und schreibe von Orten und Personen, in der eine Mischung aus "postsowjetischer Tristesse" und sinnlich-fließend vorgestellten, heidnischen Welten herrsche. Sehr überzeugt haben den Kritiker jene Motive, in denen Natur in verschiedenen Spielarten immer wieder zur Erlösung für die Protagonisten wird - wie die "erstaunlich plastischen" Schamlippen, die Wörter bilden, oder auch wie die zuvor im Käfig gehaltenen, titelgebenden Vögel, die erst einer toten Frau etwas vorsingen und dann im Wald verschwinden dürfen. Der Kritiker freut sich über das Spielerische - und auf mehr von diesem Autor.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH