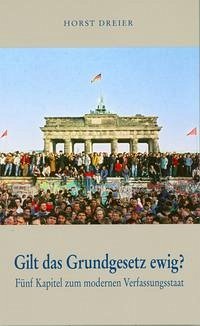Produktdetails
- Verlag: Carl Friedrich von Siemens Stiftung
- Seitenzahl: 122
- Erscheinungstermin: 9. Dezember 2009
- Deutsch
- Abmessung: 20.5cm x 12.5cm
- Gewicht: 205g
- ISBN-13: 9783938593134
- ISBN-10: 393859313X
- Artikelnr.: 28035967

Horst Dreier fragt nach der Zukunft des Grundgesetzes
Verfassungen sollen das politische Leben auf Dauer ordnen, Leitlinien der Rechtsordnung vorgeben, gewissermaßen das Hauptbuch des Staates bilden. Sie sollen gleichermaßen fest und flexibel sein. Ihre Lebenskraft gewinnen sie nicht aus sich selbst, sondern über ihre Handhabung im Alltag von Recht und Politik. Von ihrer Dauer und Vergänglichkeit ist in Horst Dreiers Essay die Rede, einem Münchner Vortrag vom November 2008. Es geht um fünf zentrale Fragen. Dreier erinnert zunächst mit „Verfassungsgebung” an das universalistische, absolute Wahrheiten reklamierende Pathos der amerikanisch-europäischen Verfassungsbewegung seit 1776/1789, zugleich an den Charakter der Verfassungen als Antwort auf eine politische Ausgangslage sowie an ihren Rechtsstatus als „Gesetz für den Gesetzgeber”. Wer an einer Verfassung mitwirkt, will eine Bindung für eine möglichst lange Zukunft. Aber für wie lange? Kaum eine der vielen vergänglichen Verfassungen hat je ihr eigenes Ende bedacht (Ausnahme: Art. 146 Grundgesetz), im Prinzip wollen sie „ewig” gelten. Nach historischer Erfahrung ist dies jedoch aussichtslos. Deshalb baute man meist einen flexiblen Änderungsmodus ein oder vertraute auf eine geschmeidige Auslegung durch die Praxis „im Horizont der Zeit”. Andernorts einigte man sich auf „Revisionen” in größeren Abständen, um den Text der veränderten Wirklichkeit anzupassen. Verfassungsänderungen, so das zweite Stichwort des Essays, gibt es also und muss es geben. Umstritten sind nur der Rhythmus der Veränderungen und der direkte oder indirekte Modus durch den qualifizierten Gesetzgeber oder durch Interpretation. Blickt man auf die gegenwärtig wieder wachsende Wunschliste für Veränderungen des Wortlauts des Grundgesetzes, dann möchte man äußerte Zurückhaltung empfehlen.
Das dritte der leitenden Stichworte ist die „Verfassungsverewigung”, wie sie für Kernelemente aus Art. 79 Abs. 3 GG bekannt ist. So gut nachvollziehbar die Entstehung der „Ewigkeitsklausel” im Horizont der Jahre 1948/49 ist, so klar werden heute auch die fragwürdigen Seiten der Festlegung gesehen, wenn in die dort verwendeten Grundbegriffe – wie in russischen Puppen – immer mehr Details hineingelegt und wieder herausgeholt werden, etwa in die „Menschenwürde”. Statt Verstetigung also, wie Dreier sagt, „Versteinerung”. Mit Recht warnt er davor, die interpretative Aufladung des Art. 79 Abs. 3 GG zu einer Fessel des demokratischen Gesetzgebers zu machen.
Scheinbar umgekehrt betreibt aber die herrschende Meinung der Staatsrechtslehre gelegentlich auch eine Art Entkernung von Verfassungsnormen. Hierum geht es unter dem vierten Stichwort „Verfassungsablösung” (Art. 146 GG). Nach glücklich erlangter Wiedervereinigung war bekanntlich streitig, ob man den Weg über Art. 146 GG oder Art. 23 alte Fassung gehen solle. Unter Zeitdruck und aus Besorgnis über unabsehbare Weiterungen einer Verfassungsrevisionsdebatte entschloss man sich für Art. 23. Ob der daraufhin subtil geänderte Art. 146 GG noch eine Funktion habe, blieb umstritten. Dreier plädiert hier mit überzeugenden Argumenten für eine solche Funktion, zumal im Hinblick auf eine zu erhaltende „lebendige Option” für die Zukunft. Kluge Modernisierer, seien sie nun eher „Etatisten” oder „Konstitutionalisten”, könnten eines fernen Tages froh sein, unter veränderten postnationalen Rahmenbedingungen über eine solche Option zu verfügen.
Folgt man Dreier, dann spricht also alles dafür, beim Umgang mit der Verfassung den Text ernst zu nehmen und ihn weder zu überfrachten noch zu marginalisieren. Deshalb ist er skeptisch gegenüber einer neuerdings zu beobachtenden „Verfassungssakralisierung”. Für sie gibt es in der Tat Anzeichen, und sie übersteigt den viel geschmähten und wohl auch bewusst missverstandenen „Verfassungspatriotismus” von Sternberger und Habermas. Sie entrückt das Objekt der menschlichen Gestaltung, entwindet es also dem eigentlichen Souverän. Da ohnehin in der Bundesrepublik Verfassungsinterpretation zu einer Art Zivilreligion (wenigstens der Juristen) geworden ist, liest es sich geradezu wohltuend, wenn Dreier daran erinnert, dass Interpretationsdebatten keine Glaubenskämpfe werden dürfen, auszufechten vor einem Priestertribunal „Karlsruhe”. Recht und Moral müssen für den Rechtsphilosophen Dreier getrennt bleiben. Erst dann kann das Recht seine freiheitsschützende Funktion erfüllen. Wird es dagegen als Stock missbraucht, mit dem die Tugendlosen geprügelt werden, hat es als eigenständige Normordnung ausgedient. Dreiers Antworten sind insgesamt erfreulich nüchtern. Sie zeigen eine an Kant und Kelsen geschulte Genauigkeit der Begrenzung von Aussagen sowie eine Distanz zu moralisierenden Überhöhungen und politischen Aufladungen des Verfassungstextes. Ein Essay, der nicht nur mehrmalige Lektüre, sondern vor allem Beherzigung verlangt; denn das Thema geht uns alle an. MICHAEL STOLLEIS
HORST DREIER: Gilt das Grundgesetz ewig? Fünf Kapitel zum modernen Verfassungsstaat. Carl Friedrich von Siemens Stiftung, Reihe „Themen”. München 2009, 121 S. (Über die Stiftung kostenlos zu beziehen.)
Verfassungsinterpretation ist in der Bundesrepublik zu einer Zivilreligion geworden
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de