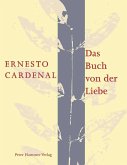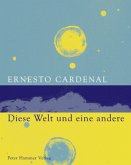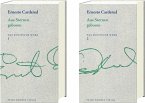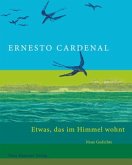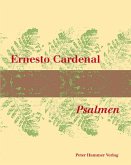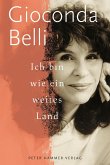Mit den großen Fragen der Menschheit beschäftigt sich Ernesto Cardenal in den "Gesängen des Universums", über die er selbst sagt, daß sie die Quintessenz und Synthese seines über fünfzigjährigen poetischen Schaffens seien. Das Werk umfaßt 43 Gesänge mit annähernd 1800 Versen, die sich um die Entstehung der Erde und den Sinn unseres Daseins, um Geburt, Leben, Tod und Leben nach dem Tod ranken.

Himmel schon auf Erden: Ernesto Cardenals lyrisches Hauptwerk
Der Priester, Dichter und Revolutionär Ernesto Cardenal gilt wohl immer noch als Symbolfigur für eine Symbiose von Christentum und Sozialismus. Heute, nach dem Scheitern der Utopien, lebt der ehemalige Kulturminister der sandinistischen Regierung zurückgezogen in Managua. Da mag man sich fragen, ob nun der Blick auf den Poeten Cardenal wieder frei wird.
Von Anfang an war Dichtung für Cardenal immer auch ein Instrument seines Wirkens, ein Vehikel zum Transport seiner Befreiungstheologie. Das zeigt schon sein frühes Poem "Gebet für Marilyn Monroe" (1965), das ihn berühmt machte. Das Gedicht bündelt die poetischen, religiösen und agitatorischen Impulse im Bild der Tempelaustreibung. Der Menschensohn vertreibt die Händler der 20th Century Fox aus dem Tempel des Körpers des Filmstars.
Es war die besondere Mischung aus Erotik, Religiosität und Aktivismus, die Cardenals Poesie attraktiv machte. Sie luxurierte zudem durch ihr schieres Quantum und bot gewissermaßen jedem etwas - übrigens auch ihren Kritikern. So spottete Mario Vargas Llosa über Cardenals "Cocktail aus Christentum und Revolution".
Wie prekär auch Cardenals Synkretismus sein mochte - seinem Erfolg schadete er nicht. Cardenal wurde zur Kultfigur. Sein Ruhm war in Europa womöglich noch größer als in Lateinamerika. Wie empfänglich man auch bei uns für seine Botschaft war, bewies 1980 die Verleihung des Friedenspreises. Der Peter Hammer Verlag, seit den siebziger Jahren um den Autor bemüht, präsentiert nun mit dem "Cántico Cósmico" ein opus maximum Cardenals - ein Weltgesang, der die Konkurrenz zu Lukrez und Dante aufnimmt.
"Gesänge des Universums" ist die deutsche Version überschrieben, die aus Umfangsgründen auf das Original verzichtet. Den Leser erwarten immerhin 43 Gesänge in zwei Bänden. So einschüchternd der Umfang, so hoch der Anspruch. Die Einleitung avisiert uns das Werk als die "astrophysikalische Epik" Cardenals, als Mischung von materialistischer und spiritualistischer Seinsbetrachtung, von Realismus und Science-fiction. Eingebettet in diese Kosmogonie ist die Menschheitsgeschichte und die Vorstellung, die menschliche Gattung strebe, "gemäß dem Gesetz der Harmonie im Gesamtuniversum", zu einer klassenlosen Gesellschaft.
Nun interessieren den Leser von Poesie erst in zweiter Linie die Ideen des Autors. Sie dürfen notfalls veraltet oder schlicht falsch sein, wenn nur der Gesang fasziniert. Dem steht bei Cardenal freilich einiges entgegen. Zunächst schon der schiere Umfang, der die Geduld des Lesers auf eine harte Probe stellt. Daß Cardenals Poem eher populär-wissenschaftlich gedacht und unsystematisch angelegt ist, möchte man da fast als Vorzug werten: "Was die Einheit dieses Gedichts angeht, / so hat es keine. Die Einheit ist außen."
Cardenal umspielt seine Themen und verliert sich in Abschweifungen und Variationen. Er schüttet einen Zettelkasten von Belegen, Zitaten und Autoritäten vor uns aus und meint: "Heute reden die Physiker wie die Mystiker." Aber müssen die Poeten darum wie die Sachbuchautoren reden?
Cardenals Mixtur aus Liebesmystik, Astrophysik und Kommunismus wird zur Falle des poetischen Gedankens. Wissenschaftliche Explikationen, die man zu Flattersatz zerhackt, ergeben noch keine Poesie. Und - noch problematischer - die menschenfreundlich multikulturell gedachte Mischung der Mythen schwächt die Vision. Die Bilder löschen einander aus. Cardenals zentrale Botschaft von Harmonie und Liebe wird damit so wohlmeinend wie beliebig. Seine erotische Obsession gerät zur gigantischen Platitüde. "Alles ein einziger Koitus./ Der ganze Kosmos Kopulation." Da ist es mehr als eine Geschmacksfrage, wie der Autor, der an manchen Stellen ergreifend das soziale Elend beschreibt, zu eigentümlich kritiklosen Emphasen abhebt und seine Liebesbotschaft manchmal wahllos über die Realität ausgießt: "Die modischen Kleider der Mädchen, was waren sie anders als Liebe." Das Pathos pauschaler Verheißung gerät zur Reklame: "Ich sage es noch einmal, / der Himmel ist hier auf Erden." Wozu dann eine Revolution? Wozu die ziemlich krude Guerrillero-Romantik, die Cardenal zu beleben versucht?
Aber lassen wir den Prediger, den Rhetoriker Cardenal. In ihm ist ja ein wirklicher Dichter versteckt. Er kommt leider nur selten zu Wort. Immer wieder einmal gelingen ihm lyrische Momentaufnahmen, symbolhafte Prägungen - etwa ein Strandbild mit Kindern, die Krebse suchen: "Entenhals fährt auf wie eine Schlange, / mit Silberfisch in seinem Schnabel." Das hat rhythmische und optische Präzision. Nur belegen solche Fundstücke im Geschiebe der Materialien die alte These, wonach ein langes Gedicht nur eine Abfolge von kürzeren ist - hier freilich mit allzuviel Leerlauf. HARALD HARTUNG
Ernesto Cardenal: "Gesänge des Universums / Cántico Cósmico". Aus dem Spanischen übertragen von Lutz Kliche. Peter Hammer Verlag, Wuppertal 1995. Zwei Bde., zus. 507 S., br., 68,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main